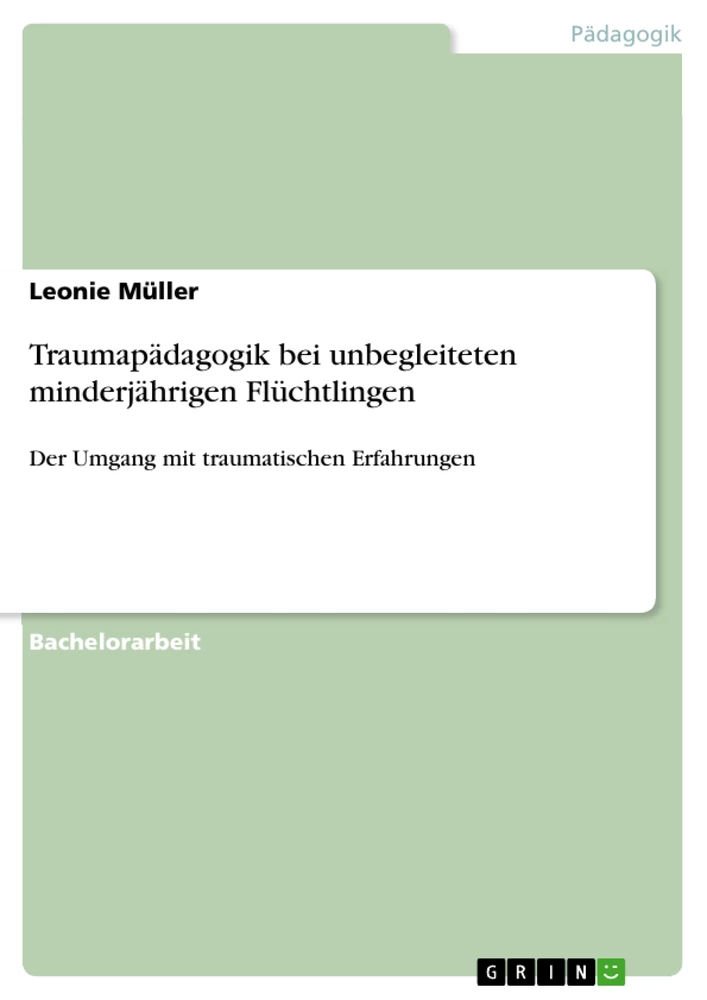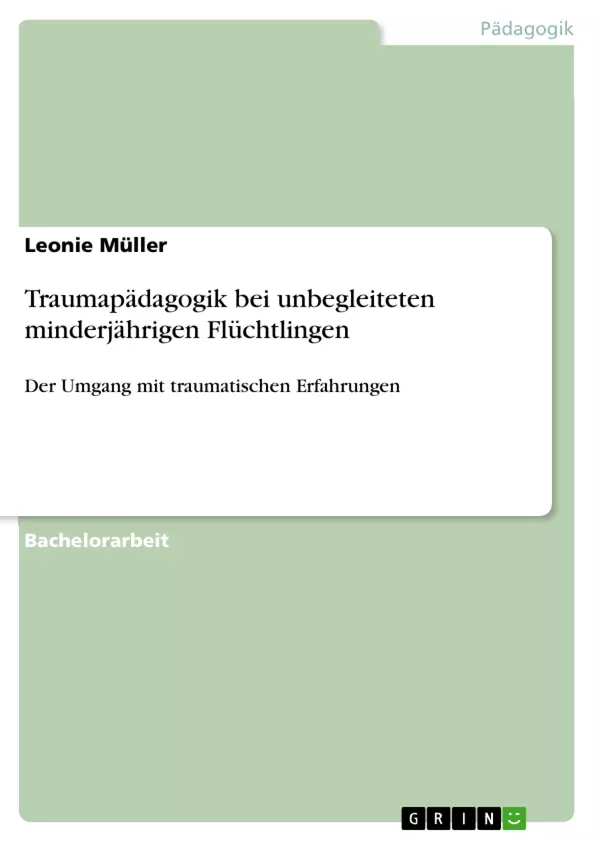Die Autorin beschäftigt sich mit Aspekten der Traumatisierung von minderjährigen Flüchtlingen vor, während und nach der Flucht. Zunächst werden Hintergrundinformationen bezüglich der Verfahren, vor welche unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF) bei der Ankunft in Deutschland gestellt werden erläutert. Dies erleichtert die Erfassung der aktuellen Lebenslage von UMF.
Darüber hinaus wird der Begriff des Traumas eingehend erläutert und verschiedene Traumafolgestörungen herausgearbeitet, die bei der Konzeptionsentwicklung der Traumapädagogik von besonderer Bedeutung sind. Infolgedessen werden sowohl Grundlagen der Traumapädagogik als auch allgemeine traumapädagogische Methoden aufgezeigt, sowie zwei der bekanntesten Konzepte der Traumapädagogik vorgestellt, bevor die Bedeutung ebendieser Konzepte für die Arbeit mit UMF aufgezeigt werden. Außerdem werden die besonderen Belastungen der Pädagog*innen herausgearbeitet, um ein holistisches Verständnis der Traumapädagogik zu subventionieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hintergründe
- Methodisches Vorgehen
- Ausgangslage
- Definition „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“
- Trauma
- Posttraumatische Belastungsstörung und Traumafolgestörung
- Besonderheit von Traumatisierung im Kindes- und Jugendalter
- Entwicklungsaufgaben
- Psychosoziale Entwicklung nach Erikson
- Entwicklungsbezogene Traumafolgestörung
- Traumatische Erfahrungen minderjähriger Geflüchteter
- Trauma im Kontext von Krieg, Migration und Flucht
- Psychologische und Soziale Konsequenzen
- Bindung und Trauma
- Bindungstheorie nach Bowlby
- Bindungstypen
- Dissoziation
- Sequenzielle Traumatisierung
- Traumapädagogik
- Grundlagen und Methoden Traumapädagogik
- Pädagogik des sicheren Ortes nach Kühn 2009
- Pädagogik der Selbstbemächtigung
- Die Bedeutung traumapädagogischer Ansätze bei der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
- Potenzielle Belastung der PädagogInnen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Bedeutung von Traumapädagogik für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF). Sie beleuchtet die besonderen Herausforderungen, denen diese Kinder und Jugendlichen im Kontext von Flucht und Trauma gegenüberstehen, und zeigt die Notwendigkeit traumapädagogischer Ansätze auf, um ihnen eine angemessene Unterstützung zukommen zu lassen.
- Traumatisierung bei UMF im Kontext von Flucht und Krieg
- Spezifische Herausforderungen für UMF in Bezug auf Integration und Teilhabe
- Grundlagen und Methoden der Traumapädagogik
- Die Bedeutung traumapädagogischer Ansätze für die Arbeit mit UMF
- Potenzielle Belastungen der PädagogInnen, die mit UMF arbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung präsentiert den Kontext der Arbeit und führt den Leser in das Thema der Traumapädagogik bei UMF ein. Sie stellt die Bedeutung des Themas heraus und beleuchtet aktuelle Entwicklungen und Debatten in Bezug auf Flüchtlingspolitik und die Rolle der Traumapädagogik.
- Hintergründe: Dieses Kapitel bietet wichtige Hintergrundinformationen zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, inklusive Definitionen, Rechtliches und Statistiken. Es erklärt die Begrifflichkeiten und Einordnungen, die für das Verständnis der Arbeit von Bedeutung sind.
- Trauma: Dieses Kapitel beleuchtet das Thema Trauma im Allgemeinen und geht auf die Besonderheiten von Traumatisierung bei Kindern und Jugendlichen ein. Es analysiert verschiedene Traumafolgestörungen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung und das Wohlbefinden von UMF.
- Traumapädagogik: Dieses Kapitel widmet sich den Grundlagen und Methoden der Traumapädagogik. Es stellt verschiedene traumapädagogische Ansätze vor und erläutert deren Bedeutung für die Arbeit mit UMF.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Traumapädagogik, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, Flucht, Traumatisierung, Integration, Teilhabe, pädagogische Ansätze und die Bewältigung von Traumata. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen, die mit der Arbeit mit UMF im Kontext von Flucht und Trauma einhergehen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)?
UMF sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die ohne sorgeberechtigte Begleitung aus ihrer Heimat geflohen und in Deutschland angekommen sind.
Warum ist Traumapädagogik für diese Gruppe so wichtig?
Viele UMF haben traumatische Erfahrungen durch Krieg und Flucht gemacht. Traumapädagogik bietet Konzepte wie den "sicheren Ort", um ihre psychosoziale Entwicklung zu stabilisieren.
Welche Traumafolgestörungen treten häufig auf?
Neben der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) werden in der Arbeit auch entwicklungsbezogene Traumafolgestörungen und Dissoziation thematisiert.
Was ist das Ziel der "Pädagogik der Selbstbemächtigung"?
Ziel ist es, den Jugendlichen zu helfen, wieder Kontrolle über ihr eigenes Leben zu gewinnen und ihre Selbstwirksamkeit zu stärken.
Welchen Belastungen sind Pädagogen in diesem Bereich ausgesetzt?
Die Arbeit mit traumatisierten Menschen kann zu Sekundärtraumatisierung und hoher psychischer Belastung führen, was ein holistisches Verständnis der Traumapädagogik erfordert.
- Quote paper
- Leonie Müller (Author), 2020, Traumapädagogik bei unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998528