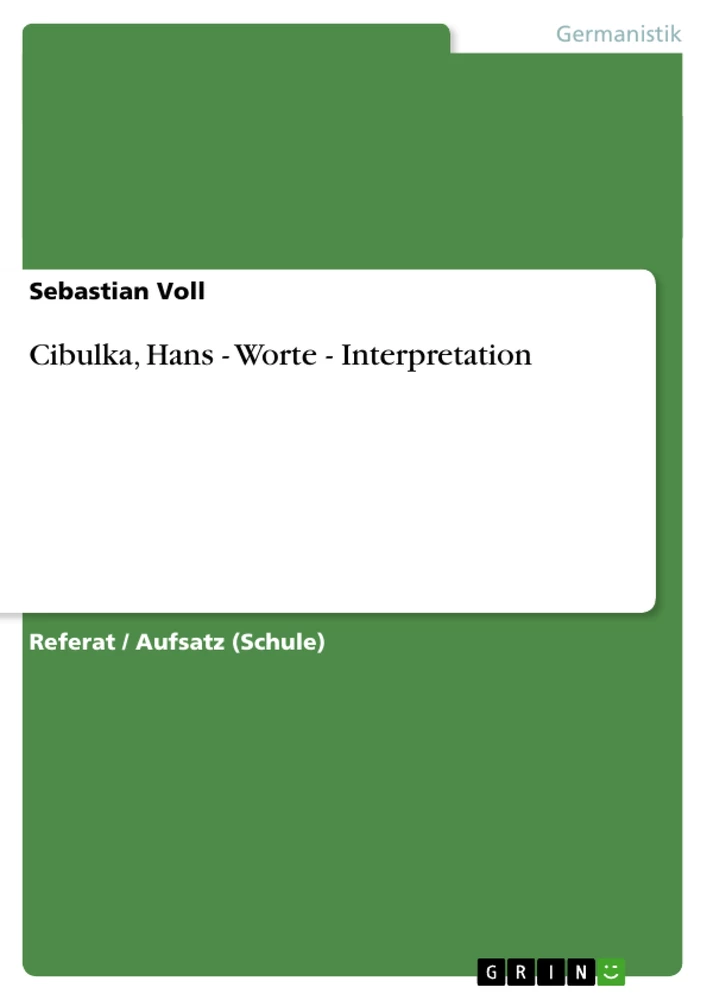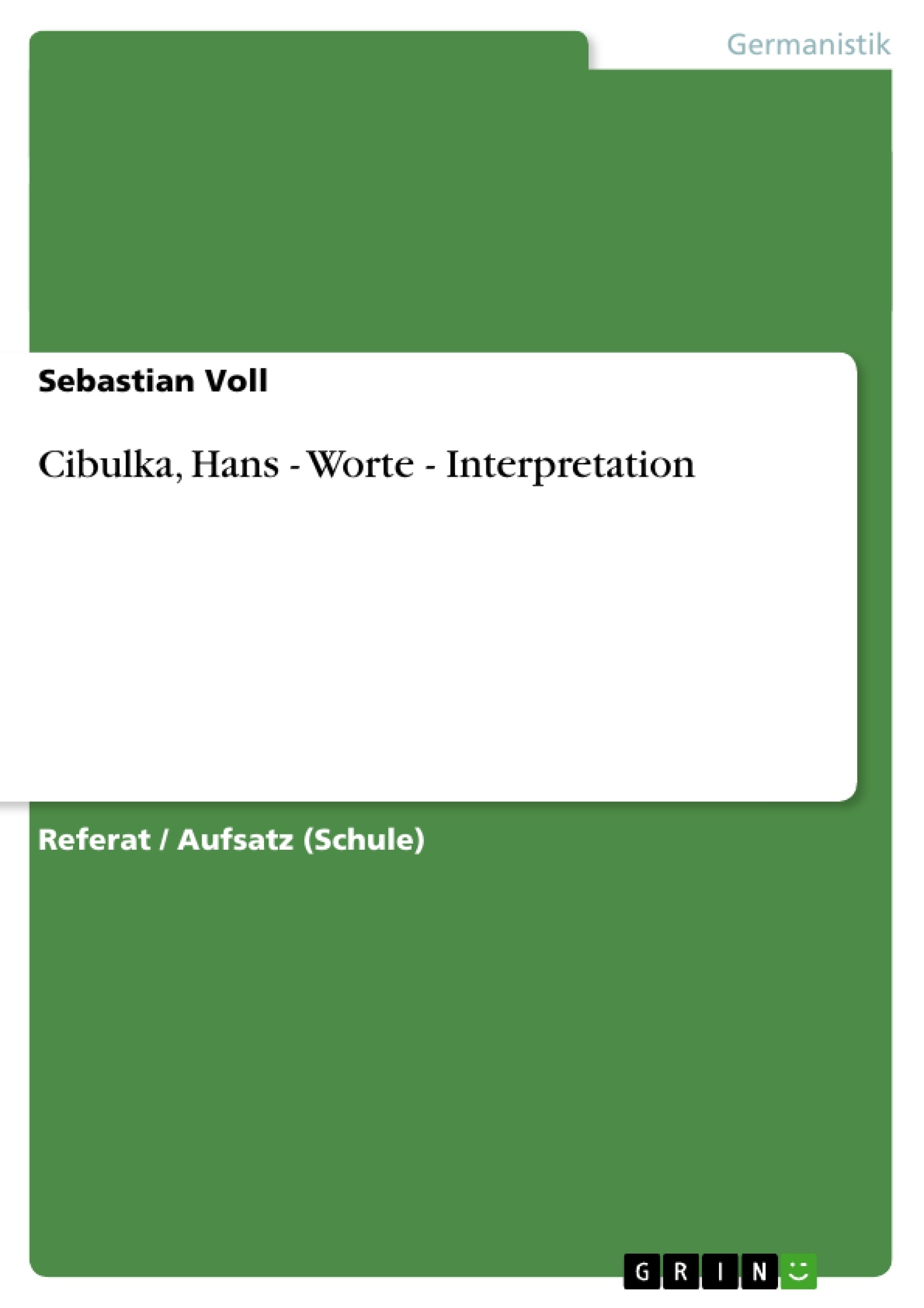Hanns Cibulka: ,,Worte"
Worte sind, seit der Mensch das Sprechen erlernt hat, die absolute Grundlage unserer Verständigung. Obwohl sich im Laufe der Menschheitsentwicklung überall auf der Welt verschiedene Sprachen herausgebildet haben, bleibt das Prinzip doch immer das selbe: verschiedene Laute und deren Verknüpfung bilden Worte, die für sich alleine oder im Zusammenhang mit anderen Lauten Dinge, Tätigkeiten, Emotionen, Gedanken oder Eindrücke beschreiben. Dadurch, das der Mensch gelernt hat, seine Worte festzuhalten (Papyrus, Tontafeln, später Bücher...) konnte der Nachwelt ein ungeheurer Schatz an Wissen erhalten werden und diejenigen Menschen, die mit Worten in ihrer Zeit meisterhaft umzugehen wussten, prägen auch die Vorstellungen über diese Zeit in den späteren Generationen, denkt man nur an Cicero oder Homer. Die ungeheure Wirkung der Sprache, richtig vermittelt, ist also schon lange bekannt und wurde nicht selten ausgenutzt, um andere zu beeinflussen oder von etwas zu überzeugen, dem sie erst ablehnend gegenüber standen. Diesen Umstand macht man sich nicht nur in der Wirtschaft, sprich in der Werbung, sondern vor allem in der Politik zu nutze. So kommt es doch in der letzten Zeit des öfteren vor, das Menschen sich mehr und mehr abschotten, ein Fakt, der nicht zu letzt den neuen technischen Errungenschaften wie E-Mail oder dem derzeitigen Handy-Wahn zu verdanken ist. Worte sind derzeit offenbar zu allgegenwärtig, werden zu oft verfälscht, wirken zu oft unangenehm so das ihr eigentlicher Zweck entstellt ist, ein Problem, das Hanns Cibulka in seinem Gedicht ,,Worte" kritisiert.
Die Nüchternheit des Titels lässt dem Leser zunächst jeden Deutungsspielraum offen. Mögliche Gedankengänge führen in Richtung der Bedeutung der Worte im Allgemeine n, welche Auswirkungen die falschen Worte zur falschen Zeit haben können und wie die Geschichte das beweist (man denke nur an den ,,Zufall" der Grenzöffnung in der DDR 1989) oder einfach wie einem der Großvater früher mit ruhiger Stimme aus dem Märchenbuch vorgelesen hat und man sich wünschte, ebenfalls lesen zu können. Die darauf folgende, absolut negativ konnotierte Aufzählung von Verben lässt ein geradezu gewalttätiges Bild von Folter und Qualen erscheinen. Gewalttaten, Folter und Unmenschlichkeit erschließen sich dem Leser. Bezieht man dies auf den Titel des Bildes, kann man eine herbe Gesellschaftskritik entdecken: Von den einen werden sie benutzt, ohne das über den Gebrauch der Worte nachgedacht wird. Sie werden falsch eingesetzt, wieder und wieder strapaziert, ihre einstmals wichtige Bedeutung geht verloren. Der wahre Sinn dahinter ist nicht mehr zu entdecken oder man kann ihm mittlerweile nicht mehr trauen. So ist hier die eine Gruppe der Unwissenden zu sehen, die aus ihrem Unvermögen heraus die Worte sinnvoll zu nutzen diese strapaziert und ,,schindet"
Eine weitere Gruppe Mensch wäre die des ,,bewussten Lügners", welche die Worte nur zu eigenen Vorteil ausnutzt, jedem nach dem Mund redet nur um das eigene Ziel verwirklicht zu sehen. Durch sie werden die Worte wirklich ,,...getreten,/ ausgewiesen,/ zurückgeholt/ und wieder verleugnet." Hier hat Ehrlichkeit keinen Platz mehr, die Sprache wird je nach Situation genutzt, dem einen sagt man es so, dem anderen wiederum so. Und wenn es ganz dumm kommt, leugnet man halt, je so etwas gesagt zu haben nur um es sich später wieder anders zu überlegen. Der Sinn der Worte wird mit Füßen getreten, somit auch die Beziehung zu den Menschen, die auf die Worte des Einzelnen vertrauen. Aber: in der heutigen Gesellschaft zählt das ja sowieso nicht mehr, nur der Einzelkämpfer überlebt und ist erfolgreicher als die anderen. Er darf keine Rücksicht auf andere nehmen und muss sich jeden Mittels bedienen, um Zugang zu den Menschen zu finden und das beste Mittel dazu ist immer noch die Kommunikation.
Die 2.Strophe, ein 8- Zeiler, setzt das gewalttätige Bild aus der 1.Strophe fort. Das lyrische Ich trägt die Worte als Schrei im Ohr, wobei ein Schrei immer etwas negatives, lautes und unangenehmes symbolisiert, das Schmerzen im Ohr erzeugt. Auch muss der Schrei durch irgendeinen Schrecken oder Schmerz, eine Unannehmlichkeit ausgelöst worden sein. Das der Schrei noch getragen wird zeigt, das er dauerhaft anwesend ist, sich also nicht verdrängen oder vergessen lässt. Hier könnte man eben die ewig gegenwärtige Werbung heranziehen, die, ob im Fernsehen, Radio, Internet oder einfach auf Plakaten, ständig um den Menschen herum ist, ihn ständig mit Versprechen lockt und oftmals einfach nur noch lästig ist, dem Mensch die Ruhe und Privatsphä re raubt. Auch könnte einfach das absolut stressige Alltagsleben beschreiben: Menschenmassen, in der jeder durcheinander redet, Handys, die einem keinen Augenblick Ruhe gönnen, Walk- und Discmans die auch das letzte bisschen Entspannung versuchen zu vertreiben sowie die mittlerweile allgemein übliche Lärmkulisse. Man kann in diesen 2 Zeilen also eine absolute ,,Sättigung" des lyr. Subjekts von Worten feststellen, das es sich nach Ruhe oder zumindest einer sanfteren, korrekteren Nutzung dieser ,,zartesten aller Gebilde" sehnt. In diesem Zusammenhang ist auch erwähnenswert, das dieser ,,Schrei im Ohr" an eine in den letzten Jahren verstärkt auftretende Nervenkrankheit, den sogenannten Tinitus, erinnert, welcher Nachgewiesenerweise entweder auf starken Stress oder zu hohe Lautstärke zurückzuführen ist.
Die nächsten 2 Zeilen wirken inhaltlich gesehen sehr überraschend: war das lyr. Ich bis jetzt nur ,,Opfer" der Worte, wird doch jetzt beschrieben, wie es ,,die Lüge unter der Zunge trägt". Zusammen mit den nächsten 4 Zeilen formt sich nun ein neues Bild, nicht nur das des Opfers, sondern auch das des bewussten Täters, der die Worte wie jeder andere ebenfalls einsetzt, um sein Ziel zu erreichen.
Dies zeigt eine notwendige Anpassung an die Gesellschaft, das lyr. Subjekt sieht die Lüge wie ,,...das Brot von dem ich täglich esse," also als etwas Normales ohne das man nicht leben kann. Die Entfremdung von dem ursprünglichen Zweck der Worte und dieser als zwischenmenschliches Verbindungsmittel ist, trotz dessen erkannt wurde das dies falsch sei, geschehen. Die Lügen sind ,,...dem Körper ein unsichtbares Kleid.", hüllen das lyr. Ich also ein und sind ständiger Teil von ihm.
Das hier verwendete Contradictio in adjecto (,,unsichtbares Kleid") zeigt das Bild der ständig anwesenden, unscheinbaren und andere Menschen täuschenden Lügen und verstärkt dieses. Ein Kleid umhüllt normalerweise den Körper, bildet eine Hülle und versteckt das darunter liegende. So verdecken auch die Worte das wahre Ich des lyr. Subjekts, führen die Mitmenschen auf Irrwege und verblenden die Wahrheit. Dadurch, das dieses Kleid, die ständige Lüge, unsichtbar ist, wird von der Umgebung der Betrug nicht wahrgenommen, sie wird getäuscht ohne sich bewusst zu sein, dass die Wahrheit tiefer (unter dem ,,Kleid") und vorerst nicht erkennbar liegt.
Die als nächstes folgende, sehr starke und negativ konnotierte Metapher des ,,Brennnesselwald[es]" zeigt dennoch, dass das lyr. Ich verzweifelt ist, was seine Situation und den Umgang mit dieser angeht. So sieht es die Worte, Lügen, als einen undurchdringlichen Wald, in dem man sich leicht verirren kann und dann nicht mehr heraus findet. Die Brennnessel noch dazu führen einem das Bild des Schmerzens auf, wenn man mit den Lügen in Berührung kommt, genauso wie man sic h an den Nesseln verbrennt Die Vorstellung von 15m hohen Brennnesseln, so dick wie Buchenstämme, wirkt ja äußerst beängstigend und zeigt doch die Macht, die den Worten inne wohnt auf. Sie werden genutzt, um anderen Menschen zu schaden.
Und dennoch, trotz dieser negativen Seiten sind die Worte nach Meinung des lyr. Subjekts die ,,zartesten aller Gebilde". Sie sind zerbrechlich und unschuldig, obwohl sie so viel Leid herbeiführen. Denn dies liegt nicht an ihnen selber, sondern sie werden von den Menschen ja genutzt, leiden also unter der Misshandlung durch die Menschen obwohl sie einen so viel besseren Sinn und Zweck haben. Ihre Schuld ist es nicht, das die Charakterzüge der verschiedenen Individuen eine Verwendung der gemäß ihrem eigentlichen Zweck, die Menschen einander näher zu bringen, nicht zulassen.
Worte sind ,,staublos", ein Bild, das einer ,,weißen Weste" gleich kommt, erschließt sich dem Leser. Nicht einmal der Staub, als kleinste Untereinheit allen Schmutzes bleibt an ihnen hängen, so das sie von jeder Schuld befreit sind, nicht einmal die Spur einer Lüge ist an ihnen selber zu erkennen, sie werden erst zu so etwas, wenn sie von dem Mensch genutzt werden.
Häufig gestellte Fragen zu Hanns Cibulka: ,,Worte"
Worum geht es in Hanns Cibulkas Gedicht ,,Worte"?
Das Gedicht ,,Worte" von Hanns Cibulka thematisiert die Bedeutung und den Missbrauch von Sprache. Es kritisiert, wie Worte in der heutigen Gesellschaft oft verfälscht, strapaziert und zu eigenen Zwecken ausgenutzt werden, wodurch ihr ursprünglicher Sinn verloren geht.
Welche Rolle spielt die Sprache in der menschlichen Verständigung laut dem Text?
Sprache wird als die absolute Grundlage unserer Verständigung dargestellt, seit der Mensch das Sprechen erlernt hat. Sie ermöglicht es, Dinge, Tätigkeiten, Emotionen, Gedanken und Eindrücke zu beschreiben und Wissen an nachfolgende Generationen weiterzugeben.
Wie wird der Missbrauch von Sprache im Gedicht dargestellt?
Der Missbrauch von Sprache wird durch gewalttätige Verben und negativ konnotierte Aufzählungen dargestellt. Worte werden "getreten", "ausgewiesen", "zurückgeholt" und "verleugnet", was ein Bild von Folter und Qualen erzeugt. Dies spiegelt eine Kritik an der Gesellschaft wider, in der Worte oft unbedacht oder bewusst manipulativ eingesetzt werden.
Welche Rolle spielen Lügen im Gedicht?
Lügen werden als ein allgegenwärtiger Bestandteil der Gesellschaft dargestellt, den das lyrische Ich als "das Brot, von dem ich täglich esse" beschreibt. Sie sind wie ein "unsichtbares Kleid", das den Körper umhüllt und die Wahrheit verbirgt.
Welches Bild vermittelt die Metapher des "Brennnesselwaldes"?
Die Metapher des "Brennnesselwaldes" symbolisiert die Verzweiflung des lyrischen Ichs angesichts der Situation und des Umgangs mit Worten. Sie stellt die Worte und Lügen als einen undurchdringlichen Wald dar, in dem man sich verirren kann und in dem man Schmerzen erleidet, wenn man mit den Lügen in Berührung kommt.
Wie werden die Worte am Ende des Gedichts beschrieben?
Trotz der negativen Aspekte werden die Worte am Ende des Gedichts als die "zartesten aller Gebilde" beschrieben. Sie sind zerbrechlich, unschuldig und "staublos", was bedeutet, dass sie von jeder Schuld befreit sind. Die Schuld liegt vielmehr in der missbräuchlichen Verwendung durch die Menschen.
Welche stilistischen Mittel werden im Gedicht verwendet?
Das Gedicht ist freirhythmisch und reimlos, was die Gesellschaftskritik unterstützt. Es verwendet hauptsächlich Metaphern, um den "Worten" einen bildhaften Charakter zu verleihen und das Leid hervorzuheben, das Menschen sich selbst zufügen.
Wie ist die Stimmung der einzelnen Strophen im Gedicht?
Die ersten drei Strophen sind überwiegend negativ konnotiert, während die letzte Strophe ein sanftes und positives Bild vermittelt. Dies dient als Widerspruch und Argument gegen die zuvor aufgezählten negativen Aspekte.
- Quote paper
- Sebastian Voll (Author), 1999, Cibulka, Hans - Worte - Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99858