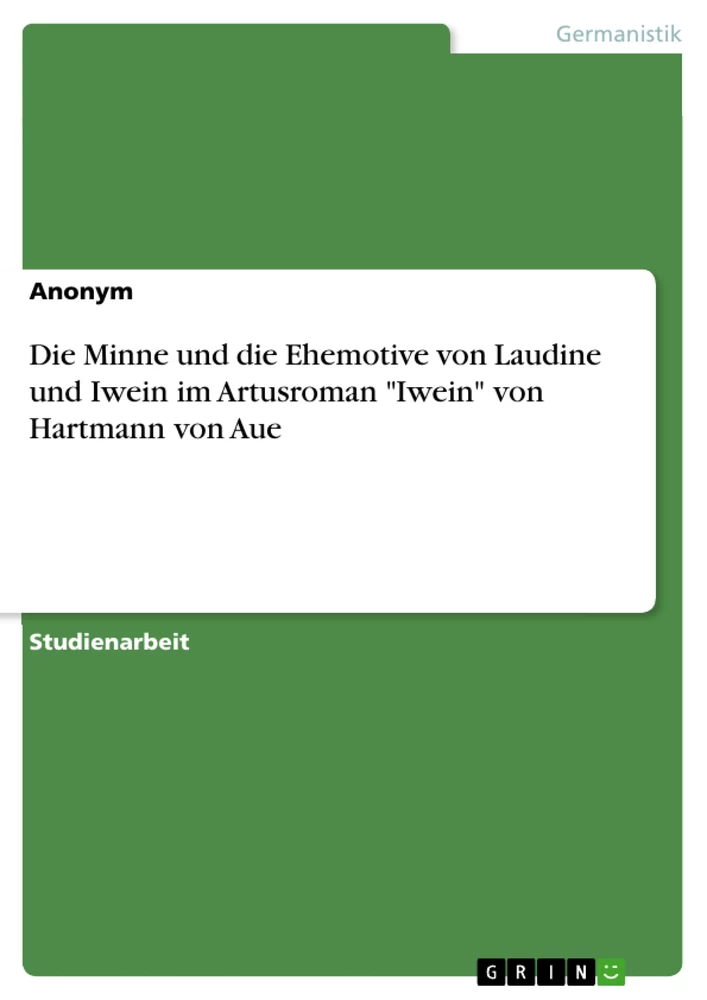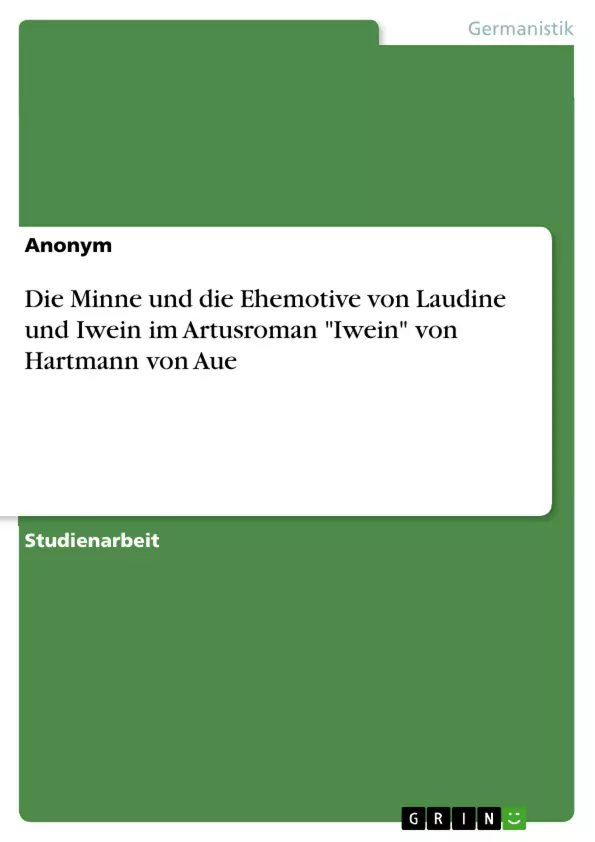Was sind die Gründe und Motive seitens Laudine und Iwein für ihre ungewöhnliche Eheverbindung in Hartmann von Aues Artusroman „Iwein“? Das Ziel dieser Hausarbeit ist herauszufinden, ob die Ehe für Laudine und Iwein aus Minne oder aus anderweitigen, beispielsweise aus politischen Hintergründen, eingegangen wird. Dafür werden hierfür relevante Textpassagen zwischen den Versen 1305 und 2420 der Primärliteratur Iwein untersucht und – auf Basis einiger Quellen aus der Forschungsliteratur – in Bezug auf die Fragestellung interpretiert.
Die Frage nach den Ehemotiven der Figuren Laudine und Iwein ist für den vorliegenden Artusroman sowie für die Mediävistik im Ganzen von besonderem Interesse, weil sie innerhalb der mediävistischen Literaturwissenschaft ein viel diskutiertes und kontroverses Thema darstellt. Die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit ist daher von besonderer Relevanz, da sie die Grundlage für die Erklärung weiterer, im Roman auftretender Geschehnisse und Verhaltensweisen der beiden Figuren ist.
Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst der Begriff Minne definiert und dessen Bedeutung sowie die Ehe in der höfischen Literatur dargestellt. Dann folgt im zweiten Teil die Analyse der Motive der beiden literarischen Figuren. Abschließend werden die vorhandenen Motivationen und Gründe in einem Fazit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Minne bzw. höfische Liebe und Ehe in der höfischen Literatur
- Definitionen und Arten der Minne bzw. höfischen Liebe
- Ehe und Liebe in der höfischen Epik
- Iweins und Laudines Motivation zur Ehe - Liebe oder politischer Hintergrund?
- Iweins Motivation zur Ehe – Liebe und Sühneleistung
- Laudines Motivation zur Ehe – politische Absicht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Ehe von Laudine und Iwein im Artusroman „Iwein“ von Hartmann von Aue. Sie untersucht die Motive und Gründe für diese ungewöhnliche Verbindung, insbesondere die Frage, ob die Ehe aus Minne oder aus politischen Hintergründen geschlossen wurde.
- Definition und Bedeutung von Minne in der höfischen Literatur
- Analyse der Ehemotive von Laudine und Iwein
- Bedeutung der Ehe in der höfischen Epik
- Bedeutung der Minne für das Verständnis von Iweins Verhalten
- Untersuchung der politischen Hintergründe für die Ehe
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit definiert den Begriff Minne und seine Bedeutung im Kontext der höfischen Literatur. Es werden verschiedene Arten der Minne sowie die Rolle der Ehe in der höfischen Epik beleuchtet. Im zweiten Kapitel werden die Motive von Laudine und Iwein für ihre Ehe untersucht. Hierbei werden sowohl Iweins Motivation zur Sühne als auch Laudines politische Absicht analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Hausarbeit sind Minne, höfische Liebe, Ehe, politische Hintergründe, Artusroman, Iwein, Laudine, Sühne, Hartmann von Aue.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2019, Die Minne und die Ehemotive von Laudine und Iwein im Artusroman "Iwein" von Hartmann von Aue, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998828