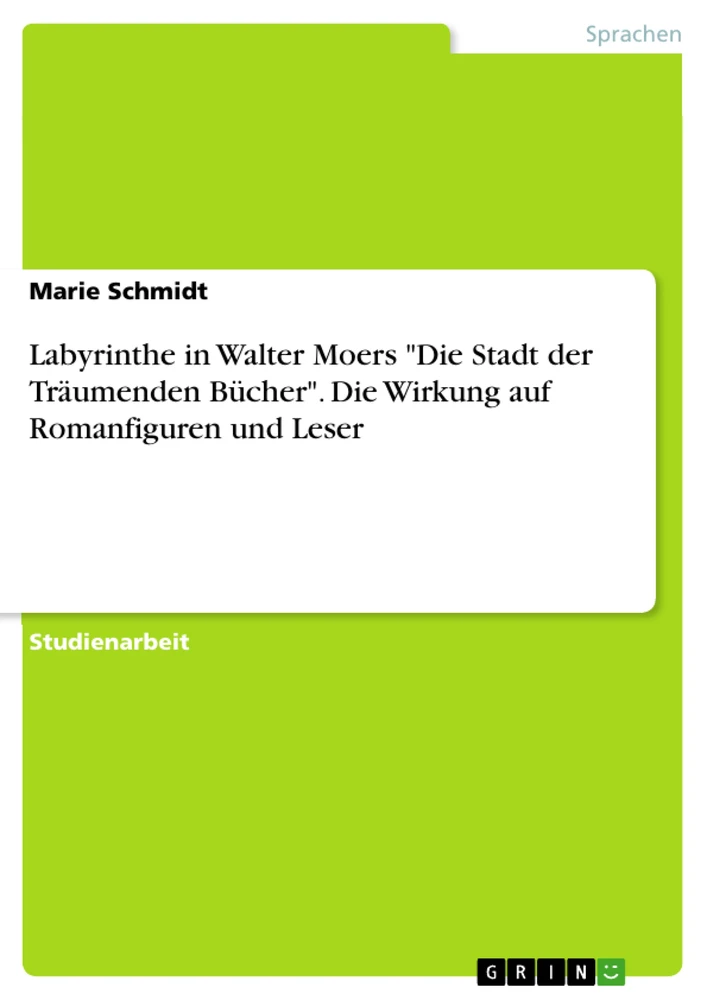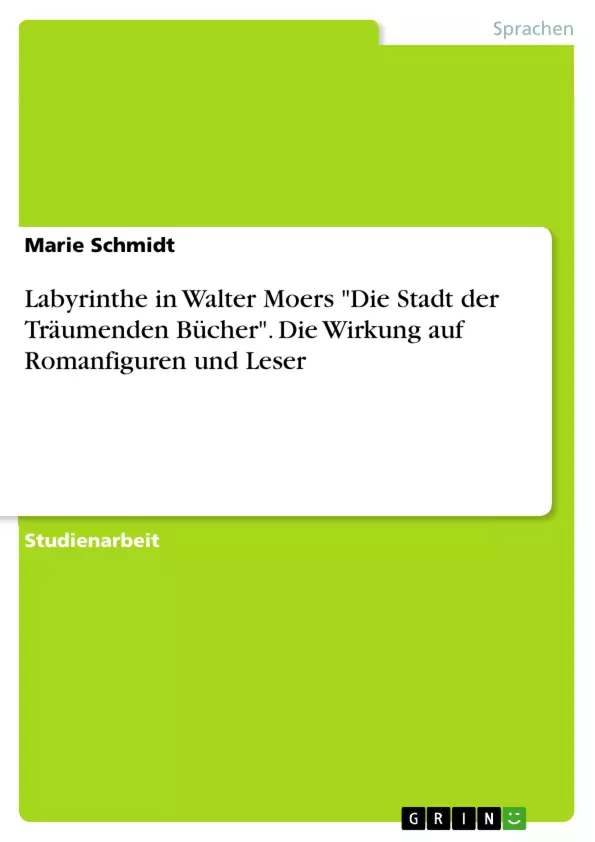In dieser Hausarbeit sollen die Labyrinthe im Roman "Die Stadt der Träumenden Bücher" von Walter Moers genauer betrachtet werden. Ziel dieser Hausarbeit ist es, aufzuführen auf welche Art und Weise Walter Moers Labyrinthe in seinen Roman integriert und welche Wirkungen sie auf Romanfigur und Leser haben.
Im ersten Teil der Arbeit soll auf das Labyrinth an sich eingegangen werden, wobei das Hauptaugenmerk auf für diese Hausarbeit relevanten Definitionen liegt. Nach den Definitionen von Umberto Eco, der zwischen Einweg-Labyrinth, Irrgarten und Rhizom unterscheidet und denen von Hennig, der zwischen Bibliothek-, Wüsten-, Höhlen-, und Stadtlabyrinthen differenziert, sollen Labyrinthe aus STB bewertet werden. Hier soll herausgearbeitet werden, dass ein Labyrinth nicht nur ein komplexes architektonisches Wegsystem ist, von dem es verschiedene Formen gibt, sondern auch ein teleologisches Denkmuster. Um eine Stagnation auszuschließen, weil diese meist Konsequenzen hat, müssen Entscheidungen getroffen werden, die dem Ziel folgen, das Labyrinth zu verlassen.
Die unterschiedlichen Labyrinthe werden auf die Definitionen angewendet. Hier wird schnell deutlich, dass ein Labyrinth zu mehreren Definitionen passt. Fokus liegt auch auf der Frage, wie das Labyrinth auf den Protagonisten und Leser wirkt.
Hauptthese ist dabei, dass die Darstellung der Labyrinthe so gewählt ist, dass sie beim Leser ein Gefühl der Verwirrung auslösen, was sich aber mit der Entwicklung der Geschichte und damit auch der Labyrinthe verändert.
Im weiteren Verlauf soll auf die Figuren im Labyrinth eingegangen werden. Aus welcher Position entdecken sie die Labyrinthe? In welcher Beziehung stehen sie zu ihm? Hierbei wird vor allem die Forschung von Schmitz-Emans, die die Perspektiven in Dädalus, Minotaurus und Theseus einteilt, berücksichtigt. Im Fazit soll zusammenfassend eine Antwort auf die Fragen gefunden werden, welche Labyrinthe Verwendung finden, wie sie dargestellt sind, in welcher Beziehung sie zu den Figuren stehen und welche Wirkung das auf den Leser hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Labyrinthe in „Die Stadt der Träumenden Bücher“
- Typen
- Einweg-Labyrinth
- Perspektiven auf die Labyrinthe
- Das Labyrinth als Ort des Erschaffens: die Dädalus- Perspektive
- Das Labyrinth als Gefängnis und Schutzraum: die Minotaurus-Perspektive
- Das Labyrinth als Ort der Erkenntnis: Die Theseus-Perspektive
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Verwendung von Labyrinthen in Walter Moers' Roman „Die Stadt der Träumenden Bücher“. Sie analysiert die Integration von Labyrinthen in die narrative Struktur, ihre Wirkung auf die Romanfiguren und die Rezeption beim Leser.
- Definitionen und Typologien von Labyrinthen
- Die Rolle von Labyrinthen als narrative Elemente in „Die Stadt der Träumenden Bücher“
- Perspektiven auf Labyrinthe: Dädalus, Minotaurus, Theseus
- Die Wirkung der Labyrinthe auf die Figuren und den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Labyrinthe in der Literatur ein und stellt die Zielsetzung der Hausarbeit vor. Kapitel 2 analysiert die verschiedenen Typen von Labyrinthen in „Die Stadt der Träumenden Bücher“, wobei der Fokus auf dem Einweg-Labyrinth liegt. Im Kapitel 3 werden verschiedene Perspektiven auf Labyrinthe untersucht, die durch die Figuren Dädalus, Minotaurus und Theseus repräsentiert werden.
Schlüsselwörter
Labyrinth, „Die Stadt der Träumenden Bücher“, Walter Moers, Einweg-Labyrinth, Minotaurus-Mythos, Dädalus, Minotaurus, Theseus, narrative Struktur, Leser-Rezeption
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielen Labyrinthe in Walter Moers' Roman?
In „Die Stadt der Träumenden Bücher“ sind Labyrinthe sowohl physische Orte (Katakomben) als auch Symbole für Erkenntnisprozesse und Gefahr.
Wie unterscheidet Umberto Eco Labyrinthe?
Eco differenziert zwischen dem Einweg-Labyrinth (klassisch), dem Irrgarten (mit Abzweigungen) und dem Rhizom (netzwerkartig ohne Zentrum).
Was ist die Minotaurus-Perspektive?
Sie beschreibt die Sichtweise einer Figur, die das Labyrinth als Gefängnis, aber gleichzeitig auch als geschützten Raum vor der Außenwelt wahrnimmt.
Welche Wirkung haben die Labyrinthe auf den Leser?
Die komplexe Darstellung soll beim Leser ein Gefühl der Verwirrung auslösen, das sich analog zur Entwicklung des Protagonisten verändert.
Was symbolisiert die Theseus-Perspektive?
Diese Perspektive steht für den Helden, der in das Labyrinth eindringt, um Prüfungen zu bestehen und durch gewonnene Erkenntnis gereift wieder herauszufinden.
- Quote paper
- Marie Schmidt (Author), 2020, Labyrinthe in Walter Moers "Die Stadt der Träumenden Bücher". Die Wirkung auf Romanfiguren und Leser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999165