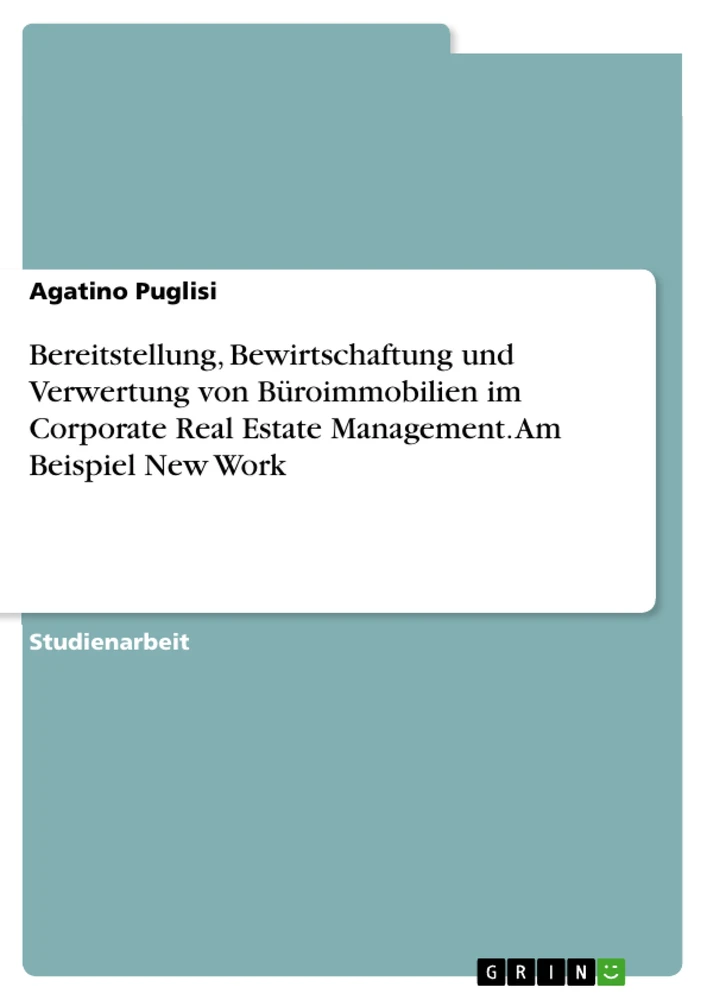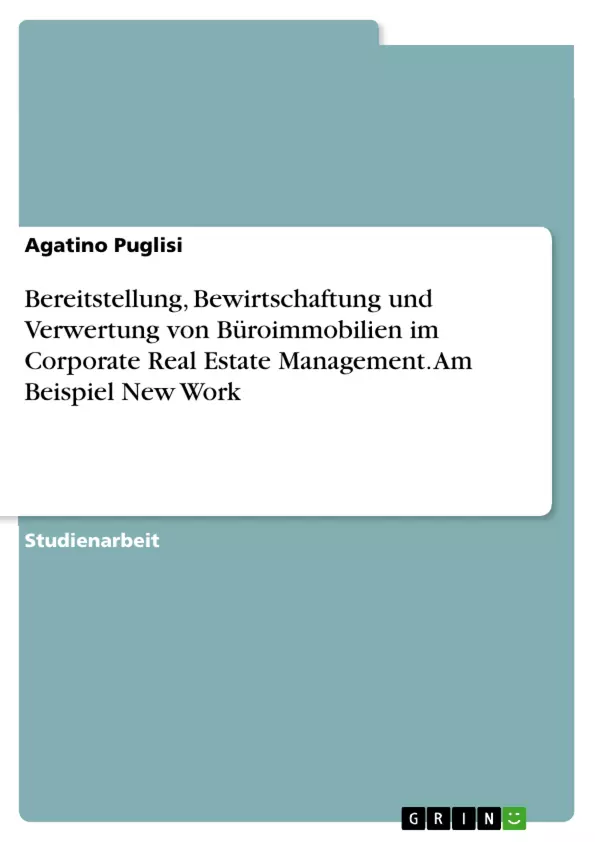Wenn die Angestellten zunehmend mit mobilem Arbeiten und Homeoffice ihrer Arbeit nachgehen, welche Bedeutung hat dann noch das klassische Büro als Arbeitsstätte? Wie entwickelt sich das Büro weiter, um den neuen Anforderungen des Neuen Arbeitens gerecht zu werden? Wie wirkt sich New Work auf den Bereich des CREM aus?
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Begriffe New Work und CREM vorzustellen und die Auswirkungen des New Work auf die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung von Büroimmobilien aufzuzeigen. Um einen Überblick über diese Auswirkungen von New Work auf das CREM zu erhalten, wurde einschlägige Fachliteratur zu beiden Themen gesucht und entsprechend ausgewertet. Zudem wurden Arbeitspapiere und Marktberichte von Unternehmen und Branchenverbände einbezogen.
Die Begriffe New Work, Arbeit 4.0 und Digitalisierung sind zurzeit Gegenstand vieler Beiträge und Diskussionen. Sie sollen beschreiben, wie die bereits allgegenwärtige, moderne Arbeitswelt ausschaut. Die mit diesen Begriffen einhergehenden Veränderungen sind von solch einer grundlegenden Bedeutung, dass teilweise von der "vierten industriellen Revolution" gesprochen wird. Mobiles Arbeiten und Homeoffice gelten als bekannteste neue Arbeitsformen des New Work für Wissensarbeit. Arbeiten scheint überall auf der Welt möglich zu sein. Auf Seite der Unternehmen ist der Bereich Corporate Real Estate Management (kurz CREM) für die Unternehmensimmobilien zuständig. Im Dienstleistungs- und Wissensbereich stellen diese Unternehmensimmobilien neben dem Personal eines der wichtigsten Posten im Unternehmen dar. Die Immobilie dient als Ort der Leistungserstellung im Kerngeschäft. Eines der Hauptziele des Immobilienbereichs im Unternehmen ist die Befriedigung der unternehmenseigenen Nutzerbedürfnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- New Work
- Begriffsherkunft und Definition von New Work
- Historische Einordnung von New Work.
- Flexibilisierung der Arbeit.
- Dimension Zeit..
- Dimension Ort..
- Dimension Struktur.
- Globalisierung.
- Digitalisierung..
- Corporate Real Estate Management.
- Definition
- Management-Ebenen im CREM
- Portfoliomanagement.
- Asset Management.
- Property Management.
- Facility Management..
- CREM im Lebenszyklusmodell.
- Bedeutung für Unternehmen.
- Auswirkungen von New Work auf das CREM.
- Bereitstellung von Büroimmobilien.
- Bereitstellungsformen.
- Projektentwicklung.....
- Kauf einer Immobilie
- Immobilien-Leasing
- Miete
- Flexible Workspace....
- Bereitstellung im Sinne des New Work
- Bewirtschaftung von Büroimmobilien.
- Flächenmanagement...
- Büroflächen.
- Einzelbüros....
- Mehrpersonenbüros.
- Großraumbüros
- Desk Sharing...
- Open Space Office
- Homeoffice und alternierende Telearbeit..
- Flächenmanagement im New Work.
- Verwertung von Büroimmobilien
- Verkauf und Vermietung.
- Flexible Office Betreiberkonzepte
- Redevelopment und Abriss
- Verwertung im New Work-Kontext.
- Bereitstellung von Büroimmobilien.
- Erste Auswirkungen der Corona-Pandemie
- Digitalisierungsschub......
- Homeoffice und mobiles Arbeiten.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung von Büroimmobilien im Corporate Real Estate Management (CREM) im Kontext von New Work. Ziel ist es, die Auswirkungen von New Work auf das CREM zu analysieren und die Herausforderungen und Chancen für Unternehmen aufzuzeigen.
- Die Entwicklung des New Work Konzepts
- Die Bedeutung des CREM für Unternehmen
- Die Auswirkungen von New Work auf die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung von Büroimmobilien
- Die Bedeutung von Flexibilität und Digitalisierung im CREM
- Die Rolle von Homeoffice und mobiles Arbeiten im New Work Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel "Einleitung" führt in das Thema der Seminararbeit ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des New Work.
- Das Kapitel "New Work" definiert den Begriff New Work und beleuchtet seine historische Entwicklung, insbesondere im Hinblick auf die Flexibilisierung der Arbeit. Die Dimensionen Zeit, Ort und Struktur sowie die Auswirkungen von Globalisierung und Digitalisierung auf das Konzept werden besprochen.
- Das Kapitel "Corporate Real Estate Management" beschäftigt sich mit der Definition des CREM und seinen verschiedenen Managementebenen. Es werden die Bereiche Portfoliomanagement, Asset Management, Property Management und Facility Management detailliert beschrieben. Zudem wird die Bedeutung des CREM im Lebenszyklusmodell von Immobilien und für Unternehmen erläutert.
- Das Kapitel "Auswirkungen von New Work auf das CREM" analysiert die Auswirkungen von New Work auf die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung von Büroimmobilien. Es werden verschiedene Bereitstellungsformen im Sinne von New Work, wie Projektentwicklung, Kauf, Leasing, Miete und Flexible Workspace, betrachtet. Die Bewirtschaftung von Büroimmobilien im New Work-Kontext wird anhand von unterschiedlichen Bürokonzepten wie Einzelbüros, Mehrpersonenbüros, Großraumbüros, Desk Sharing und Open Space Office beleuchtet. Zudem wird die Verwertung von Büroimmobilien im Kontext von New Work im Hinblick auf Verkauf, Vermietung und flexible Office Betreiberkonzepte betrachtet.
- Das Kapitel "Erste Auswirkungen der Corona-Pandemie" analysiert die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den CREM. Insbesondere der Digitalisierungsschub und die verstärkte Nutzung von Homeoffice und mobiles Arbeiten werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit konzentriert sich auf die Themen New Work, Corporate Real Estate Management (CREM), Büroimmobilien, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Verwertung, Flexibilität, Digitalisierung, Homeoffice, Mobiles Arbeiten, Corona-Pandemie.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „New Work“ für die moderne Arbeitswelt?
New Work beschreibt den Wandel hin zu flexibleren Arbeitsformen, geprägt durch Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Homeoffice und flache Hierarchien.
Was ist Corporate Real Estate Management (CREM)?
CREM ist die strategische Verwaltung und Optimierung der Immobilien eines Unternehmens, die nicht zum Kerngeschäft gehören, aber die Leistungserstellung unterstützen.
Wie verändert Homeoffice den Bedarf an Büroflächen?
Durch zunehmendes Homeoffice sinkt der Bedarf an festen Einzelarbeitsplätzen; stattdessen werden flexible Konzepte wie Desk Sharing und Gemeinschaftsflächen wichtiger.
Was ist „Desk Sharing“?
Beim Desk Sharing haben Mitarbeiter keinen fest zugewiesenen Schreibtisch mehr, sondern wählen täglich einen freien Platz, was die Flächeneffizienz steigert.
Welchen Einfluss hatte die Corona-Pandemie auf das CREM?
Die Pandemie wirkte als Digitalisierungsschub und etablierte mobiles Arbeiten dauerhaft, was viele Unternehmen dazu zwang, ihre Immobilienstrategien radikal zu überdenken.
- Arbeit zitieren
- Agatino Puglisi (Autor:in), 2020, Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwertung von Büroimmobilien im Corporate Real Estate Management. Am Beispiel New Work, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/999168