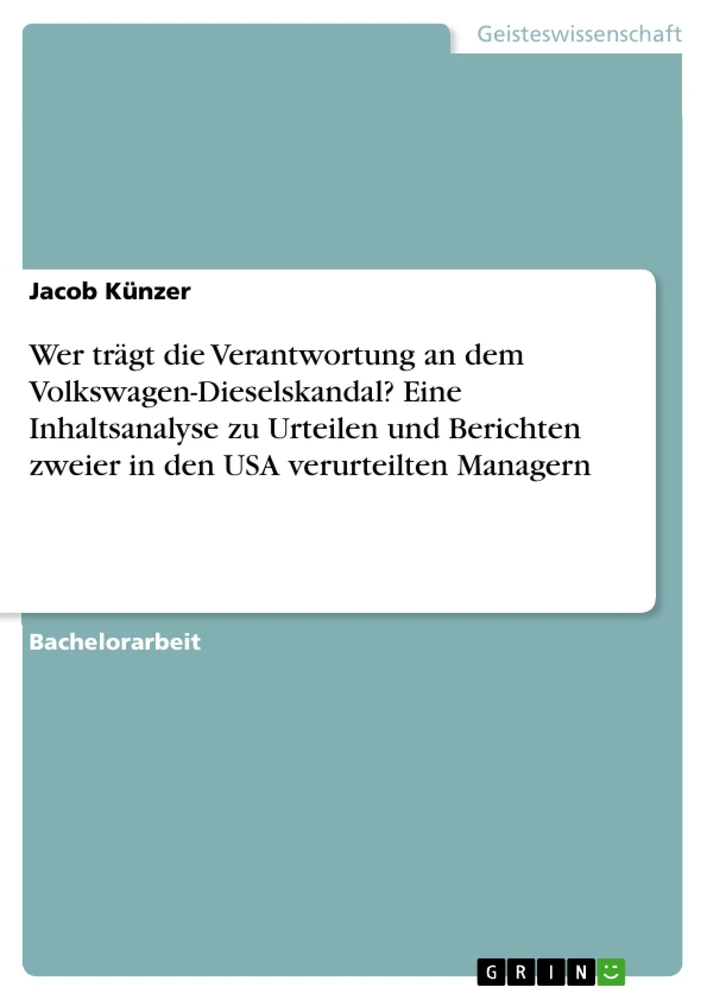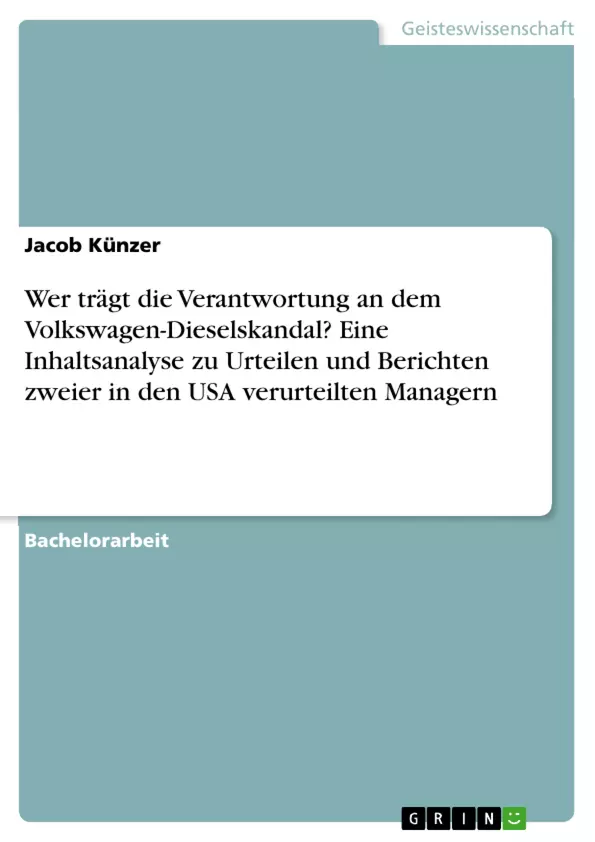Der erste Teil der Arbeit nähert sich dieser Thematik und beschreibt, dass viele solcher Erwartungen aus Institutionen heraus entstehen. Organisationen sind eingebettet in eine Umwelt, die hinsichtlich des Bestehenbleibens von großer Bedeutung ist. Doch für das menschliche Zusammenleben ist es nicht untypisch, dass nicht immer alle Regelungen strikt hingenommen werden. Im Gegenteil: Insbesondere bei Interessenskonflikten kann der Egoismus überwiegen. Organisationen sind soziale Systeme, die auf mehreren Individuen basieren. Dies führt nicht zuletzt dazu, dass bei größeren Organisationen den Handlungsstrukturen eine gewisse Komplexität unterstellt werden kann. Der Neo-Institutionalimus knüpft an dieser Stelle an, indem Strukturen einer Organisation erläutert werden.
Die Rational-Choice Theorie ist hingegen die passende Ergänzung zu den makroperspektivischen Überlegungen, da hier auf die individuelle Entscheidungsfindung eingegangen wird. Einen besonderen Einfluss auf diese Arbeit hatten die theoretischen Überlegungen von Coleman in seinem 1986 erschienenen Werk "Die asymmetrische Gesellschaft". Nicht nur, dass Beziehungen zwischen Individuen und Organisationen darstellt werden, entsteht auch eine Neugierde, wie die Gesellschaft die Rahmenbedingungen und Folgen dieser bewertet. Der Volkswagen Skandal mit seinen Urteilen auf organisationaler und individueller Ebene ist insofern interessant, als das der Schuldfrage nachgegangen werden kann. Nicht im Sinne von moralisch "richtig" oder "falsch", sondern wie das gesellschaftliche Verständnis einer angemessenen Strafverfolgung Wirkung auf die Urteilsfindung ausübt.
Der zweite Teil dieser Arbeit behandelt zum einen die gerichtlichen Dokumente der zwei verurteilten Manager und zum anderen die mediale Berichterstattung zu eben diesen Verurteilungen und Anklagen. Ziel ist es, mittels einer Inhaltsanalyse auf die soziale Wirklichkeit zu schließen, in welcher die Verantwortlichkeit und Haftbarkeit im Zentrum steht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Neo-Insitutionalismus
- 2.1 Institutionen
- 2.2 Strukturen von Organisationen
- 3. Interaktionen mit Organisationen
- 3.1 Asymmetrische Beziehungen
- 3.2 Die Rational-Choice-Theorie
- 4. Organisationsskandale
- 4.1 Der Volkswagen Dieselskandal – ein Überblick
- 4.2 Der Ford Pinto Skandal
- 4.3 Vorstandshaftung
- 5. Inhaltsanalyse
- 5.1 Methodisches Vorgehen
- 5.2 Analyseteil 1 - Verurteilungen
- 5.3 Auswertung Analyseteil 1
- 5.4 Analyseteil 2 – Mediendarstellung
- 5.5 Auswertung Analyseteil 2
- 5.6 Ergebnisse
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Verantwortlichkeiten im Volkswagen-Dieselskandal, indem sie Gerichtsurteile und Medienberichte analysiert. Ziel ist es, die Zuweisung von Schuld auf organisationaler und individueller Ebene zu beleuchten und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Urteilsfindung zu erforschen.
- Neo-Institutionalismus und seine Relevanz für organisationales Handeln
- Asymmetrische Beziehungen zwischen Organisationen und Individuen
- Analyse der Gerichtsurteile gegen Volkswagen-Manager
- Medienberichterstattung und öffentliche Wahrnehmung des Skandals
- Verantwortung und Haftung im Kontext von Organisationsskandalen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Volkswagen-Dieselskandals ein und stellt die Forschungsfrage nach der Verantwortungszuweisung im Zentrum. Sie beleuchtet die Problematik der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Organisationen und die Notwendigkeit, individuelle Akteure zur Rechenschaft zu ziehen. Der Skandal wird als Beispiel für die komplexen Herausforderungen der Verantwortungsfindung in global agierenden Unternehmen vorgestellt. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die methodische Vorgehensweise, wobei die Anwendung des Neo-Institutionalismus und der Rational-Choice-Theorie angekündigt wird. Der Fokus liegt auf der Analyse von Gerichtsurteilen und Medienberichten um die soziale Konstruktion von Schuld und Verantwortung zu untersuchen.
2. Der Neo-Insitutionalismus: Dieses Kapitel erläutert die neo-institutionalistische Organisationstheorie und ihre Bedeutung für das Verständnis organisationalen Handelns. Es beschreibt die Entstehung von Institutionen nach Berger und Luckmann und deren Einfluss auf Organisationen. Die Rolle von Habitualisierungsprozessen und die Herausforderungen für Organisationen, gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden, werden diskutiert. Die Kapitel legt den theoretischen Grundstein für die Analyse, indem es die Einbettung von Organisationen in ein institutionelles Umfeld beschreibt, das ihr Handeln prägt und beeinflusst. Schlüsselkonzepte wie die "gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" werden eingeführt und für die spätere Analyse vorbereitet.
3. Interaktionen mit Organisationen: Dieses Kapitel untersucht die Interaktionen zwischen Organisationen und Individuen, insbesondere im Kontext asymmetrischer Beziehungen. Es führt die Rational-Choice-Theorie ein und erläutert wie individuelle Entscheidungen in Organisationen getroffen werden. Die Analyse der Interaktionen zwischen Individuen und Organisationen bildet eine Brücke zwischen den makroperspektivischen Überlegungen des Neo-Institutionalismus und den mikroperspektivischen Aspekten der individuellen Entscheidungsfindung. Die Bedeutung von Interessenskonflikten und der Einfluss von Egoismus auf das Handeln werden diskutiert. Dieses Kapitel bereitet den Boden für die Analyse der individuellen Handlungen im Volkswagen-Skandal.
4. Organisationsskandale: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Organisationsskandale, mit einem Fokus auf den Volkswagen-Dieselskandal und den Ford Pinto Skandal als Vergleichsbeispiel. Es beleuchtet die verschiedenen Aspekte dieser Skandale und führt den Begriff der Vorstandshaftung ein. Durch die Gegenüberstellung unterschiedlicher Skandale werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich des Auftretens, der Reaktion der Unternehmen und der juristischen Folgen aufgezeigt. Das Kapitel dient als Kontextualisierung für die anschließende Analyse des Volkswagen-Dieselskandals und stellt dessen Relevanz im größeren Kontext von Organisationsskandalen heraus.
5. Inhaltsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Inhaltsanalyse, die sowohl die Gerichtsdokumente der verurteilten Manager als auch die Medienberichterstattung umfasst. Es wird detailliert auf die Analysemethoden eingegangen und die beiden Analyseabschnitte (Verurteilungen und Mediendarstellung) werden eingeführt. Die Kapitel erklärt die gewählten Methoden der Datenanalyse und die Kriterien für die Auswahl und Auswertung der Daten. Es begründet die Wahl der Methode und ihre Eignung für die Beantwortung der Forschungsfrage.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Verantwortlichkeiten im Volkswagen-Dieselskandal
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Verantwortlichkeiten im Volkswagen-Dieselskandal. Sie analysiert Gerichtsurteile und Medienberichte, um die Zuweisung von Schuld auf organisationaler und individueller Ebene zu beleuchten und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Urteilsfindung zu erforschen.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit verwendet den Neo-Institutionalismus und die Rational-Choice-Theorie, um organisationales Handeln und individuelle Entscheidungen im Kontext des Skandals zu analysieren. Der Neo-Institutionalismus erklärt den Einfluss von Institutionen und gesellschaftlichen Erwartungen auf Organisationen, während die Rational-Choice-Theorie individuelle Entscheidungen im Lichte von Interessen und Nutzenmaximierung betrachtet.
Welche Daten werden analysiert?
Die Analyse basiert auf Gerichtsurteilen gegen Volkswagen-Manager und der Medienberichterstattung über den Skandal. Es wird eine Inhaltsanalyse durchgeführt, um die Darstellung von Schuld und Verantwortung in beiden Datenquellen zu untersuchen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Neo-Institutionalismus, Interaktionen mit Organisationen, Organisationsskandale, Inhaltsanalyse und Fazit. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise vor. Die Kapitel 2 und 3 liefern die theoretischen Grundlagen. Kapitel 4 bietet einen Überblick über Organisationsskandale. Kapitel 5 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Inhaltsanalyse und präsentiert die Ergebnisse. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert deren Bedeutung.
Welche konkreten Aspekte des Volkswagen-Dieselskandals werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Gerichtsurteile gegen Volkswagen-Manager im Detail, analysiert die Medienberichterstattung und beleuchtet die Frage der Vorstandshaftung. Der Ford Pinto Skandal dient als Vergleichsbeispiel.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie wird Schuld im Volkswagen-Dieselskandal auf organisationaler und individueller Ebene zugewiesen, und wie beeinflussen gesellschaftliche Faktoren die Urteilsfindung?
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Inhaltsanalyse, um sowohl die Gerichtsdokumente als auch die Medienberichte auszuwerten. Die Methode wird detailliert in Kapitel 5 beschrieben.
Welche Ergebnisse werden erwartet?
Die Arbeit erwartet Erkenntnisse über die Zuweisung von Schuld und Verantwortung im Volkswagen-Dieselskandal, die Rolle gesellschaftlicher Faktoren bei der Urteilsfindung und die Grenzen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Organisationen.
Welche Schlüsselkonzepte werden verwendet?
Schlüsselkonzepte umfassen Neo-Institutionalismus, Rational-Choice-Theorie, asymmetrische Beziehungen, Vorstandshaftung, gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Habitualisierung und Inhaltsanalyse.
- Citar trabajo
- Jacob Künzer (Autor), 2020, Wer trägt die Verantwortung an dem Volkswagen-Dieselskandal? Eine Inhaltsanalyse zu Urteilen und Berichten zweier in den USA verurteilten Managern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1000903