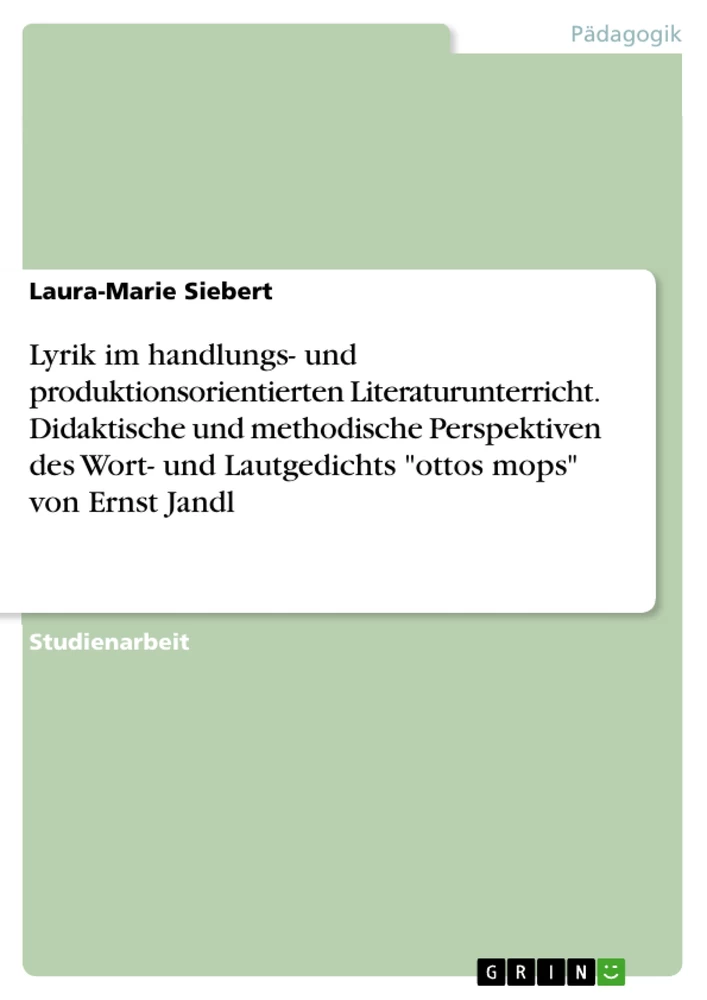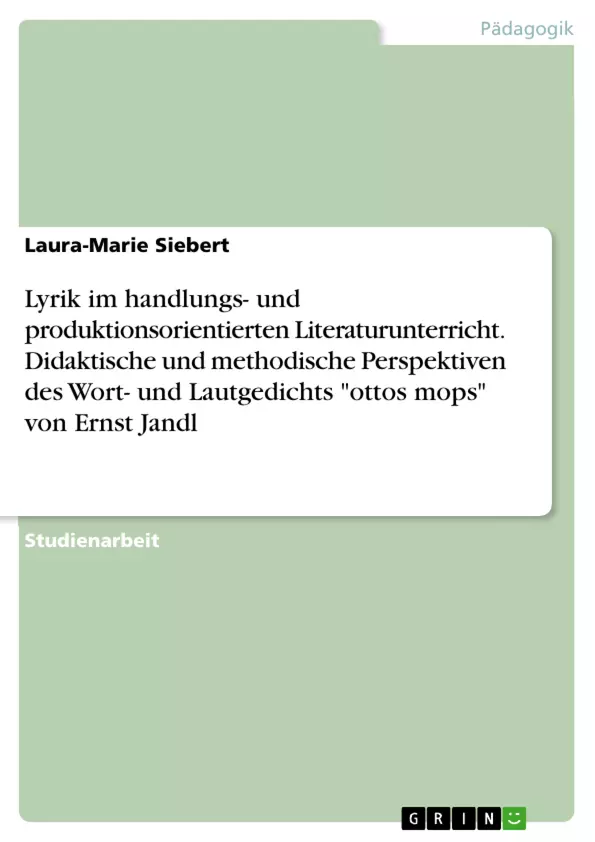In dieser Hausarbeit soll der Umgang mit Lyrik im Grundschulunterricht genauer betrachtet werden. Anhand des Wort- und Lautgedichts ottos mops [1963] von Ernst Jandl wird dabei die Frage beantwortet, wie sich der handlungs- und produktionsorientierte Ansatz speziell im Literaturunterricht der Grundschule umsetzen lässt, wobei auch die Anschlussfähigkeit an den inklusiven Unterricht berücksichtigt wird. Zu Beginn der Arbeit wird der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht einer Begriffsklärung unterzogen und in seiner Funktion und Zielsetzung besprochen und anschließend mit dem Schwerpunkt der Lyrik vertiefend beleuchtet. Am Beispiel des Wort- und Lautgedichts ottos mops von Ernst Jandl, das zunächst im Hinblick auf grundschulrelevante, didaktische Aspekte und Perspektiven analysiert wird, werden anschließend Umsetzungsmöglichkeiten im Literaturunterricht der Klassen 3 und 4 aufgezeigt. Im Abschluss der Arbeit werden die Ergebnisse nochmals zusammenfassend dargestellt und reflektiert.
"Es ist kaum noch möglich, über Gedichte im Unterricht zu sprechen, ohne dass man in die durch die Tradition belasteten Begriffe tritt wie in zähflüssigen Honig". Dieser Beschreibung ähnelt sicherlich auch der Literaturunterricht, an den so manche*r mit Schaudern zurückdenkt. Insbesondere wenn es um jene langwierigen und kleinschrittigen Gedichtinterpretationen ging, die die Schulstunden wie eben jenen zähflüssigen Honig haben vorbeigehen lassen. Doch der Umgang mit Gedichten in der Schule muss nicht quälend oder gar angsteinflößend sein. Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht zielt auf eine kreative, mit allen Sinnen erfolgende Herangehensweise ab, die den Tätigkeitsdrang und die Fantasie der Schüler*innen nutzt, um sich einem literarischen Text zu nähern und ihn zu durchdringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht
- Definition
- Lehrplanbezug
- Kritik
- Lyrik im Unterricht der Grundschule
- Definition
- Lehrplanbezug
- Didaktisches Phasenmodell
- Didaktische Perspektiven von Ernst Jandls ottos mops
- Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Umsetzung von handlungs- und produktionsorientiertem Literaturunterricht im Kontext der Grundschule. Konkret wird untersucht, wie sich der Ansatz am Beispiel von Ernst Jandls Wort- und Lautgedicht "ottos mops" realisieren lässt. Dabei stehen die didaktischen Möglichkeiten und die Einbindung in den inklusiven Unterricht im Vordergrund.
- Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht als Grundlage für einen kreativen und sinnlichen Umgang mit literarischen Texten
- Analyse und didaktische Relevanz von Jandls "ottos mops" im Kontext der Grundschule
- Umsetzungsmöglichkeiten von handlungs- und produktionsorientiertem Unterricht anhand des Gedichts "ottos mops"
- Bedeutung der Inklusion im handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht
- Zusammenfassende Darstellung und Reflexion der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts und beleuchtet dessen Bedeutung im Kontext des offenen und schüler*innenzentrierten Unterrichts. Anschließend wird der Ansatz im Hinblick auf den Lehrplan und mögliche Kritikpunkte untersucht. Kapitel 3 widmet sich der Lyrik im Grundschulunterricht und beleuchtet deren Definition und Bedeutung für den Unterricht. Im vierten Kapitel wird Jandls "ottos mops" im Hinblick auf didaktische Perspektiven analysiert. Schließlich werden im fünften Kapitel Umsetzungsmöglichkeiten des handlungs- und produktionsorientierten Ansatzes im Unterricht anhand des Gedichts "ottos mops" vorgestellt.
Schlüsselwörter
Handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht, Lyrik, Ernst Jandl, ottos mops, Grundschule, Inklusion, didaktische Perspektiven, Umsetzungsmöglichkeiten, Analyse, Klang, Sprache, Spiel, Kreativität, Fantasie
Häufig gestellte Fragen
Was ist handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht?
Es ist ein Ansatz, bei dem Schüler aktiv und kreativ mit Texten umgehen (z. B. durch Umschreiben oder Vertonen), anstatt sie nur passiv zu analysieren.
Warum eignet sich Ernst Jandls "ottos mops" besonders für die Grundschule?
Das Gedicht ist ein Lautgedicht, das nur den Vokal 'o' nutzt. Sein spielerischer Umgang mit Klang und Sprache motiviert Kinder zum eigenen Ausprobieren.
Wie fördert dieser Ansatz die Inklusion?
Durch den sinnlichen und spielerischen Zugang können Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam an einem literarischen Gegenstand arbeiten.
Welche didaktischen Phasen gibt es beim Umgang mit Lyrik?
Meist folgt der Unterricht einem Modell von der ersten Begegnung über die vertiefende Textarbeit bis hin zur eigenen Produktion oder Präsentation.
Was ist das Ziel des kreativen Umgangs mit Gedichten?
Das Ziel ist es, Schwellenängste vor Lyrik abzubauen und die Fantasie sowie die Sprachkompetenz der Schüler nachhaltig zu stärken.
- Citation du texte
- Laura-Marie Siebert (Auteur), 2020, Lyrik im handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterricht. Didaktische und methodische Perspektiven des Wort- und Lautgedichts "ottos mops" von Ernst Jandl, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1005510