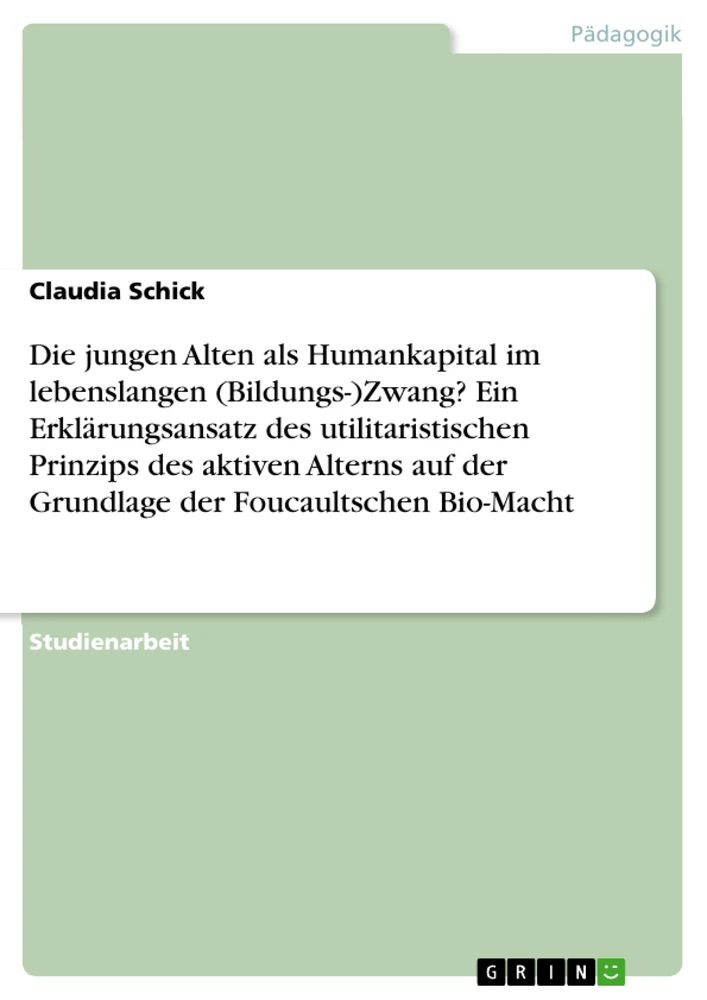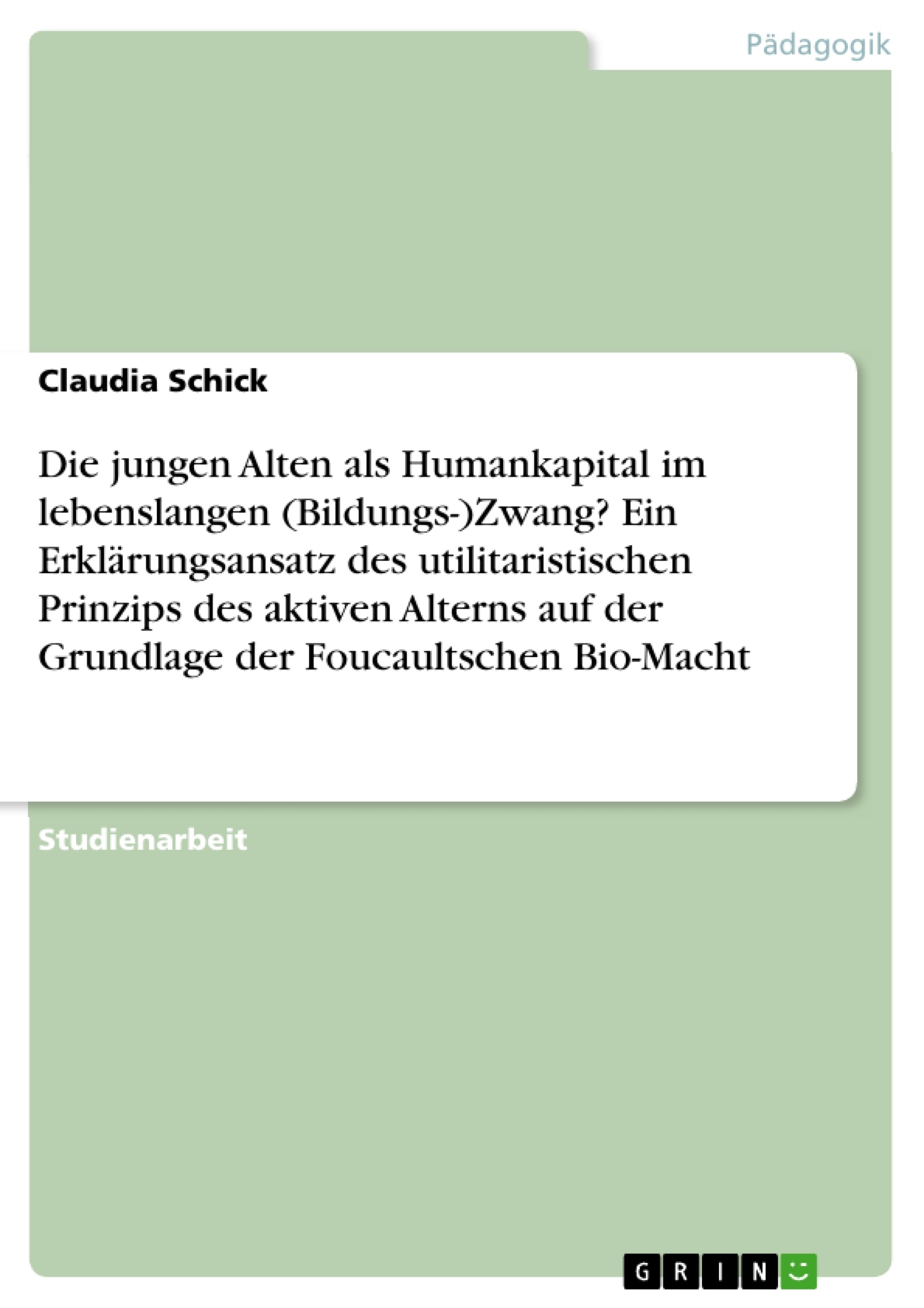Wenn durch den Eintritt in den Ruhestand eine Entkoppelung des Menschen von seiner Arbeitskraft und ein niedrigerer Nutzen für die kapitalistischen Verhältnisse entsteht, was heißt es dann für die Älteren, produktiv zu sein?
Dass das Alter als eine eigenständige Lebensphase anerkannt wird und nicht ein (unerwünschtes) Resultat des Erwachsenenalters ist, kann als ein junges Phänomen betrachtet werden. Dem Bedeutungswandel, dem das Alter unterliegt, hat sich vom negativ konnotierten gesellschaftlichen Faktor, zu einer ‚heimliche(n) Ressource‘ im Kontext der Bewältigung der mit dem demografischen Wandel einhergehenden Probleme gewandelt. Doch ist es wirklich geheim, wenn so offensiv in Veröffentlichungen, wie zum Beispiel in den Altenberichten des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend [BMFSFJ] von einer gesellschaftliche(n) Produktivität Älterer, ‚ungenutzte(n)‘ Potentialen oder uneingeschränkt davon gesprochen wird, dass Ältere ihren Beitrag zu leisten haben, um mit den vorliegenden Hürden, die im demografischen Wandel (und dessen Folgen) begründet liegen, adäquat umgehen zu können?
Inhaltsverzeichnis
- Der Wohlfahrtsstaat zwischen Altruismus und Egoismus – Die Alten als ungenutztes Potenzial
- Die Identitätskategorie des Alters – Eine Bestandsaufnahme der Position (junger) Alter in der Gesellschaft
- Eine erste Annäherung an das Konstrukt des Alters
- Die Etikettierung des produktiven Alter(n)s – Die jungen Alten zwischen jung bleiben und alt werden
- (Bio-)Macht als eine konstitutive Grundkategorie des menschlichen Lebens – Ein Abriss des Foucaultschen Machtverständnisses auf der Grundlage disziplinierender und regulierender Mechanismen
- Die Disziplinarmacht – Der gelehrige und fügsame Körper als eine Basis für die Potenzialentfaltung
- Die Ambivalenz zwischen aktiver Überwachung und passivem Überwachtwerden – Das panoptische Prinzip als zentraler Mechanismus effizienter Optimierung
- Vom Individuum zur Bevölkerung – Die Bio-Macht zwischen disziplinierenden und regulierenden Mechanismen als Grundlage der Normalisierungsgesellschaft
- Aktives Altern als machtimmanenter Diskurs? Eine Betrachtung alterspolitischer Inhalte aus einer machttheoretischen Perspektive
- Vom Fremdzwang zum Selbstzwang – Das panoptische Prinzip im Kontext gesundheitspolitischer Maßnahmen
- Zwischen Freiheit und Zwang – Regulierende Mechanismen zur Steigerung der gesellschaftlichen Teilhabe
- (Aus-)Bildung zum Humankapital – Optimierungszwang durch lebenslange Anpassung als das neue Bildungsverständnis?
- Macht als ein unüberwindbarer Teil der Gesellschaft? – Abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Konzept des aktiven Alterns und beleuchtet dessen Entstehung im Kontext des demografischen Wandels. Ziel ist es, die Machtdynamiken hinter diesem Konzept zu analysieren, insbesondere die Rolle der Bio-Macht im Sinne Michel Foucaults, und aufzuzeigen, wie die Kategorie der "jungen Alten" als produktive Ressource für den Wohlfahrtsstaat konstruiert wird.
- Die Konstruktion der Kategorie "jungen Alten" im Kontext des demografischen Wandels und der politischen Alterspolitik
- Die Rolle der Bio-Macht und disziplinierender Techniken im Rahmen des aktiven Alterns
- Der Einfluss von Gesundheitspolitik, Engagementförderung und Bildung auf die "produktive" Einbindung der jungen Alten in die Gesellschaft
- Die Kritik an der instrumentalisierenden Nutzung von Bildung und des Lebenslangen Lernens im Sinne eines "Humankapitals"
- Die Auswirkungen der Normalisierungsgesellschaft und der selbstoptimierenden Lebensführung auf die individuelle Autonomie und die gesellschaftliche Teilhabe
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieser Abschnitt beleuchtet den Wandel des Wohlfahrtsstaates, in dem die Alten zunehmend als ungenutztes Potenzial betrachtet werden. Der demografische Wandel und seine Folgen für die Gesellschaft werden dabei als zentrale Triebkräfte für die Entstehung des aktiven Alterns-Konzeptes dargestellt.
- Kapitel 2: Hier wird die Kategorie des Alters als eine gesellschaftliche Konstruktion und Identitätskategorie analysiert. Es wird beleuchtet, wie das Alter in den letzten Jahrhunderten und im Kontext der modernen Gesellschaften definiert wurde. Besonderer Fokus liegt auf der Entstehung des "jungen Alten" als eine "produktive" Gruppe, die in die Gesellschaft integriert werden soll.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel stellt Michel Foucaults Machtverständnis auf der Grundlage seiner Werke "Überwachen und Strafen" und "Der Wille zum Wissen" dar. Die Disziplinarmacht und die Bio-Macht werden als zentrale Mechanismen zur Regulierung des menschlichen Lebens und zur "Fabrikation zuverlässiger Menschen" beschrieben.
- Kapitel 4: Im Kontext des aktiven Alterns wird analysiert, wie die Disziplinarmacht und die Bio-Macht eingesetzt werden, um die jungen Alten in die Gesellschaft einzubinden. Gesundheitspolitische Maßnahmen, Engagementförderung und das Konzept des lebenslangen Lernens werden als Beispiele für "regulierende" Mechanismen dargestellt, die auf ökonomische Nützlichkeit und Produktivität abzielen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept des aktiven Alterns im Kontext der Bio-Macht, dem demografischen Wandel, der Normalisierungsgesellschaft und dem Lebenslangen Lernen. Zentrale Begriffe sind Disziplinarmacht, Bio-Politik, Produktivität, Humankapital, "jungen Alten", gesellschaftliche Teilhabe, Intersektionalität und die Kritik an der instrumentalisierenden Nutzung von Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Aktives Altern“ im Sinne der Bio-Macht?
Es beschreibt ein politisches Konzept, das ältere Menschen als produktive Ressource (Humankapital) betrachtet und sie durch Selbstoptimierung und lebenslanges Lernen in den kapitalistischen Verwertungsprozess einbindet.
Wie definiert Foucault die Bio-Macht?
Bio-Macht umfasst Mechanismen zur Disziplinierung des Einzelkörpers und zur Regulierung der Bevölkerung, um das Leben effizient für ökonomische Zwecke nutzbar zu machen.
Wer sind die „jungen Alten“?
Dies ist eine konstruierte Identitätskategorie für Menschen im frühen Ruhestand, die als „heimliche Ressource“ zur Bewältigung des demografischen Wandels mobilisiert werden sollen.
Was ist das panoptische Prinzip im Kontext des Alterns?
Es beschreibt einen Mechanismus, bei dem der äußere Zwang (z.B. durch Gesundheitspolitik) in einen Selbstzwang zur ständigen Optimierung und Überwachung des eigenen Verhaltens übergeht.
Wird lebenslanges Lernen hier kritisch gesehen?
Ja, die Arbeit kritisiert die instrumentalisierende Nutzung von Bildung, die weniger der persönlichen Entfaltung als vielmehr der ständigen Anpassung an ökonomische Bedürfnisse dient.
- Quote paper
- Claudia Schick (Author), 2019, Die jungen Alten als Humankapital im lebenslangen (Bildungs-)Zwang? Ein Erklärungsansatz des utilitaristischen Prinzips des aktiven Alterns auf der Grundlage der Foucaultschen Bio-Macht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1006037