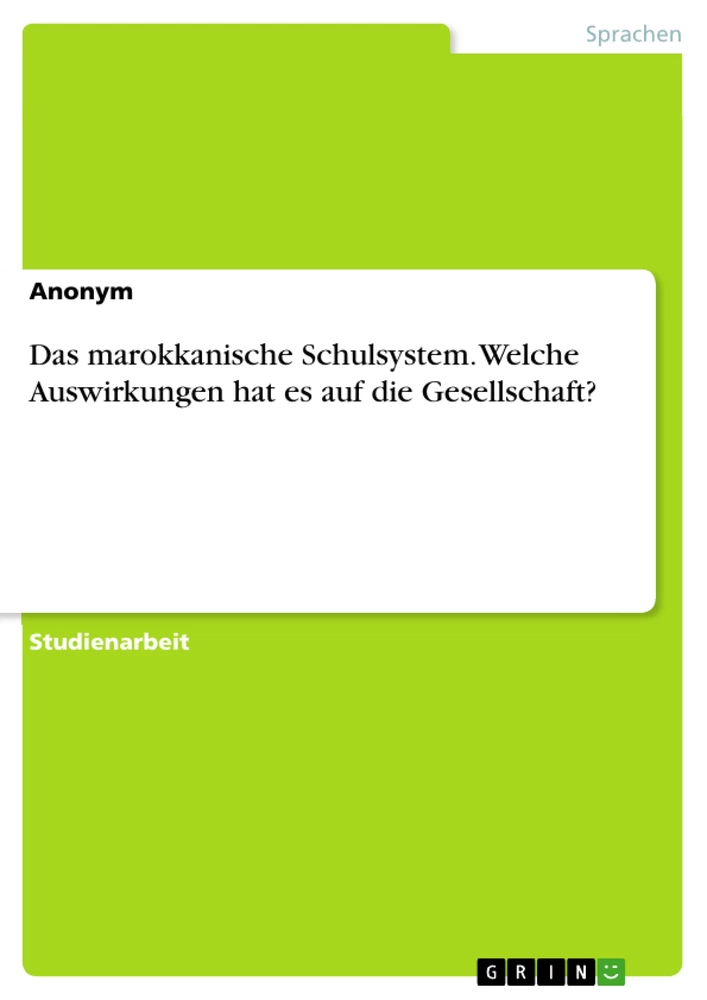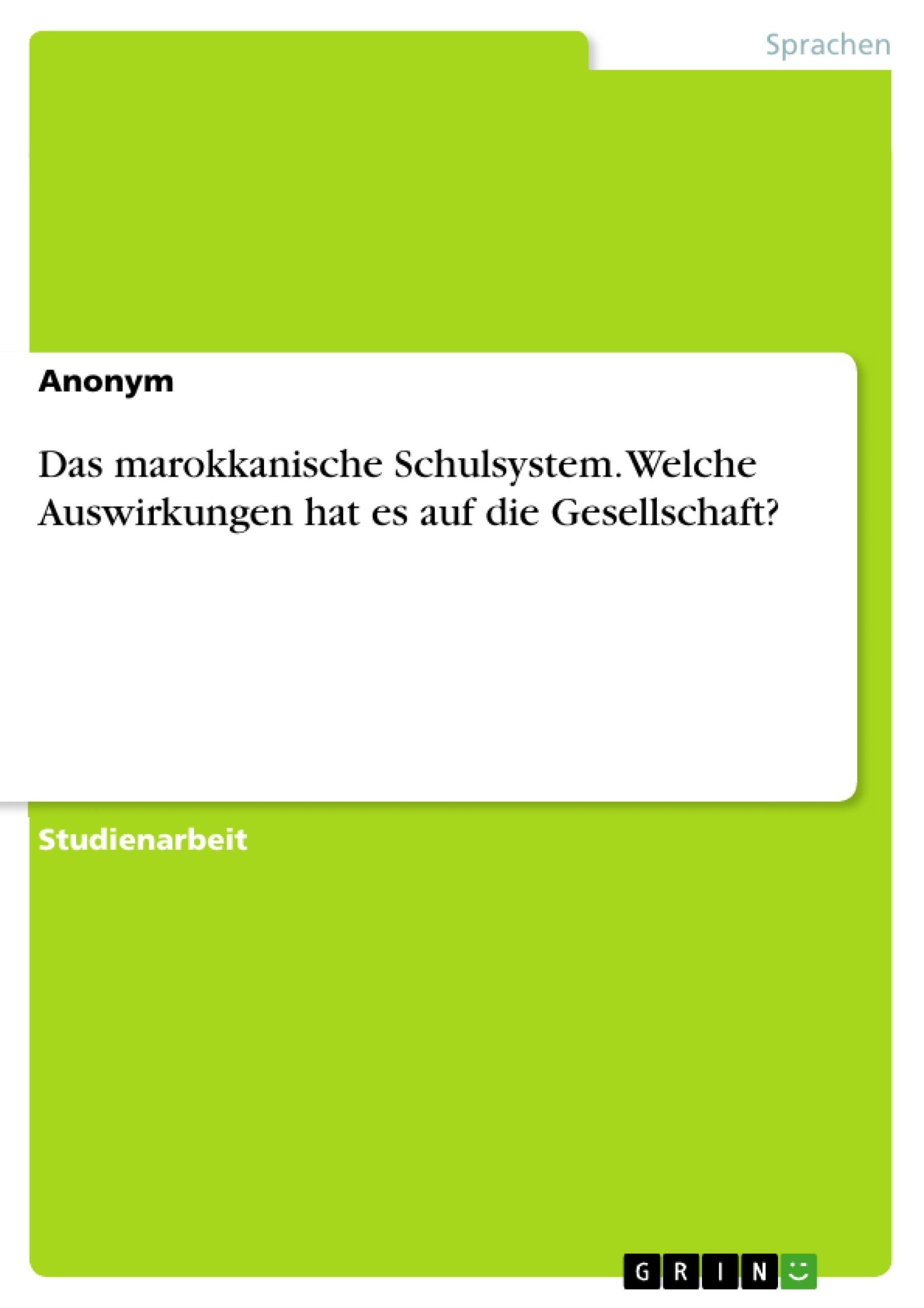Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht daher in dem Versuch, die bildungs- und sprachpolitischen Entwicklungen Marokkos und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft des Maghreb-Staates darzustellen. Dabei wird auf eine private Bildungseinrichtung in Marrakesch Bezug genommen um die Umsetzung aktueller sprach- und bildungspolitischer Bestrebungen zu verdeutlichen.
Da Schule immer im Kontext von Gesellschaft zu betrachten ist und die historischen Entwicklungen Marokkos einen wesentlichen Einfluss auf das heutige Schulsystem dort haben, wird in einem ersten, theoretischen Abschnitt auf wesentliche historische, bildungs- wie auch sprachpolitische Ereignisse und deren unmittelbare Auswirkungen auf das Bildungswesen des Maghreb-Staates eingegangen. Basierend auf den vorherigen Ausführungen sollte im nächsten Abschnitt normalerweise die Implementierung des Französischen bzw. der Aufbau des Sprachunterrichts in exemplarisch ausgewählten Primarschulen Marrakeschs folgen. Leider erwies es sich bei der Recherche als äußerst schwierig, fundierte Informationen zum spezifischen Aufbau des Sprachunterrichts zu bekommen. Insbesondere im Bereich der staatlichen Schulen hat sich herausgestellt, dass für die meisten Schulen keine Website mit öffentlich zugänglichen Informationen existiert. Anfragen auf Informationsauskunft, die direkt an die Bildungseinrichtungen gestellt wurden, blieben unbeantwortet. Ein Vergleich zwischen den Gegebenheiten in einer spezifischen, öffentlichen bzw. privaten Schule konnte daher aus Mangel an auffindbaren Ressourcen nicht durchgeführt werden.
Stattdessen wurde dieser Teil durch eine Analyse aktueller Entwicklungen im Bildungssystem ersetzt. Dazu wird in einem zweiten Teil auf aktuelle bildungs- und sprachpolitische Gegebenheiten im Allgemeinen eingegangen, die in einem letzten Abschnitt durch eine analytische Betrachtung der privaten Bildungseinrichtung präzisiert werden. Als Datengrundlage werden hier die Informationen der Schulwebsite um entsprechende Informationen des französischen Konsulats in Marokko und zwei weiterer bildungs- und sprachpolitischer Institutionen komplettiert. Abschließend erfolgt in der Conclusio eine Zusammenfassung der im Verlauf der vorliegenden Arbeit gewonnenen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Entwicklungen des marokkanischen Bildungswesens
- Das derzeitige marokkanische Bildungswesen
- Aktuelle Entwicklungen
- Die private Bildungsinstitution Groupe Scolaire Jacques-Majorelle
- Conclusio
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung des marokkanischen Bildungswesens unter besonderer Berücksichtigung der sprach- und bildungspolitischen Faktoren, die das System geprägt haben und bis heute beeinflussen. Ziel ist es, die Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die marokkanische Gesellschaft aufzuzeigen, wobei die private Bildungseinrichtung Groupe Scolaire Jacques-Majorelle in Marrakesch als Fallbeispiel dient.
- Historische Entwicklungen des marokkanischen Bildungswesens unter französischer Protektoratsherrschaft
- Einfluss der Arabisierungspolitik auf das Bildungswesen
- Die Rolle des Französischen im marokkanischen Schulsystem
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im marokkanischen Bildungswesen
- Analyse der privaten Bildungseinrichtung Groupe Scolaire Jacques-Majorelle
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert den Fokus auf die sprach- und bildungspolitischen Entwicklungen im marokkanischen Schulsystem. Zudem werden die Ziele der Arbeit und die methodische Vorgehensweise dargelegt.
Historische Entwicklungen des marokkanischen Bildungswesens
Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung des marokkanischen Bildungswesens während der französischen Protektoratszeit (1912-1956). Es beleuchtet die Einführung eines modernen Schulsystems nach französischem Vorbild, die Herausforderungen der Arabisierungspolitik nach der Unabhängigkeit sowie die Herausforderungen des Multilingualismus im marokkanischen Kontext.
Schlüsselwörter
Marokko, Bildungswesen, Sprachpolitik, Arabisierungspolitik, Französisch, Groupe Scolaire Jacques-Majorelle, Marrakesch, Bildungselite, Multilingualismus, Tamazight, Protektorat, historische Entwicklungen, aktuelle Entwicklungen, Bildungsinstitution.
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das marokkanische Schulsystem historisch geprägt?
Das System wurde stark durch die französische Protektoratszeit (1912-1956) beeinflusst, was zur Einführung eines modernen Bildungswesens nach französischem Vorbild führte.
Welche Rolle spielt die Arabisierungspolitik in Marokko?
Nach der Unabhängigkeit versuchte Marokko, das Bildungssystem zu arabisieren, was jedoch im Konflikt mit der weiterhin hohen Relevanz der französischen Sprache steht.
Warum ist das Französische im Bildungswesen noch immer so wichtig?
Französisch gilt oft als Sprache der Elite und der höheren Bildung, was zu einer gesellschaftlichen Spaltung zwischen denjenigen führt, die die Sprache beherrschen, und denen, die es nicht tun.
Was sind die größten Herausforderungen des marokkanischen Bildungswesens?
Zu den Problemen gehören der Multilingualismus (Arabisch, Französisch, Tamazight), der Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und die Diskrepanz zwischen staatlichen und privaten Schulen.
Was kennzeichnet private Bildungseinrichtungen wie die Groupe Scolaire Jacques-Majorelle?
Solche Schulen orientieren sich oft an internationalen (französischen) Standards und bedienen primär die wohlhabendere Bildungselite des Landes.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2021, Das marokkanische Schulsystem. Welche Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1007894