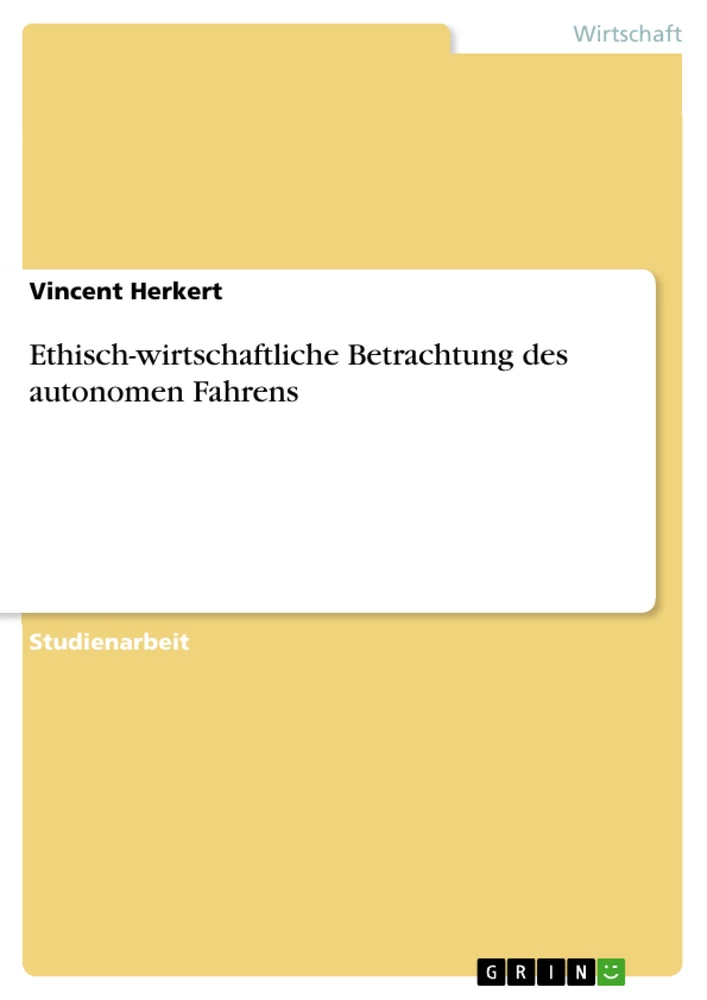Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit besteht darin, die Problemstellungen der ethischen Programmierung von autonomen Fahrzeugen aufzudecken und mögliche Lösungsansätze darzustellen. Darüber hinaus werden die wirtschaftlichen Auswirkungen näher beleuchtet und gezeigt, wer mögliche wirtschaftliche Gewinner und Verlierer dieser technologischen Innovation sind. Um diese Themen einzuleiten, wird in Kapitel 2 ein Einblick gegeben, wie sich die Mobilität im Laufe der letzten Jahrzehnte bis zum aktuellen Stand entwickelt hat. Das dritte Kapitel beinhaltet eine Definition des Begriffs des autonomen Fahrens, und im darauffolgenden Abschnitt werden potentielle Voraussetzungen für die Etablierung des selbstfahrenden Verkehrs aufgezeigt.
Neben Umwelt- und Gesundheitsproblemen wie Smog und Lärm sowie Überlastung der Infrastruktur für Energie und Kommunikation sind ebenso Engpässe in der Mobilität zu erwarten. Es braucht Lösungen, um Wohnen, Arbeiten und Leben in verdichteten Räumen bei mehr Lebensqualität und Mobilität mit gleichzeitig weniger Ressourceneinsatz zu ermöglichen. Folglich ist es keine Frage mehr ob, sondern wann und wie in Zukunft autonome Fahrzeuge und Transportsysteme die Straßen betreten. Bereits heutzutage kommen smarte Assistenzprogramme im Auto zum Einsatz und ermöglichen führerloses Einparken und das Abbremsen und Spurhalten auf der Autobahn oder im Stau. Mittels Kameras und Sensoren fallen immer mehr Echtzeitdaten an, die das Autofahren fortschrittlicher und sicherer machen sollen. Nach der Erfindung des Automobils ist das autonome Fahren wohlmöglich die bedeutendste Entwicklung der Mobilitätsgeschichte. Wen sollte der Computer bei einem bevorstehenden Verkehrsunfall schützen – Menschen aus der Umgebung oder Insassen? Was passiert, wenn zwischen einem Kind und einer älteren Person abgewogen werden muss? Diese und weitere Aspekte und Dilemma-Situationen gilt es zu erörtern und zu lösen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wandel der Mobilität
- Definition des autonomen Fahrens
- Voraussetzungen für autonomen Verkehr
- Infrastruktur und Verkehr
- Datensammlung im Fahrzeug
- Akzeptanz der Gesellschaft
- Wirtschaftliche Betrachtung
- Wirtschaftliche Gewinner
- Wirtschaftliche Verlierer
- Ethische Betrachtung
- Ethische Dilemma-Situationen
- Ethik-Setting
- Ethische Programmierung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der ethischen und wirtschaftlichen Betrachtung des autonomen Fahrens. Sie untersucht die ethischen Herausforderungen, die mit der Programmierung von selbstfahrenden Autos verbunden sind, insbesondere in Bezug auf Dilemma-Situationen und mögliche Lösungsansätze. Außerdem werden die wirtschaftlichen Auswirkungen des autonomen Fahrens analysiert, einschließlich potenzieller Gewinner und Verlierer.
- Ethische Herausforderungen der Programmierung autonomer Fahrzeuge
- Dilemma-Situationen im autonomen Verkehr
- Wirtschaftliche Auswirkungen des autonomen Fahrens
- Potenzielle Gewinner und Verlierer im Kontext des autonomen Fahrens
- Entwicklung der Mobilität und die Rolle des autonomen Fahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der Mobilität in den letzten Jahrzehnten und führt den Leser zum aktuellen Stand der Technik. In Kapitel 3 wird der Begriff des autonomen Fahrens definiert. Kapitel 4 befasst sich mit den Voraussetzungen für die Etablierung von selbstfahrendem Verkehr, einschließlich Infrastruktur, Datensammlung und gesellschaftlicher Akzeptanz. Die Kapitel 5 und 6 beleuchten die wirtschaftlichen und ethischen Auswirkungen des autonomen Fahrens.
Schlüsselwörter
Autonomes Fahren, Ethische Programmierung, Dilemma-Situationen, Wirtschaftliche Auswirkungen, Mobilität, Verkehrsunfälle, Datensammlung, Infrastruktur, Gesellschaftliche Akzeptanz.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen ethischen Herausforderungen beim autonomen Fahren?
Die Hauptproblematik liegt in der ethischen Programmierung für Dilemma-Situationen, etwa der Entscheidung, wen das Fahrzeug bei einem unvermeidbaren Unfall schützen soll (z. B. Insassen vs. Passanten oder Jung vs. Alt).
Wer sind die wirtschaftlichen Gewinner und Verlierer dieser Technologie?
Die Arbeit analysiert potenzielle Profiteure (z. B. Technologieunternehmen, effiziente Transportdienste) und Akteure, die durch den Wandel wirtschaftliche Nachteile erleiden könnten (z. B. klassische Berufsfahrer).
Welche Voraussetzungen müssen für den autonomen Verkehr erfüllt sein?
Dazu gehören eine angepasste Infrastruktur, die Fähigkeit zur massiven Datensammlung im Fahrzeug sowie eine breite gesellschaftliche Akzeptanz der Technologie.
Wie hat sich die Mobilität in den letzten Jahrzehnten entwickelt?
Die Arbeit gibt einen Überblick vom klassischen Automobil bis hin zu modernen Assistenzsystemen wie Einparkhilfen und Spurhalteassistenten, die Vorstufen zum autonomen Fahren sind.
Welche Rolle spielen Kameras und Sensoren beim autonomen Fahren?
Sie liefern die notwendigen Echtzeitdaten, die es dem Computer ermöglichen, das Umfeld zu erfassen und das Fahrzeug sicher und fortschrittlich zu steuern.
- Quote paper
- Vincent Herkert (Author), 2021, Ethisch-wirtschaftliche Betrachtung des autonomen Fahrens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1008048