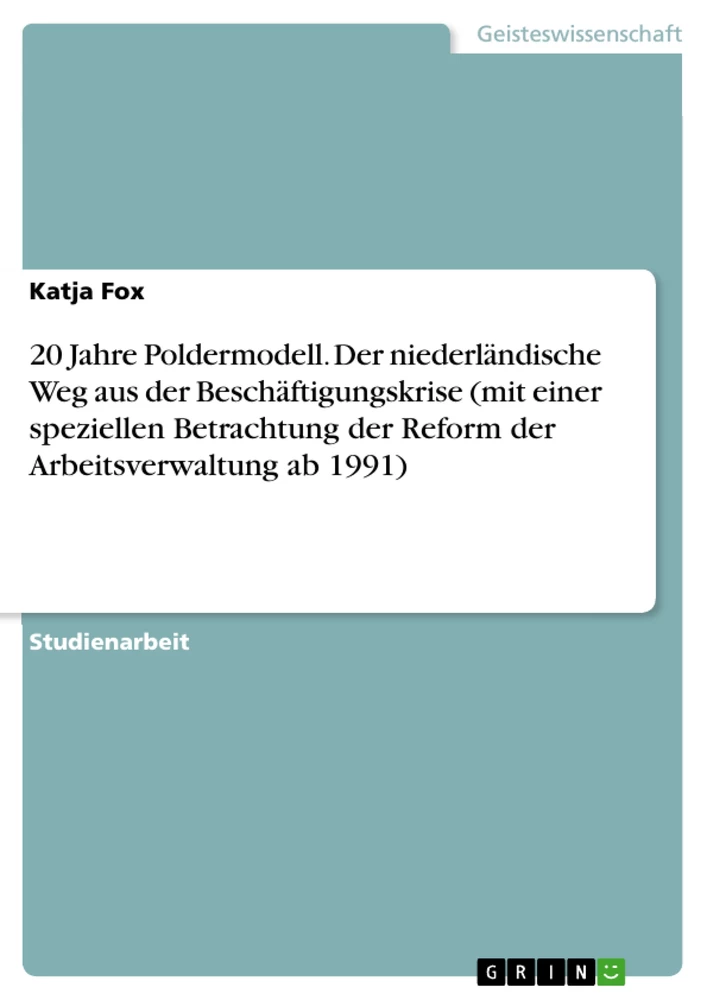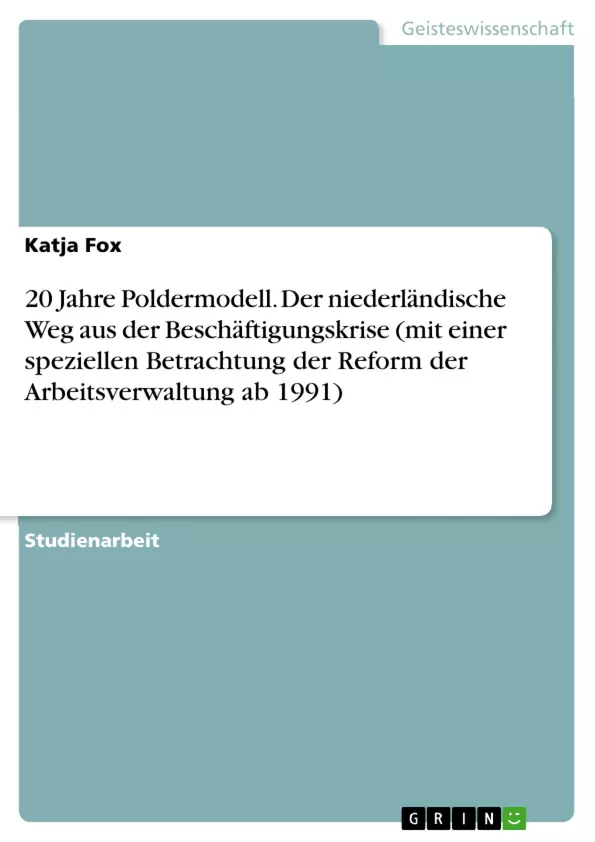Ausgelöst durch die beiden Ölpreisschocks in den 70er Jahren stehen die europäischen Wohlfahrts- und Beschäftigungssysteme heutzutage vor ähnlichen sozial- und arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen. Die Öffnung der Finanzmärkte erlaubt einen ungehinderten Kapitalfluss über die nationalen Grenzen hinaus. Dadurch erhöht sich der internationale Wettbewerb im Bereich der Handels- und Produktionsbeziehungen und setzt die nationalen Unternehmen zunehmend unter einen starken Rationalisierungsdruck, um der verschärften Konkurrenz Stand zu halten. Eine hohe Staatsverschuldung und Inflationsrate wurde zum Ende der 1970er Jahre zur Eindämmung der Massenarbeitslosigkeit von vielen Nationalstaaten in Kauf genommen. Zusätzlich verursachten demographische Veränderungen in Verbindung mit einer niedrigen Erwerbstätigenquote (die durchschnittliche Quote, beispielsweise in den Niederlanden von 1973-83 fiel mit 58,3 % im Vergleich zum EU-Durchschnitt von 66,9 % sehr gering aus1) eine große finanzielle Belastungen der Systeme der sozialen Sicherung. Weiterhin setzt die zunehmende Individualisierung, ausgedrückt in hohen Scheidungsraten, dem Einstieg von Frauen in das Erwerbsleben und einem Wertewandel hin zur Freizeitgesellschaft die Regierungen zunehmend unter Reformdruck im Bereich der, auf einen Familienernährer ausgelegten Sozial- und Arbeitsmarktsysteme.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Das niederländische Verhandlungsmodell
- Die Entwicklung in den Niederlanden bis 1982
- Die wirtschaftliche Lage, der Arbeitsmarkt und die Finanzierung des Sozialstaates in den 1970ern
- Arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Maßnahmen der Regierung
- Das „Abkommen von Wassenaar" und die Entwicklung in den 1980er Jahren
- Zurückhaltung der Löhne und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Konsolidierung der Staatsfinanzen, Steuer- und Abgabensenkung und Kürzung der Sozialleistungen
- Der wirtschaftliche Aufschwung in den 1990er Jahren
- Die Reform der Erwerbsunfähigkeitsrente und der Krankenversicherung
- Die Wende hin zur aktiven Arbeitsmarktpolitik und der Ausbau der Teilzeitarbeit
- Die Reform der Arbeitsverwaltung
- Welchen Erfolg hat die Reform der Arbeitsverwaltung zu verzeichnen
- Wohin führt der niederländische Weg ?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Transformation der Niederlande von einem desolaten Sozialstaat hin zu einem florierenden Modell. Sie analysiert die Schlüsselmomente und Reformmaßnahmen, die diesen Wandel ermöglichten, wobei der Schwerpunkt auf der Arbeitsmarktpolitik liegt. Dabei werden sowohl die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch die politischen Entscheidungen berücksichtigt, die zu den Beschäftigungszuwächsen der 1990er Jahre führten.
- Die Entwicklung des niederländischen Verhandlungsmodells (Korporatismus) und seine Rolle bei der Gestaltung von Reformen
- Die Auswirkungen der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der 1970er und 1980er Jahre auf die Niederlande
- Die Reformstrategie des "Abkommens von Wassenaar" und seine Folgen für die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
- Die Bedeutung der aktiven Arbeitsmarktpolitik und die Ausweitung der Teilzeitarbeit in den 1990er Jahren
- Die Reform der Arbeitsverwaltung und ihre potenziellen Lehren für die deutsche Arbeitsverwaltung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problemstellung der Arbeit dar, die sich auf die Transformation des niederländischen Sozialstaates und die damit verbundenen Herausforderungen konzentriert. Sie skizziert den historischen Hintergrund und den Fokus der Arbeit auf die Arbeitsmarktpolitik.
- Das zweite Kapitel beleuchtet das niederländische Verhandlungsmodell (Korporatismus) und dessen Bedeutung für den Prozess der Reformen. Es wird die historische Entwicklung und die Rolle der Sozialpartner bei der Gestaltung der Arbeitsmarktpolitik dargestellt.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit den Entwicklungen in den Niederlanden bis 1982, wobei die wirtschaftliche Lage, der Arbeitsmarkt und die Finanzierung des Sozialstaates im Fokus stehen. Es werden die Herausforderungen der 1970er Jahre und die damaligen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Regierung analysiert.
- Das vierte Kapitel untersucht das "Abkommen von Wassenaar" und dessen Folgen für die niederländische Entwicklung in den 1980er Jahren. Es betrachtet die Maßnahmen zur Lohnzurückhaltung, Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Konsolidierung der Staatsfinanzen.
- Das fünfte Kapitel beleuchtet den wirtschaftlichen Aufschwung in den 1990er Jahren und analysiert die Reformen der Erwerbsunfähigkeitsrente und der Krankenversicherung sowie die Wende hin zur aktiven Arbeitsmarktpolitik.
- Das sechste Kapitel befasst sich mit der Reform der Arbeitsverwaltung und untersucht ihren Erfolg sowie ihre Relevanz für die deutsche Arbeitsverwaltung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Transformation des niederländischen Sozialstaates, die Arbeitsmarktpolitik, das Verhandlungsmodell (Korporatismus), die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der 1970er und 1980er Jahre, das "Abkommen von Wassenaar", die Reform der Arbeitsverwaltung und die Entwicklung der Teilzeitarbeit. Die Arbeit analysiert den Weg des Landes von einer hohen Arbeitslosenquote hin zu einer erfolgreichen Beschäftigungspolitik und beleuchtet die Schlüsselfaktoren dieses Wandels.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das niederländische "Poldermodell"?
Es beschreibt ein konsensorientiertes Verhandlungsmodell (Korporatismus) zwischen Staat, Arbeitgebern und Gewerkschaften zur Lösung wirtschaftlicher Probleme.
Was wurde im "Abkommen von Wassenaar" (1982) vereinbart?
Gewerkschaften stimmten Lohnzurückhaltung zu, während Arbeitgeber im Gegenzug Arbeitszeitverkürzungen und die Schaffung neuer Stellen (oft Teilzeit) ermöglichten.
Wie bekämpften die Niederlande die Massenarbeitslosigkeit?
Durch eine Wende hin zur aktiven Arbeitsmarktpolitik, den massiven Ausbau von Teilzeitarbeit und die Sanierung der Staatsfinanzen.
Welche Rolle spielte die Reform der Arbeitsverwaltung ab 1991?
Die Arbeitsverwaltung wurde modernisiert, um eine effizientere Vermittlung und Aktivierung von Arbeitslosen zu erreichen, was als Vorbild für andere Länder diente.
Was sind die Lehren aus dem niederländischen Weg?
Der Erfolg zeigt, dass durch pragmatische Zusammenarbeit der Sozialpartner auch schwere Beschäftigungskrisen überwunden werden können.
- Citar trabajo
- Katja Fox (Autor), 2002, 20 Jahre Poldermodell. Der niederländische Weg aus der Beschäftigungskrise (mit einer speziellen Betrachtung der Reform der Arbeitsverwaltung ab 1991), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10112