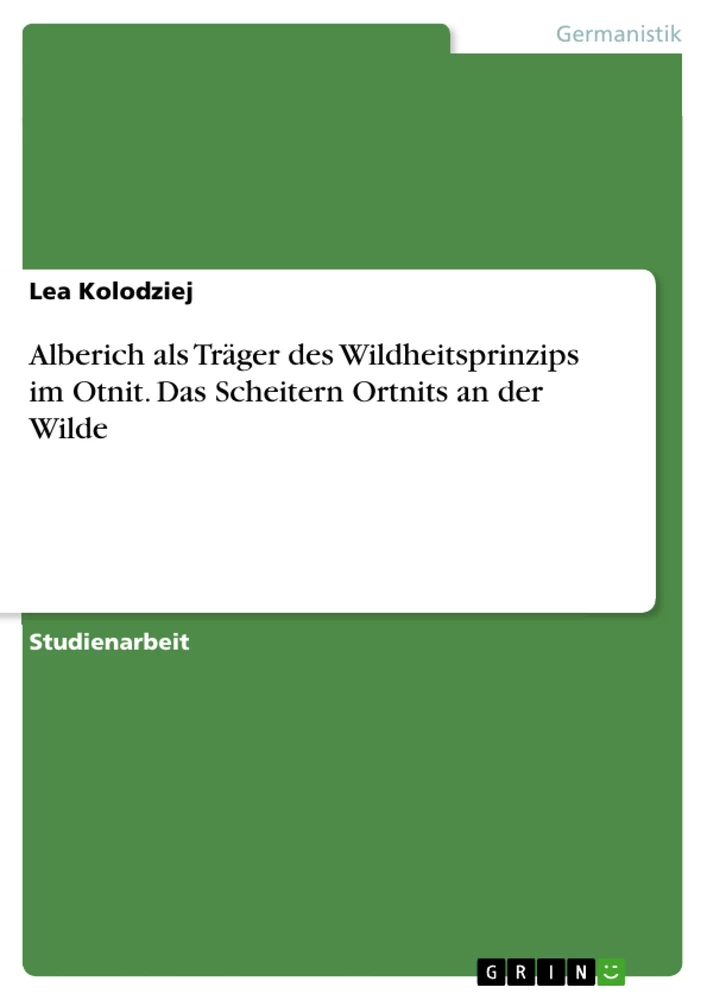Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, auf welche Art und Weise die Figur Alberich im Otnit funktionalisiert wird. Es wird überprüft, ob Alberichs Aufgabe tatsächlich darin besteht, das Konzept der wilde in den Otnit einzuführen, und ob die Figur eindeutig als Träger des Wildheitsprinzips ausgewiesen werden kann. Dabei sollen besonders Alberichs Verbindung zu Ortnit und seine Bedeutung für den gesamten Handlungsverlauf herausgearbeitet werden.
In einem ersten Schritt werden die wichtigsten theoretischen Grundlagen zur Analyse mittelalterlicher Figuren in groben Zügen dargestellt. Darauf folgt ein kurzer Überblick zum Begriff der wilde in der mittelalterlichen Literatur, um anschließend das Wildheitsprinzip auf die Figur Alberich anwenden zu können. Nach der Betrachtung Alberichs im Hinblick auf seine wilden Eigenschaften wird auch sein Lebensraum als Ort der wilde beleuchtet. Abschließend wird erarbeitet, inwieweit sich Alberich durch das wilde-Konzept funktionalisieren lässt. Dazu wird anhand der vorherigen Überlegungen die Eignung Alberichs als Träger des Wildheitsprinzips überprüft. Ebenso wird kontrolliert, inwieweit der Einfluss des wilden Zwergenvaters Alberich zu Ortnits Scheitern beiträgt. Am Ende der vorliegenden Arbeit soll die Frage beantwortet werden können, welche Funktion und Bedeutung der Figur Alberich im Otnit zukommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Figurenbegriff in der Literatur des Mittelalters
- 3. Zum Begriff der wilde in der Literatur des Mittelalters
- 4. Anwendung des Wildheitsprinzips auf die Figur Alberich
- 4.1 Alberich als wildes und zugleich ambivalentes Wesen
- 4.2 Die ambivalente Wildnis als Alberichs Lebensraum
- 5. Funktionalisierung der Alberich-Figur
- 5.1 Alberich als Träger des Wildheitsprinzips
- 5.2 Auswirkungen auf die Otnit-Handlung
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion der Figur Alberich im mittelhochdeutschen Heldenepos Otnit. Im Mittelpunkt steht die Frage, inwieweit Alberich als Träger des „Wildheitsprinzips“ fungiert und wie dies den Handlungsverlauf beeinflusst. Die Analyse bezieht den Figurenbegriff des Mittelalters und die semantische Vielschichtigkeit des Begriffs „wilde“ mit ein.
- Der mittelalterliche Figurenbegriff und seine Eigenheiten
- Der vielschichtige Begriff der „wilde“ in der mittelalterlichen Literatur
- Alberichs Charakterisierung als wildes und ambivalentes Wesen
- Alberichs Lebensraum als ambivalente Wildnis
- Alberichs Einfluss auf die Handlung und Ortnits Scheitern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach der Funktion der Figur Alberich im Otnit. Sie skizziert den ungewöhnlichen Handlungsverlauf – das Scheitern des Helden Ortnit – und kündigt den methodischen Ansatz der Arbeit an: die Untersuchung von Alberichs Rolle als potentieller Träger des Wildheitsprinzips und dessen Einfluss auf die Handlung. Die Einleitung umreißt die einzelnen Schritte der Analyse, beginnend mit theoretischen Grundlagen zum mittelalterlichen Figurenbegriff und dem Begriff der „wilde“, bis hin zur Analyse von Alberichs Charakter und seiner Bedeutung für den Handlungsverlauf.
2. Der Figurenbegriff in der Literatur des Mittelalters: Dieses Kapitel beleuchtet den spezifischen Figurenbegriff der mittelalterlichen Literatur. Es wird herausgestellt, dass mittelalterliche Figuren oft unvollständig und ergänzungsbedürftig dargestellt werden und ihre Motivation primär durch Handlungsmuster erklärt werden muss. Im Gegensatz zu modernen Figuren, die oft durch ihre Innenwelt charakterisiert werden, fungieren mittelalterliche Figuren in erster Linie als Handlungsträger (Aktanten). Ihre Eigenschaften leiten sich aus ihren Handlungen ab, und sie sind funktional einem übergeordneten Zweck untergeordnet.
3. Zum Begriff der wilde in der Literatur des Mittelalters: Dieses Kapitel analysiert den vielschichtigen Begriff „wilde“ im Mittelhochdeutschen. Es wird gezeigt, dass „wilde“ nicht einfach als „wild“ im modernen Sinne übersetzt werden kann, da er sowohl negative Konnotationen (ungezähmt, fremdartig) als auch positive (wunderbar) umfasst. „Wilde“ bezeichnet auch einen topographischen Raum, der oft als ambivalenter Ort der Abenteuer und gleichzeitig als Rückzugs- und Heilsraum dargestellt wird. Der Wald als zentraler Ort der „wilde“ wird im Kontext der höfischen Literatur behandelt und seine Funktion als Raumschwelle zwischen Diesseits und Jenseits erläutert. Typische „wilde“ Wesen werden aufgezählt, und es wird der Aspekt thematisiert, dass Helden durch Konfrontation mit dem Wildheitsprinzip selbst verwildern können.
Schlüsselwörter
Otnit, Alberich, Wolfdietrich, Mittelalterliche Literatur, Heldenepik, Figurenbegriff, Wildheitsprinzip, Wilde, Ambivalenz, Handlungsfunktion, mittelhochdeutsche Literatur, Aktanten, mittelalterliche Anthropologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Arbeit: "Die Funktion der Figur Alberich im mittelhochdeutschen Heldenepos Otnit"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Rolle der Figur Alberich im mittelhochdeutschen Heldenepos Otnit. Im Fokus steht dabei die Frage, inwieweit Alberich als Träger eines "Wildheitsprinzips" fungiert und wie dies den Handlungsverlauf, insbesondere das Scheitern des Helden Otnit, beeinflusst.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den mittelalterlichen Figurenbegriff, die semantische Vielschichtigkeit des Begriffs "wilde" im Mittelhochdeutschen, die Charakterisierung Alberichs als wildes und ambivalentes Wesen, seinen Lebensraum als ambivalente Wildnis und seinen Einfluss auf die Handlung und Otnits Scheitern. Die Analyse bezieht theoretische Grundlagen zum mittelalterlichen Figurenverständnis und zur Bedeutung von "wilde" mit ein.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) stellt die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz vor. Kapitel 2 beleuchtet den mittelalterlichen Figurenbegriff. Kapitel 3 analysiert den vielschichtigen Begriff "wilde". Kapitel 4 untersucht Alberich als Träger des Wildheitsprinzips und seine ambivalente Natur. Kapitel 5 betrachtet Alberichs Einfluss auf die Handlung von Otnit. Kapitel 6 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird Alberich in der Arbeit charakterisiert?
Alberich wird als wildes und ambivalentes Wesen dargestellt. Seine Ambivalenz zeigt sich in der mehrdeutigen Bedeutung des Begriffs "wilde", der sowohl negative als auch positive Konnotationen umfasst. Alberichs Lebensraum, die ambivalente Wildnis, spiegelt diese Ambivalenz wider.
Welche Bedeutung hat der Begriff "wilde" in der Arbeit?
Der Begriff "wilde" im mittelhochdeutschen Kontext wird als vielschichtig dargestellt. Er umfasst nicht nur die moderne Bedeutung von "wild", sondern beinhaltet auch positive Konnotationen und bezeichnet auch einen topographischen Raum (z.B. den Wald) mit ambivalenter Bedeutung als Ort des Abenteuers und des Rückzugs.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit untersucht die Funktion der Figur Alberich durch die Analyse seines Beitrags zum "Wildheitsprinzip" und dessen Auswirkung auf den Handlungsverlauf des Epos Otnit. Sie stützt sich auf die Interpretation des Textes und bezieht dabei den mittelalterlichen Figurenbegriff und die semantische Reichhaltigkeit des Begriffs "wilde" mit ein.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Otnit, Alberich, Wolfdietrich, Mittelalterliche Literatur, Heldenepik, Figurenbegriff, Wildheitsprinzip, Wilde, Ambivalenz, Handlungsfunktion, mittelhochdeutsche Literatur, Aktanten, mittelalterliche Anthropologie.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler und Studenten der mittelalterlichen Literatur, Germanistik und vergleichenden Literaturwissenschaft, die sich mit dem mittelhochdeutschen Heldenepos, dem Figurenbegriff des Mittelalters und der Semantik mittelalterlicher Begriffe auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- Lea Kolodziej (Autor), 2016, Alberich als Träger des Wildheitsprinzips im Otnit. Das Scheitern Ortnits an der Wilde, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1012792