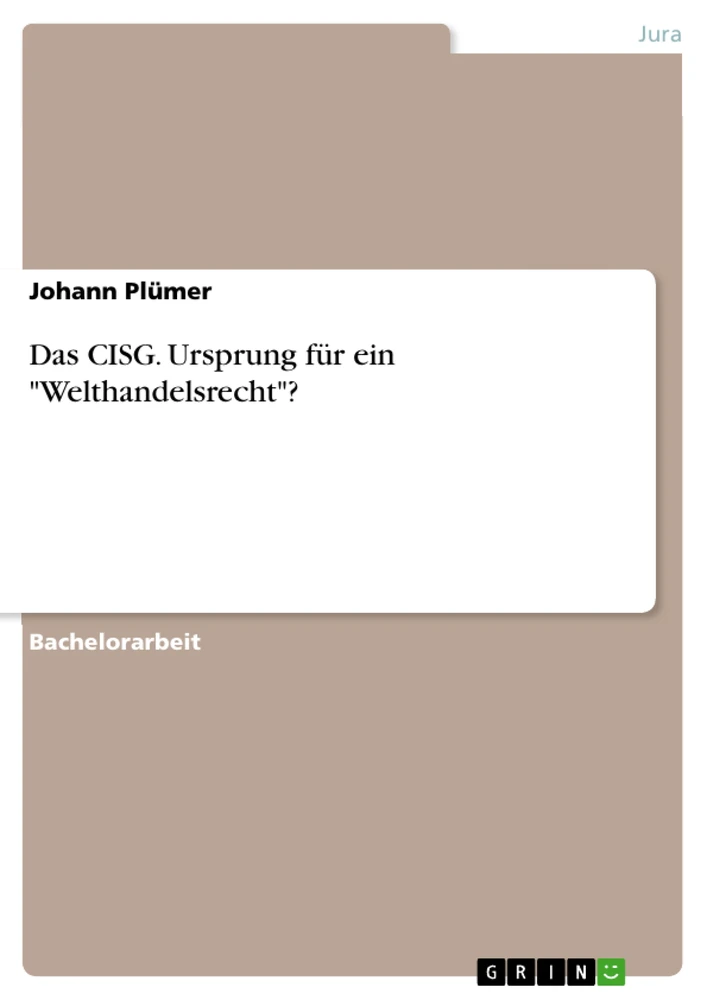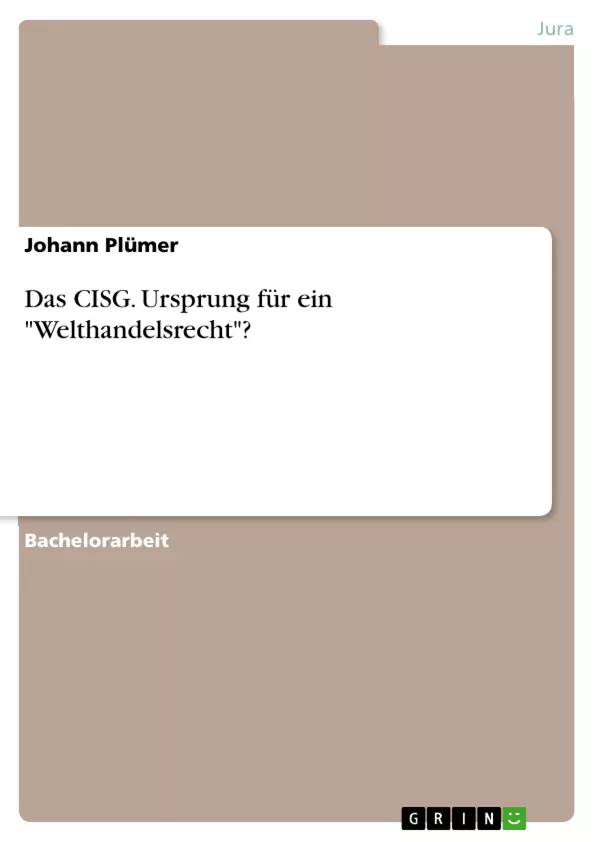In der vorliegenden wissenschaftlichen Arbeit wird dargestellt, ob das UN-Kaufrecht (engl.: CISG) als Ursprung für ein Welthandelsrecht bestehen kann. Hat es zum Wachstum anderer Regelwerke beigetragen, sie überhaupt erst möglich gemacht und bietet es eine geeignete Grundlage, um als gemeinsames Welthandelsrecht zu dienen?
Um einen aktuellen, rechtsrelevanten Bezug zum Zeitgeschehen darzustellen, wird untersucht, welchem Stellenwert dem CISG in der Corona-Krise in Bezug auf Leistungsstörungen – im speziellen Lieferstörungen im globalen Handel – beigemessen werden kann.
Den Grundstein für diese wissenschaftliche Arbeit legt eine erläuternde Darstellung des einheitlichen UN-Kaufrechts, inklusive dem inhaltlichen Aufbau, um dem Leser1 die thematische Verortung zu erleichtern. Die darauffolgende Entstehungsgeschichte des CISG wird den internationalen Charakter dessen aufzeigen und bildet gleichzeitig eine Grundlage für ein weiteres Kapitel, welches sich mit der Bedeutung des CISG in der Praxis befasst. Neben der Bedeutung des CISG als Instrument für den internationalen Handelskauf, werden dem Leser die Vor- und Nachteile des UN-Kaufrechts aufgezeigt. Im Einzelnen wird dargelegt, in welchem Ausmaß das CISG nationale Regelwerke und Gesetzgebungen beeinflusst hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das einheitliche UN-Kaufrecht (CISG)
- 2.1. Entstehungsgeschichte des CISG
- 2.2. Die Bedeutung des CISG in der Praxis
- 2.3. Einfluss des CISG auf Internationale Handelsverträge
- 2.4. Anwendungsvoraussetzungen und Anwendungsbereiche des CISG
- 3. Vertragsabschluss im CISG
- 3.1. Pflichten des Verkäufers
- 3.2. Pflichten des Käufers
- 3.3. Die Leistungsstörung auf Verkäuferseite im CISG
- 3.3.1. Nichtlieferung als Form der Nichterfüllung einer Verkäuferpflicht
- 3.3.2. Leistungsstörungen im internationalen Warenhandel gemäß CISG und BGB
- 4. Der Begriff der „höheren Gewalt“ und „Force Majeure“
- 4.1. Die Corona-Krise als Akt höherer Gewalt?
- 4.2. Auswirkung der Corona-Pandemie auf Dritte
- 4.3. Voraussetzungen der Entlastung nach Artikel 79 CISG
- 4.3.1. Unbeherrschbarer Hinderungsgrund
- 4.3.2. Unvorhersehbarkeit des Hinderungsgrundes
- 4.3.3. Unabwendbarkeit des Hindernisses und seiner Konsequenzen
- 4.4. Voraussetzung der Entlastung nach dem BGB
- 4.4.1. Unmöglichkeit der Leistung
- 4.4.2. Störung der Geschäftsgrundlage
- 5. Störung der Geschäftsgrundlage nach §313 BGB und Artikel 79 CISG
- 6. Anwendung des CISG und BGB im internationalen Warenhandel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das UN-Kaufrecht (CISG) als Ursprung für ein Welthandelsrecht dienen kann. Dabei wird untersucht, ob das CISG zum Wachstum anderer Regelwerke beigetragen und eine geeignete Grundlage für ein gemeinsames Welthandelsrecht bietet. Die Arbeit analysiert den Stellenwert des CISG in der Corona-Krise im Hinblick auf Leistungsstörungen, insbesondere Lieferstörungen im globalen Handel.
- Die Entstehungsgeschichte des CISG und seine Bedeutung in der Praxis
- Der Einfluss des CISG auf internationale Handelsverträge und seine Anwendung im internationalen Warenhandel
- Die Rolle des CISG in der Corona-Krise im Hinblick auf Leistungsstörungen und die Frage der höheren Gewalt
- Die Voraussetzungen der Entlastung nach Artikel 79 CISG und §313 BGB
- Die Vergleichende Darstellung des CISG und des BGB im internationalen Warenhandel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Relevanz des Themas im Kontext der COVID-19-Pandemie und erläutert die Fragestellung der Arbeit. Kapitel 2 stellt das einheitliche UN-Kaufrecht (CISG) vor, beleuchtet seine Entstehungsgeschichte und Bedeutung in der Praxis sowie seinen Einfluss auf internationale Handelsverträge. Kapitel 3 befasst sich mit Vertragsabschlüssen im CISG, den Pflichten von Verkäufer und Käufer und der Bedeutung von Leistungsstörungen im internationalen Handel. Kapitel 4 beleuchtet den Begriff der „höheren Gewalt“ und „Force Majeure“ und analysiert die Frage, ob die Corona-Pandemie als Akt höherer Gewalt betrachtet werden kann. Es werden die Voraussetzungen für die Entlastung nach Artikel 79 CISG und dem BGB im Kontext der Corona-Krise erläutert. Kapitel 5 vergleicht die Störung der Geschäftsgrundlage nach §313 BGB und Artikel 79 CISG. Schließlich untersucht Kapitel 6 die Anwendung des CISG und des BGB im internationalen Warenhandel.
Schlüsselwörter
UN-Kaufrecht (CISG), Welthandelsrecht, Internationale Handelsverträge, Corona-Krise, Leistungsstörungen, Lieferstörungen, höhere Gewalt, Force Majeure, Artikel 79 CISG, §313 BGB, Geschäftsgrundlage, Rechtswahl, Internationales Privatrecht (IPR).
Häufig gestellte Fragen
Was ist das CISG?
Das CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ist das UN-Kaufrecht, das einheitliche Regeln für den internationalen Warenkauf zwischen Unternehmen aus verschiedenen Staaten festlegt.
Kann das CISG als Grundlage für ein Welthandelsrecht dienen?
Ja, das CISG hat bereits viele nationale Gesetzgebungen beeinflusst und bietet durch seinen internationalen Charakter eine solide Basis für eine weltweite Vereinheitlichung des Handelsrechts.
Gilt die Corona-Krise im CISG als "höhere Gewalt"?
Dies wird unter Artikel 79 CISG geprüft. Eine Entlastung ist möglich, wenn ein unvorhersehbarer und unbeherrschbarer Hinderungsgrund die Lieferung unmöglich macht, wobei die Hürden in der Praxis sehr hoch sind.
Was unterscheidet Artikel 79 CISG von § 313 BGB?
Artikel 79 CISG konzentriert sich auf die Befreiung von Schadensersatzansprüchen bei Hinderungsgründen, während § 313 BGB die Anpassung oder Aufhebung des Vertrages bei Störung der Geschäftsgrundlage regelt.
Wann findet das CISG Anwendung?
Es findet Anwendung auf Kaufverträge über Waren zwischen Parteien, die ihre Niederlassung in verschiedenen Vertragsstaaten haben, sofern es nicht vertraglich ausgeschlossen wurde.
- Citar trabajo
- Johann Plümer (Autor), 2021, Das CISG. Ursprung für ein "Welthandelsrecht"?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1020379