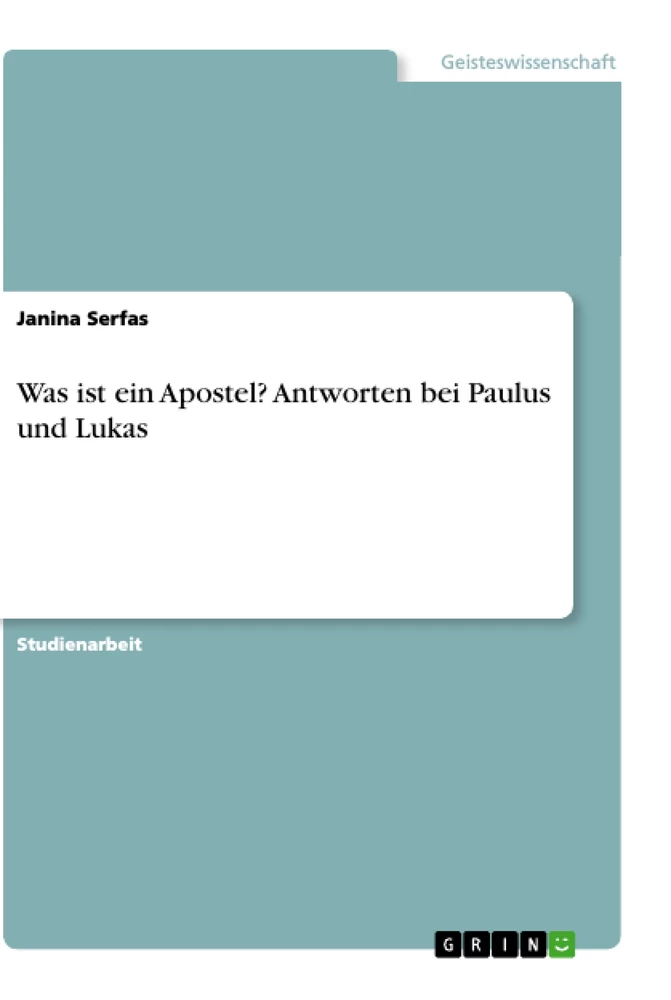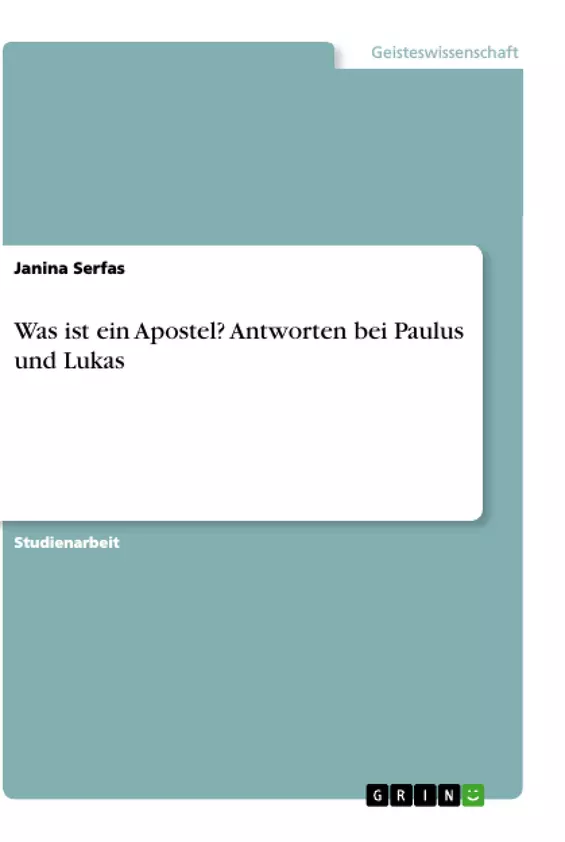Ziel dieser Arbeit ist es, die Antworten zusammenzutragen, die Paulus und Lukas auf die Frage „Was ist ein Apostel?“ geben, welche Kriterien sie dafür nennen und welche sachlich-begrifflichen und personellen Abgrenzungen sie dabei treffen. Beide Konzepte scheinen zueinander in Spannung zu stehen bzw. sich gar zu widersprechen: Wo Paulus den Apostelbegriff verwendet, spricht er zumeist von sich selbst als Apostel. Demgegenüber bietet Lukas auf den ersten Blick ein stimmiges Zwölf-Apostel-Konzept ohne Paulus.
In Teil II dieser Arbeit soll es zunächst um die Berufung gehen, durch die ein „Apostel“ als solcher legitimiert wird: Ist es bereits der irdische Jesus, der zu Lebzeiten beruft, oder erst der Auferstandene, der in einer Erscheinung und/oder Offenbarung beruft? Oder handelt es sich beim Apostolat um ein auf den heiligen Geist zurückzuführendes χάρισμα und der „Apostel“ wird von seiner Gemeinde ausgesandt?
Teil III dieser Arbeit befasst sich dann mit der apostolischen Praxis: Welchen Auftrag hat ein „Apostel“? Welche Lebensweise ist für einen „Apostel“ charakteristisch?
Zum Abschluss sollen die Ergebnisse in Teil IV zusammengetragen und im Hinblick auf die Frage „Was ist ein Apostel?“ ausgewertet werden.
Die Frage „Was ist ein Apostel?“ führt zurück in die Entstehungszeit der Kirche, als es galt die urchristliche Tradition zu verbreiten und zu sichern. Die „Apostel“ sind die wichtigsten Traditionsträger dieser Anfangszeit; auf ihren Glauben und ihr Zeugnis von Jesu Auferstehung gründet sich der Glaube der Christen. Der Begriff ὁ ἀπόστολος als vom Verb ἀποστέλλειν („absenden“; „aussenden“) abgeleitete Nominalbildung findet sich im Neuen Testament rund 80 Mal, schwerpunktmäßig bei Paulus (29 Mal inklusive Kol und Eph bzw. 19 Mal in den sieben als authentisch eingestuften Paulusbriefen) und im lukanischen Doppelwerk (34 Mal, 6 Mal bei Lk und 28 Mal in der Apg). Im Urchristentum wird ἀπόστολος personal verstanden als „Gesandter“ bzw. „Bote“ in einem breiten Bedeutungsspektrum, das von den geläufigen griechischen Begriffen wie κῆρυξ oder πρεσβευτής offenbar nicht abgedeckt wurde. Trotz Versuchen, die spezifisch urchristliche Verwendung von ἀπόστολος herzuleiten oder zu erklären, bleiben die Anfänge des christlichen Apostelbegriffs im Dunkeln. Das Hauptproblem dabei ist das Vorhandensein nur weniger Quellen, die außerdem eine bereits fortgeschrittene Stufe in der Entwicklung des christlichen Apostelbegriffs reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung: Was ist ein Apostel?
- II Berufung als Legitimation
- II.1 Irdischer Jesus / Erscheinung des Auferstandenen / Offenbarung Jesu Christi
- II.2 Heiliger Geist / Charisma / Gemeinde
- III Sendung mit Beauftragung
- III.1 Evangeliumsverkündigung / Mission
- III.2 Zeuge sein
- III.3 Gemeindegründung und Gemeindeleitung
- III.4 Recht auf Unterhalt
- III.5 Zeichen und Wunder
- III.6 Schwachheit und Leiden
- IV Ergebnis: Was ist denn nun ein Apostel?!?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verständnis des Apostelbegriffs bei Paulus und Lukas. Ziel ist es, die jeweiligen Kriterien, sachlich-begrifflichen und personellen Abgrenzungen beider Autoren zu vergleichen und zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Spannungen und möglichen Widersprüche zwischen den beiden Konzepten.
- Der Begriff „Apostel“ im Neuen Testament und seine Verwendung bei Paulus und Lukas.
- Legitimation des Apostelamt: Berufung durch Jesus, den Heiligen Geist, oder die Gemeinde?
- Der apostolische Auftrag: Evangeliumsverkündigung, Zeugnis ablegen, Gemeindegründung und -leitung.
- Charakteristische Merkmale des apostolischen Lebens: Recht auf Unterhalt, Zeichen und Wunder, Schwachheit und Leiden.
- Vergleich des paulinischen und lukanischen Apostelverständnisses.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Was ist ein Apostel?: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verständnis des Apostelbegriffs im frühen Christentum. Sie beleuchtet die Häufigkeit des Begriffs "Apostel" im Neuen Testament, insbesondere bei Paulus und Lukas, und verweist auf die unterschiedlichen Bedeutungen in der profangriechischen Literatur. Die Einleitung hebt die Schwierigkeiten hervor, den urchristlichen Apostelbegriff präzise zu definieren, da die verfügbaren Quellen bereits eine fortgeschrittene Entwicklung des Begriffs widerspiegeln. Sie verweist auf die Debatte, ob das Apostolat als Amt oder Dienst zu verstehen ist, und kündigt die Ziele der Arbeit an: die Analyse der Konzepte von Paulus und Lukas und den Vergleich ihrer jeweiligen Kriterien und Abgrenzungen. Das Kapitel betont die unterschiedlichen Perspektiven und die mögliche Spannung zwischen dem Selbstverständnis des Paulus und dem lukanischen Apostelbild.
II Berufung als Legitimation: Dieses Kapitel untersucht die Legitimation des Apostelamt. Es diskutiert, ob die Berufung durch den irdischen Jesus, durch Erscheinungen des Auferstandenen, oder durch Offenbarungen Jesu Christi erfolgt. Weiterhin wird die Rolle des Heiligen Geistes und das Charisma als Grundlage des Apostolats erörtert. Die Diskussion beleuchtet verschiedene Perspektiven und untersucht, ob die Gemeinde eine Rolle bei der Beauftragung von Aposteln spielt. Der Abschnitt beleuchtet die unterschiedlichen Aspekte der Legitimation und die daraus resultierenden verschiedenen Konzepte des Apostelamt. Es werden mögliche Verbindungen zwischen irdischer Berufung, Wirken des Heiligen Geistes und Gemeinde-Anerkennung erörtert, um ein umfassendes Bild der Legitimation des Apostelamt zu zeichnen.
III Sendung mit Beauftragung: Dieses Kapitel analysiert die apostolische Praxis, indem es den Auftrag des Apostels untersucht. Es befasst sich mit der Evangeliumsverkündigung, dem Zeugnis ablegen, der Gemeindegründung und -leitung, dem Recht auf Unterhalt, dem Vollbringen von Zeichen und Wundern und schließlich der Auseinandersetzung mit Schwachheit und Leiden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Handlungsweise und den Verantwortlichkeiten der Apostel. Das Kapitel analysiert, wie diese verschiedenen Aspekte des apostolischen Auftrags miteinander verwoben sind und welche Rolle sie im Gesamtverständnis des Apostelamt spielen. Es wird ein detailliertes Bild des apostolischen Wirkens gezeichnet, das die verschiedenen Facetten dieses Dienstes umfasst. Es zeigt auf, wie die beschriebenen Aufgaben und Herausforderungen das Leben eines Apostels prägten.
Schlüsselwörter
Apostel, Paulus, Lukas, Neues Testament, Berufung, Sendung, Legitimation, Evangelium, Gemeinde, Charisma, Amt, Dienst, Zeugnis, Mission.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Apostelbegriff bei Paulus und Lukas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit untersucht und vergleicht das Verständnis des Apostelbegriffs bei den neutestamentlichen Autoren Paulus und Lukas. Im Fokus stehen die jeweiligen Kriterien, die begrifflichen und personellen Abgrenzungen sowie mögliche Spannungen und Widersprüche zwischen beiden Konzepten.
Welche Aspekte des Apostelbegriffs werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten des Apostelbegriffs, darunter die Legitimation des Amtes (Berufung durch Jesus, den Heiligen Geist oder die Gemeinde), den apostolischen Auftrag (Evangeliumsverkündigung, Zeugnisablegen, Gemeindegründung und -leitung), charakteristische Merkmale des apostolischen Lebens (Recht auf Unterhalt, Zeichen und Wunder, Schwachheit und Leiden), sowie einen Vergleich der paulinischen und lukanischen Sichtweisen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die den Forschungsgegenstand einführt und die zentrale Fragestellung formuliert; ein Kapitel zur Legitimation des Apostelamt (Berufung); ein Kapitel zur Sendung und Beauftragung der Apostel (Auftrag); und abschließend ein Kapitel, das die Ergebnisse zusammenfasst und den Apostelbegriff im Kontext der Untersuchung reflektiert.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung definiert den Forschungsgegenstand und stellt die zentrale Frage nach dem Verständnis des Apostelbegriffs im frühen Christentum. Sie beleuchtet die Verwendung des Begriffs "Apostel" im Neuen Testament, insbesondere bei Paulus und Lukas, und vergleicht ihn mit der Verwendung in der profangriechischen Literatur. Die Einleitung hebt die Schwierigkeiten hervor, den urchristlichen Apostelbegriff präzise zu definieren, und skizziert die Ziele der Arbeit: Analyse der Konzepte von Paulus und Lukas und den Vergleich ihrer Kriterien und Abgrenzungen.
Wie wird die Legitimation des Apostelamt behandelt?
Das Kapitel zur Legitimation diskutiert verschiedene Aspekte der Berufung: Berufung durch den irdischen Jesus, durch Erscheinungen des Auferstandenen, durch Offenbarungen Jesu Christi, die Rolle des Heiligen Geistes und des Charismas, sowie die mögliche Rolle der Gemeinde bei der Beauftragung. Es beleuchtet unterschiedliche Perspektiven und versucht, ein umfassendes Bild der Legitimation zu zeichnen.
Was beinhaltet das Kapitel zur Sendung und Beauftragung?
Das Kapitel zur Sendung analysiert die apostolische Praxis, insbesondere die Evangeliumsverkündigung, das Zeugnisablegen, die Gemeindegründung und -leitung, das Recht auf Unterhalt, das Vollbringen von Zeichen und Wundern, sowie die Auseinandersetzung mit Schwachheit und Leiden. Es untersucht die Verknüpfung dieser Aspekte und deren Rolle im Gesamtverständnis des Apostelamt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Apostel, Paulus, Lukas, Neues Testament, Berufung, Sendung, Legitimation, Evangelium, Gemeinde, Charisma, Amt, Dienst, Zeugnis, Mission.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und gibt eine Antwort auf die Forschungsfrage nach dem Verständnis des Apostelbegriffs bei Paulus und Lukas. Es beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren jeweiligen Konzepten.
- Citar trabajo
- Janina Serfas (Autor), 2017, Was ist ein Apostel? Antworten bei Paulus und Lukas, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1021847