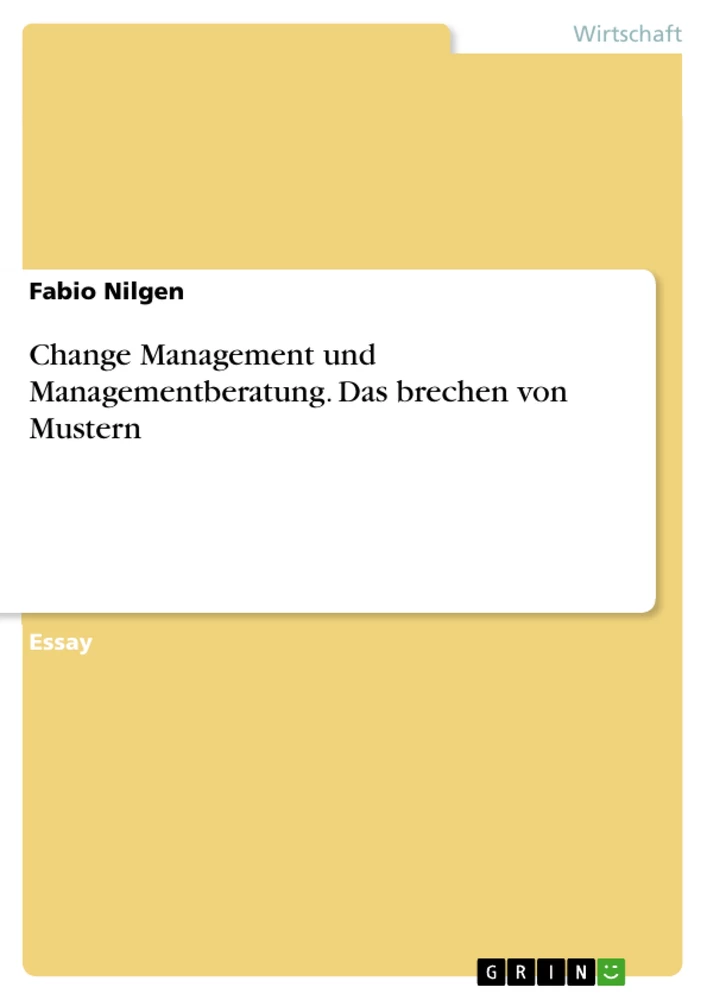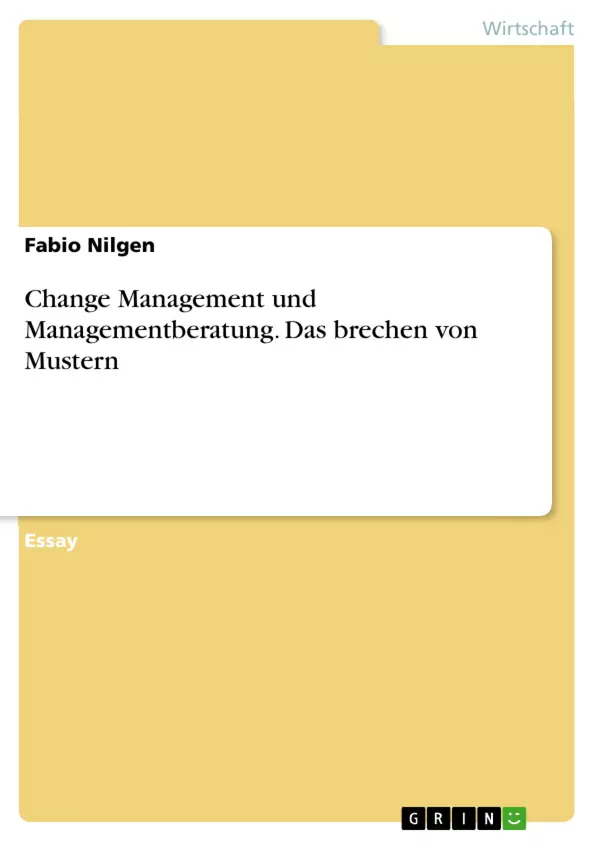Ziel dieser Arbeit ist es nicht, optimale Handlungsalternativen des Managements zur Veränderung beizubringen, sondern durch Gedankenexperimente bestehende Führungsmuster kritisch zu hinterfragen. Dabei geht es nicht um eine "Richtig-oder-Falsch-Betrachtung", sondern darum durch einen bewussten "Musterbruch" neue Erfahrungswelten zu öffnen. Die Erkenntnis über die Begrenztheit bestehender Muster, und die draus entstehende Verhaltens-/Haltungsänderungen und weniger "mehr desselben", sind das Ergebnis.
Managementkonzepte gelten in der Unternehmenswelt als vernünftig, konsistent und geordnet. Organisationen sind jedoch keine trivialen Maschinen, sondern stellen komplexe Systeme dar und Veränderungsprogramme sind daher schwierig umzusetzen. "Die Welt der Ideen und die Welt der Handlungen“ zusammenzubringen gestaltet sich schwierig und ist eventuell sogar gar nicht erwünscht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Nicht-Steuerbarkeit steuern
- 2.1. Irritationen
- 2.2. Inspirationen
- 3. Vertrauter Kontrolle misstrauen
- 3.1. Irritationen
- 3.2. Inspirationen
- 4. Vielfalt standardisieren
- 4.1. Irritationen
- 4.2. Inspirationen
- 5. Reaktionen einer Drittperson
- 6. Selbstreflexion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Lernbericht befasst sich mit der Herausforderung, Veränderungsprogramme in Organisationen erfolgreich zu implementieren. Der Text analysiert die Grenzen der Steuerbarkeit und Kontrolle in komplexen Systemen und erörtert die Bedeutung von Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit im Kontext von Veränderungsprozessen.
- Die Illusion von vollständiger Steuerbarkeit in der Praxis
- Die Bedeutung von implizitem Wissen und Irrationalität in Organisationsprozessen
- Die Grenzen von Managementkonzepten und die Notwendigkeit eines "Musterbruchs"
- Die Rolle von Gedankenexperimenten für die Entwicklung neuer Perspektiven
- Die Förderung von Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit als Schlüsselfaktor für erfolgreiche Veränderungsprozesse
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Schwierigkeit, Veränderungsprogramme in Organisationen erfolgreich zu implementieren, und stellt die zentrale These des Textes vor: Die Illusion der vollständigen Steuerbarkeit und Kontrolle. Die Einleitung greift auf die Erkenntnisse von Brunsson (2009) zurück, um die Komplexität von Organisationen und die Bedeutung von implizitem Wissen und Irrationalität im Kontext von Veränderungsprozessen zu beleuchten.
Kapitel 2: Nicht-Steuerbarkeit steuern
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der scheinbar unvereinbaren Aufgabe, das Nicht-Steuerbare zu steuern. Der Autor reflektiert die eigenen Erfahrungen im Studium der Wirtschaftswissenschaften, die eine scheinbar deterministische Sicht auf Organisationen fördern, und kontrastiert dies mit der Notwendigkeit von Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit.
Kapitel 3: Vertrauter Kontrolle misstrauen
Kapitel 3 setzt sich mit der Notwendigkeit auseinander, etablierten Kontrollmechanismen zu misstrauen und die Bedeutung von Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Der Autor reflektiert, wie Irritationen durch die Konfrontation mit den Grenzen der Steuerung und Kontrolle neue Perspektiven eröffnen können.
Kapitel 4: Vielfalt standardisieren
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Herausforderung, Vielfalt und Individualität in komplexen Systemen zu standardisieren. Es werden Irritationen und Inspirationen im Kontext der Standardisierung von Prozessen und Strukturen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Lernberichts umfassen Change Management, Managementberatung, Steuerbarkeit, Kontrolle, Selbststeuerung, Eigenverantwortlichkeit, Gedankenexperimente, Musterbruch, Implizites Wissen, Irrationalität, Veränderungsprogramme, Organisationstheorie, und wirtschaftliche Steuerung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieses Lernberichts zum Change Management?
Ziel ist es, bestehende Führungsmuster kritisch zu hinterfragen und durch einen bewussten „Musterbruch“ neue Perspektiven für Veränderungsprozesse zu eröffnen.
Warum sind Veränderungsprogramme in Organisationen oft schwierig?
Organisationen sind komplexe Systeme und keine trivialen Maschinen; daher lässt sich Veränderung nicht einfach deterministisch steuern.
Was bedeutet „Nicht-Steuerbarkeit steuern“?
Es beschreibt die Herausforderung, in komplexen Systemen durch Irritationen und Inspirationen Selbststeuerung und Eigenverantwortung zu fördern, anstatt auf starre Kontrolle zu setzen.
Welche Rolle spielt implizites Wissen in Organisationen?
Implizites Wissen und oft „irrationale“ Handlungen prägen den Organisationsalltag stärker als formale Managementkonzepte.
Was ist ein „Musterbruch“?
Ein Musterbruch ist das bewusste Verlassen gewohnter Handlungsweisen, um neue Erfahrungswelten und Lösungen jenseits von „mehr desselben“ zu finden.
- Citar trabajo
- Fabio Nilgen (Autor), 2017, Change Management und Managementberatung. Das brechen von Mustern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1031794