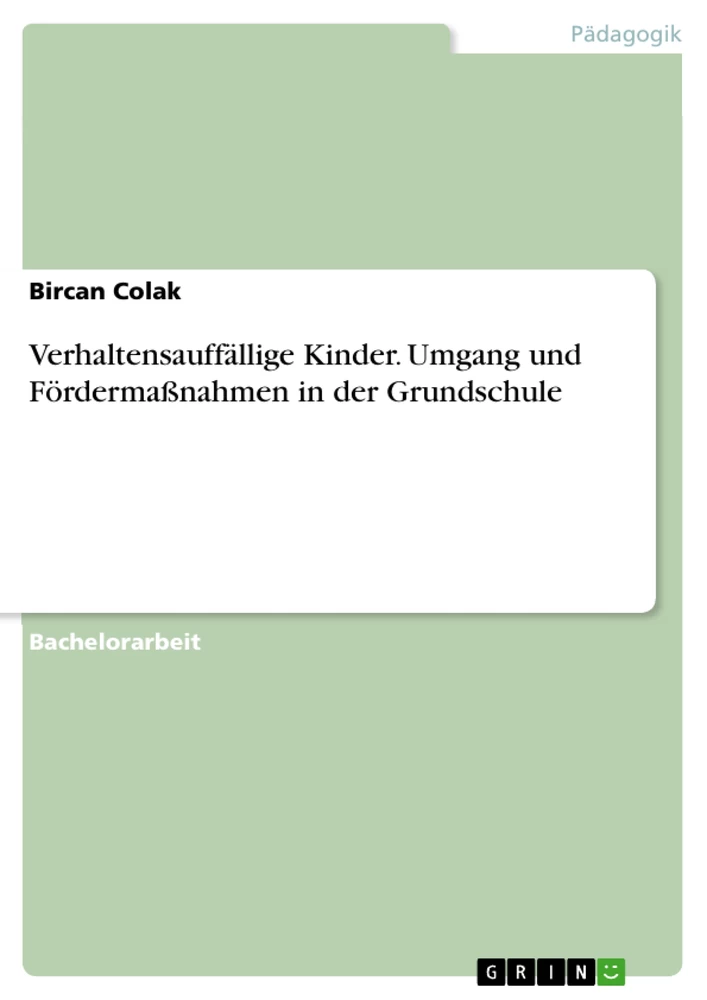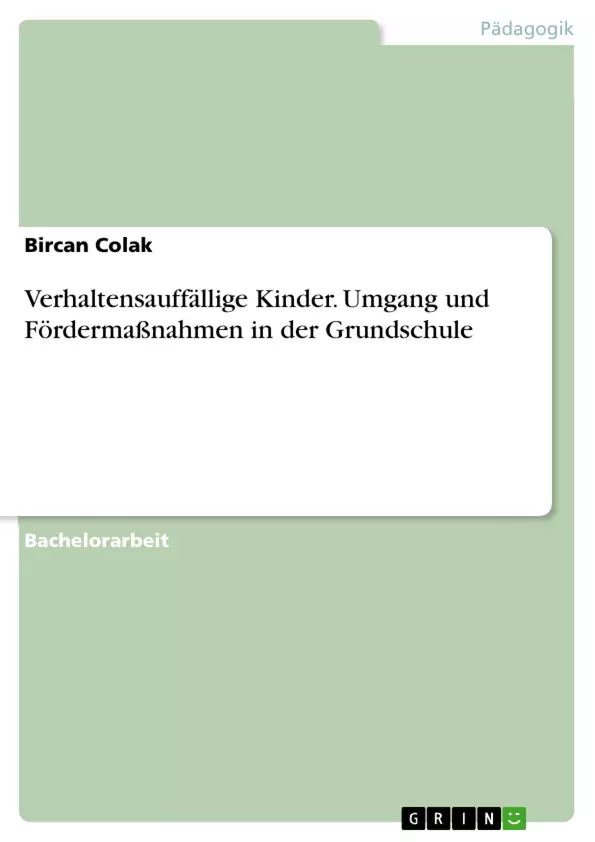Mit dem Ziel, die angewandten Methoden der Fachkräfte auf verhaltensauffällige Grundschüler zu untersuchen, beschäftigt sich die vorliegende Literaturarbeit zunächst mit der Entwicklung des Kindes. Daraus erschließt sich der Bezug zu Verhaltensauffälligkeiten, die anhand des Kriterienkatalogs des DSM diagnostiziert werden. Die Schulsozialarbeit ist ein Arbeitsfeld, dass unter anderem Interventionsmaßnahmen bezüglich Verhaltensauffälligkeit ergreift.
Allerdings bleibt offen, welche Konzepte oder Methoden im Schulalltag von Gebrauch sind. Hierzu werden Methoden des Verhaltensaufbaus und Verhaltensabbaus deskriptiv vorgestellt und interpretiert. Dabei erschließt sich, dass es im Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern keine einheitliche Formel gibt, um Verhalten positiv zu stärken. Dennoch ist durch Verhaltensaufbau, insbesondere Verstärkerpläne möglich, innerhalb eines bestimmten Ausmaßes Kindern positive Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein, Selbstbewusstsein und Selbstreflexion mitzugeben.
Das dazugehörige Belohnungssystem ist mit Bedacht einzusetzen und sollte nicht zur Gewohnheit werden. Die Methoden sind individuell anpassbar und können verändert werden, damit sie auf Dauer nicht die Attraktivität für das Kind verliert. Darüber hinaus ist Verhaltensauffälligkeit zu einem wichtigen Thema in der heutigen Gesellschaft geworden. Es ist durchaus möglich, dass die Soziale Arbeit sich im Hinblick dieses Feldes weiterentwickelt und bereichert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Themeneingrenzung und Aufbau
- Vorgehensweise
- Die Entwicklung
- Entwicklung als sozialer Prozess
- Normen
- Sozialisation
- Entwicklung der Persönlichkeit
- Entwicklungsaufgaben im Grundschulalter
- Verhaltensauffälligkeiten
- Das Klassifikationssystem
- Zusatzcodierung
- Inklusion von Heterogenität
- Sprechen und Kooperieren
- Schulsozialarbeit
- Methoden des Verhaltensaufbaus und Verhaltensabbaus
- Methoden des Verhaltensaufbaus
- Verstärkerplan
- Verstärker-Entzugs-Systeme
- Methode des Verhaltensabbaus
- Diskussion
- Interpretation von Verhaltensaufbau und Verhaltensabbau
- Limitation
- Bezug zur Sozialen Arbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Untersuchung der angewandten Methoden von Fachkräften im Umgang mit verhaltensauffälligen Grundschulkindern. Zunächst wird die Entwicklung des Kindes analysiert, um den Zusammenhang zu Verhaltensauffälligkeiten zu verstehen, die anhand des DSM-Kriteriensteckbriefs diagnostiziert werden können. Die Schulsozialarbeit als Arbeitsfeld, das sich mit Interventionsmaßnahmen gegen Verhaltensauffälligkeiten befasst, steht im Mittelpunkt. Die Arbeit analysiert, welche Konzepte und Methoden in der schulischen Praxis eingesetzt werden, wobei insbesondere Methoden des Verhaltensaufbaus und -abbaus deskriptiv vorgestellt und interpretiert werden.
- Entwicklung des Kindes und Verhaltensauffälligkeiten
- Diagnostik von Verhaltensauffälligkeiten anhand des DSM
- Interventionen in der Schulsozialarbeit
- Methoden des Verhaltensaufbaus und -abbaus
- Relevanz von Verhaltensauffälligkeiten in der heutigen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und stellt die Motivation, Themeneingrenzung, den Aufbau und die Vorgehensweise dar. Kapitel 2 widmet sich der Entwicklung des Kindes, sowohl als sozialer Prozess mit Fokus auf Normen und Sozialisation, als auch als Entwicklung der Persönlichkeit. Hier werden insbesondere Entwicklungsaufgaben im Grundschulalter betrachtet. Zudem beleuchtet das Kapitel Verhaltensauffälligkeiten im Kontext des DSM-Kriteriensteckbriefs und befasst sich mit der Inklusion von Heterogenität und der Rolle der Schulsozialarbeit.
Kapitel 3 fokussiert auf Methoden des Verhaltensaufbaus und -abbaus. Hier werden verschiedene Verfahren wie Verstärkerpläne und Verstärker-Entzugs-Systeme vorgestellt und interpretiert.
Die Diskussion in Kapitel 4 analysiert die Interpretation von Verhaltensaufbau und -abbaus und beleuchtet die Limitationen der vorgestellten Methoden. Außerdem wird der Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Verhaltensauffälligkeit, Grundschulkinder, Entwicklung, Verhaltensaufbau, Verhaltensabbau, DSM-Kriteriensteckbrief, Schulsozialarbeit.
- Arbeit zitieren
- Bircan Colak (Autor:in), 2021, Verhaltensauffällige Kinder. Umgang und Fördermaßnahmen in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1034616