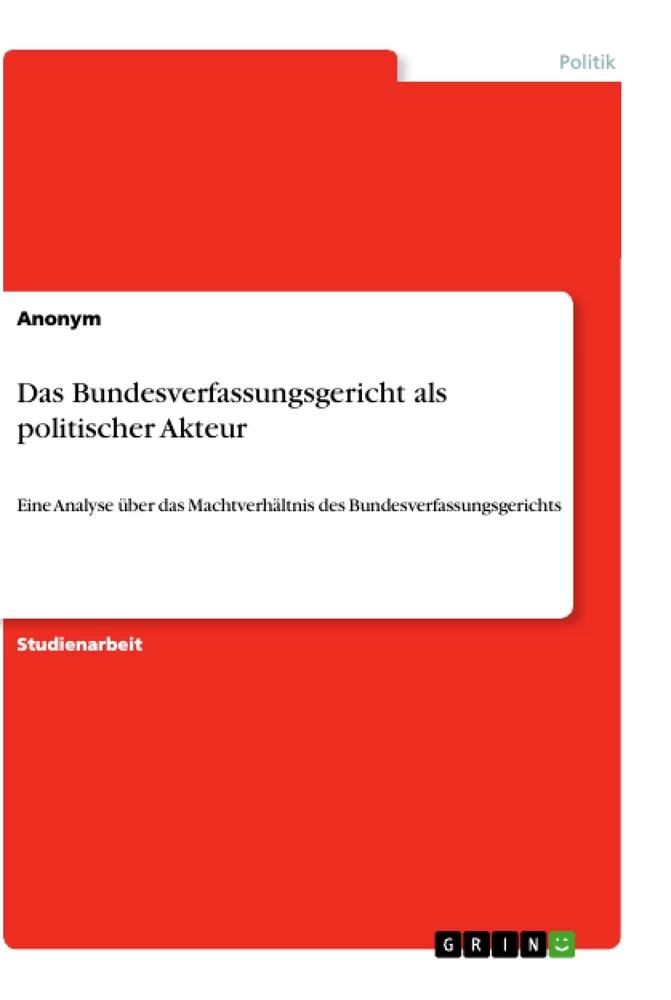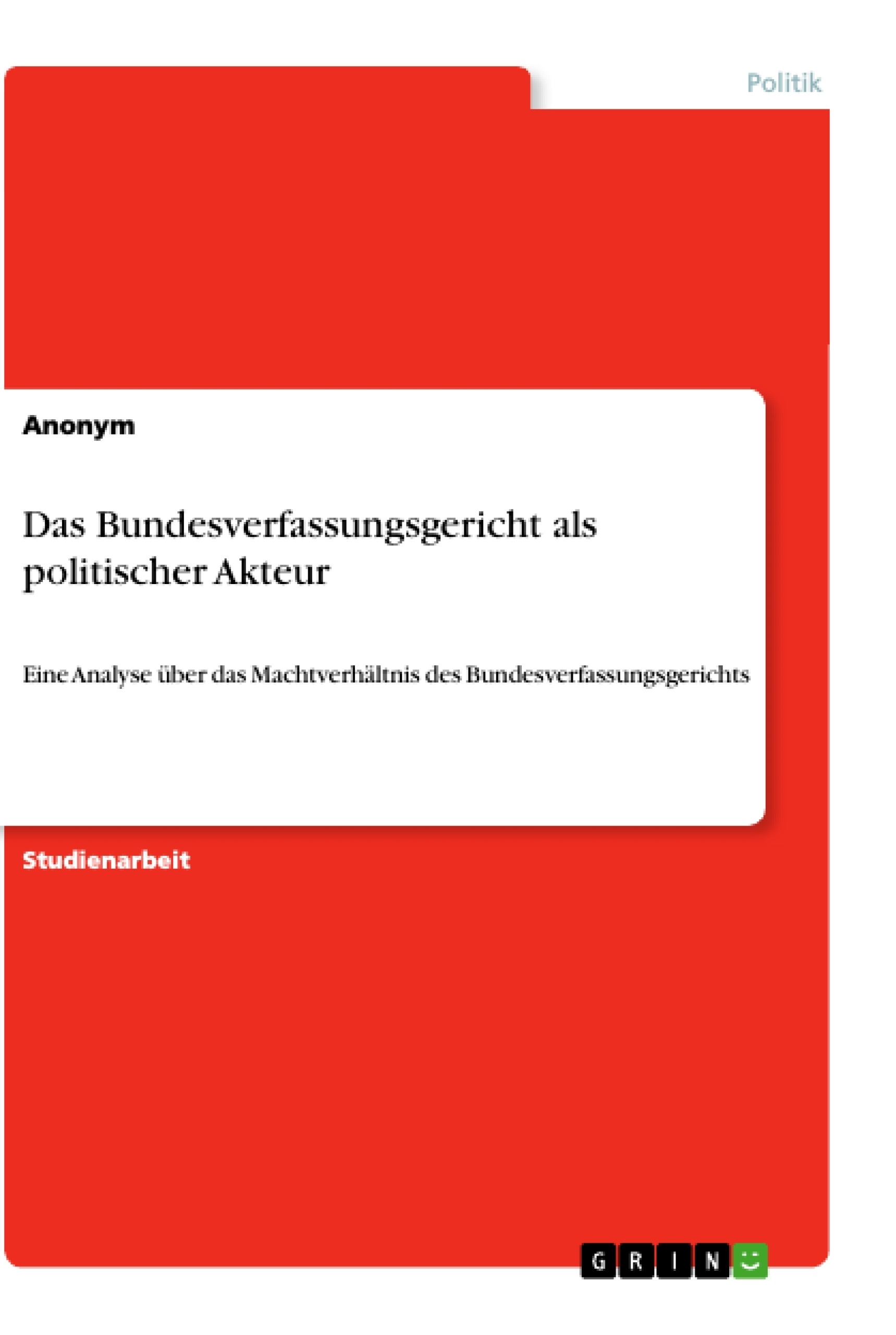Im Rahmen dieser Hausarbeit soll analysiert werden, warum das Bundesverfassungsgericht über so viel Macht verfügt und ob es sich bei dieser Macht um eine Vetomacht handelt. In diesem Zusammenhang ist die Vetospielertheorie von George Tsebelis primär in Bezug auf die Verfassungsgerichtsbarkeit von Interesse. Durch diese Vorgehensweise eröffnen sich jedoch zwei Probleme für die weitere Analyse: Zum einen ist in der politikwissenschaftlichen Literatur höchst umstritten, ob Verfassungsgerichte als klassische Vetospieler eingeordnet werden können. Zum anderen bezieht sich die Fragestellung dieser Arbeit ausschließlich auf das Bundesverfassungsgericht in Deutschland, wodurch der Theorieansatz nicht in einer systemvergleichenden Perspektive genutzt werden kann.
Anhand der theoretischen Ansätze von Tsebelis, Kaiser und Abromeit/Stoiber soll der ersten Frage nachgegangen werden, um eine Klassifizierung der Verfassungsgerichtsbarkeit in das theoretische Konstrukt der Vetospieleridee zu ermöglichen. Hierfür wird zunächst auf die Vetospielertheorie nach Tsebelis eingegangen und in der Betrachtung des Vetospielers im politischen System spezifiziert. Abschließend erfolgt eine Auswertung der Analyse im Fazit zu folgender Fragestellung: Warum verfügt das Bundesverfassungsgericht über so viel Macht und handelt es sich hierbei um eine Vetomacht?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Vetospielertheorie nach Tsebelis
- 1. Grundlagen der Vetospielertheorie
- 2. Vetospieler im politischen System
- 3. Hypothesen zu Verfassungsgerichten nach Tsebelis
- III. Das Bundesverfassungsgericht
- 1. Grundzüge und Arbeitsweise
- 2. Macht und Einfluss des Bundesverfassungsgerichts
- IV. Analyse des Bundesverfassungsgerichts als Vetospieler
- 1. Anwendung der Vetospielertheorie am BVerfG
- 2. Vergleich zwischen dem BVerfG und anderen Vetospielern der BRD
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die Macht des Bundesverfassungsgerichts und untersucht, ob es sich dabei um eine Vetomacht handelt. Dabei steht die Vetospielertheorie von George Tsebelis im Vordergrund, die insbesondere auf die Verfassungsgerichtsbarkeit angewandt wird. Die Arbeit beleuchtet dabei zwei zentrale Problemstellungen: Erstens, ob Verfassungsgerichte tatsächlich als klassische Vetospieler betrachtet werden können, und zweitens, ob die Erkenntnisse aus der Vetospielertheorie auf das Bundesverfassungsgericht in Deutschland übertragen werden können.
- Anwendung der Vetospielertheorie auf die Verfassungsgerichtsbarkeit
- Analyse der Macht des Bundesverfassungsgerichts
- Einordnung des Bundesverfassungsgerichts als Vetospieler
- Vergleich des BVerfG mit anderen Vetospielern in Deutschland
- Bewertung der Vetomacht des Bundesverfassungsgerichts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die zentrale Fragestellung nach der Macht des Bundesverfassungsgerichts und seinem möglichen Vetospielerstatus vor. Kapitel II beleuchtet die Vetospielertheorie nach Tsebelis, inklusive der Grundlagen, der Definition von Vetospielern und der Bedeutung von Vetospielern im politischen System. Kapitel III widmet sich dem Bundesverfassungsgericht, seinen Grundzügen, seiner Arbeitsweise und seinem Einfluss im deutschen politischen System. Schließlich wendet Kapitel IV die Vetospielertheorie auf das Bundesverfassungsgericht an, analysiert seine Stellung als Vetospieler im Vergleich zu anderen Akteuren und bewertet die Vetomacht des Gerichts.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie der Vetospielertheorie, dem Bundesverfassungsgericht, der Verfassungsgerichtsbarkeit, der Macht und dem Einfluss von Institutionen im politischen System sowie der Analyse von Entscheidungsfindungsprozessen im Rahmen der Politikwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
Ist das Bundesverfassungsgericht ein politischer Akteur?
Ja, die Arbeit analysiert, inwiefern das Gericht durch seine Entscheidungen maßgeblichen Einfluss auf die Politik nimmt und als mächtiger Akteur im System agiert.
Was besagt die Vetospielertheorie von George Tsebelis?
Sie besagt, dass politische Veränderungen nur möglich sind, wenn eine bestimmte Anzahl von Akteuren (Vetospielern) zustimmt. Die Arbeit prüft, ob das BVerfG ein solcher Vetospieler ist.
Warum hat das Bundesverfassungsgericht so viel Macht?
Die Macht resultiert aus der Kompetenz, Gesetze für nichtig zu erklären und die Verfassung verbindlich auszulegen, was politische Spielräume einschränken kann.
Handelt es sich beim BVerfG um eine „Vetomacht“?
Die Arbeit untersucht diese Frage kritisch, da das Gericht meist erst im Nachhinein agiert, aber durch seine Rechtsprechung zukünftige Gesetzgebung blockieren kann.
Wie unterscheidet sich das BVerfG von anderen Vetospielern?
Im Gegensatz zu Parteien oder dem Bundesrat agiert das Gericht auf Basis rechtlicher Normen, auch wenn die Auswirkungen seiner Urteile hochpolitisch sind.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Das Bundesverfassungsgericht als politischer Akteur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037262