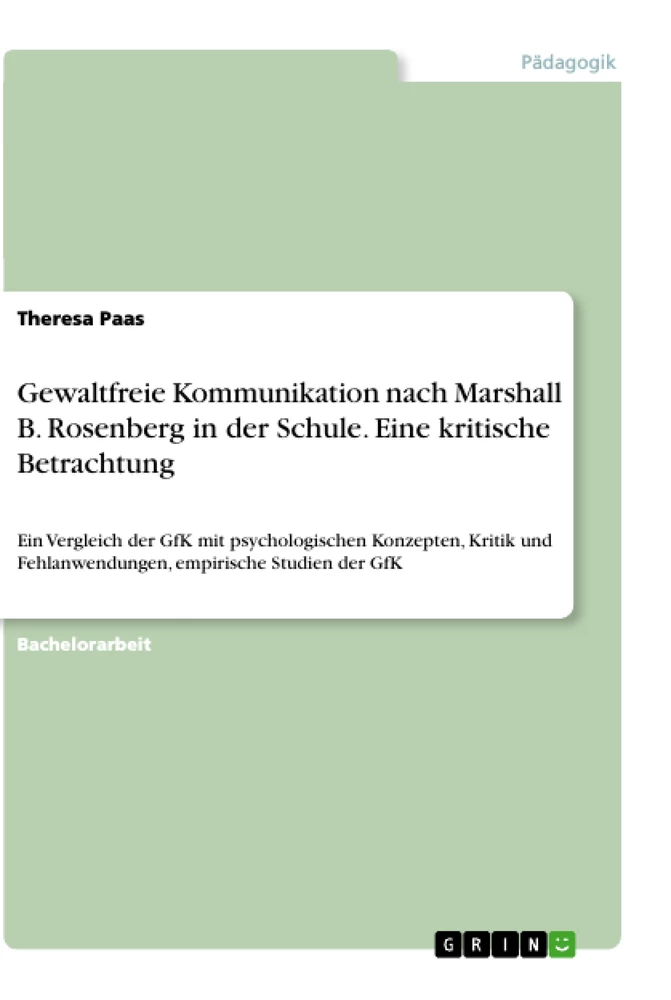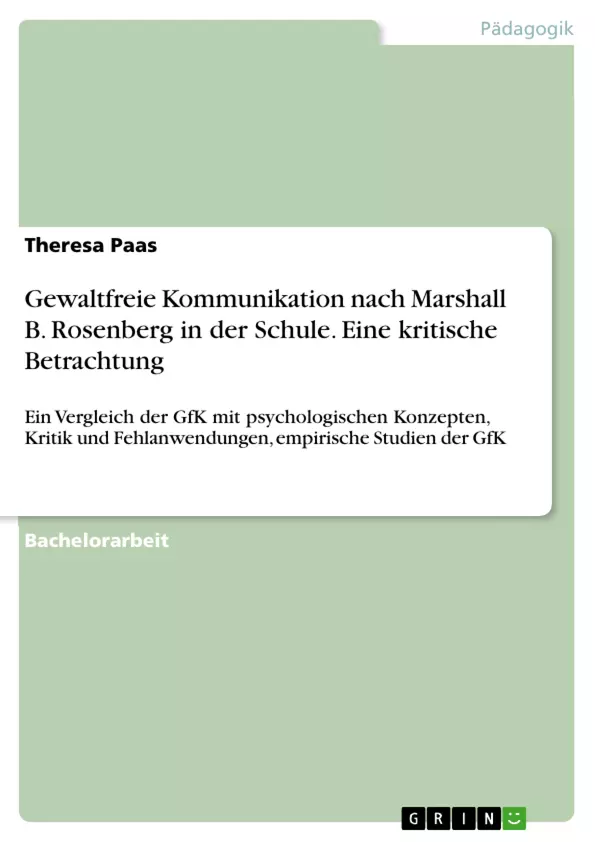Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage: Wie können LehrerInnen die Gewaltfreie Kommunikation von Marshall B. Rosenberg an Schulen anwenden?
Es wird gezeigt, durch welche psychologischen Konzepte und empirische Studien die Gewaltfreie Kommunikation bewiesen wird, wie sie an Schulen konkret anwendbar ist, welche Herausforderungen sich ergeben und wie die empirische Studienlage über die GfK ist.
LehrerInnen wird beantwortet: Wie kann ich die GfK in meiner Schule anwenden? Welche Fehlanwendungen können mir oder meinen Schülern dabei unterlaufen? Warum steigert sie die Motivation der SchülerInnen, verbessert meine Beziehung zu ihnen und steigert ihre Leistungen? Welche wissenschaftlichen Studien gibt es über die GfK und was beweisen sie?
Lehrerinnen und Lehrer erhalten laut der Allgemeinen Dienstordnung für Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen den Auftrag, ihre Schüler zu erziehen und ihre Leistungen zu beurteilen: „Es gehört zum Beruf der Lehrerinnen und Lehrer, in eigener Verantwortung und pädagogischer Freiheit die Schülerinnen und Schüler zu erziehen, zu unterrichten, zu beraten, zu beurteilen, zu beaufsichtigen und zu betreuen.“
Dabei bestehen Erziehungsmethoden häufig daraus, Schülern Verhaltensregeln aufzuerlegen und diese mit Belohnung und Bestrafung durchzusetzen, ihnen Befehle zu erteilen und ihnen beizubringen, sich den Urteilen der Lehrpersonen unterzuordnen. Diese Urteile beschränken sich oftmals nicht nur auf die Vergabe von Noten: Schülern werden Lernschwächen diagnostiziert oder sie können etwa als „Schüler mit einer langsamen Auffassungsgabe“ bezeichnet werden.
Der US-amerikanische Psychologe Marshall B. Rosenberg (1934-2015) erklärt, diese autoritären Verhaltensweisen seien Formen der nicht-physischen Gewalt. Urteile und Befehle können unsere Beziehung zu den Schülern verschlechtern, sie demotivieren und ihrem Selbstbild schaden.
Mit seiner Gewaltfreien Kommunikation (GfK) versucht er einen Weg aufzuzeigen, Schüler nicht mehr zu verurteilen, sondern ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und einfühlsam auf sie einzugehen. Die GfK verspricht, die Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern zu bereichern, Konflikte zu lösen und die Bedürfnisse aller Beteiligten zu erfüllen. Außerdem kann sie das Lernklima verbessern, die Motivation der Schüler fördern und ihren Selbstwert stärken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Gewaltfreie Kommunikation
- 2.1 Gewaltfreie Selbstoffenbarung
- 2.1.1 Beobachtungen ohne Bewertung
- 2.1.2 Gefühle ohne Interpretationen
- 2.2 Empathisch aufnehmen
- 2.3 Mediation
- 2.4 Die Haltung der Gewaltfreien Kommunikation
- 3 Fehlanwendungen der GfK
- 3.1 Die instinktiv-magische Ebene
- 3.2 Die egozentrische Ebene
- 3.3 Die konformistische Ebene
- 3.4 Die rationale Ebene
- 3.5 Die pluralistische Ebene
- 3.6 Die integrative Ebene
- 4 Selbstreflexion
- 4.1 Reflexion unserer Bewertungen
- 4.2 Reflexion unserer Gefühle und Bedürfnisse
- 5 Bedarf an empirischer Forschung über den Erfolg der GfK
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Anwendung der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marshall Rosenberg im schulischen Kontext. Ziel ist es, Lehrkräften praktische Hilfestellungen zur erfolgreichen Anwendung der GfK zu geben und potenzielle Herausforderungen zu beleuchten.
- Gewaltfreie Selbstoffenbarung als Grundlage der GfK
- Empathisches Zuhören und die Bedeutung der Perspektivübernahme
- Mediation als Konfliktlösung mittels GfK
- Herausforderungen und Fehlanwendungen der GfK
- Der Bedarf an empirischer Forschung zur Wirksamkeit der GfK
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Auftrag von Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen, die oft autoritäre Erziehungsmethoden beinhalten. Sie führt die Gewaltfreie Kommunikation (GfK) als Alternative ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der erfolgreichen Anwendung der GfK an Schulen. Der Fokus liegt auf der Relevanz der Thematik aufgrund der vielversprechenden positiven Effekte der GfK auf das Lernklima, die Motivation und den Selbstwert der Schüler.
2 Gewaltfreie Kommunikation: Dieses Kapitel erklärt die vier Komponenten der GfK nach Rosenberg: Beobachtungen ohne Bewertung, Gefühle ohne Interpretationen, Bedürfnisse und Bitten statt Forderungen. Es werden psychologische Theorien wie die kognitive Dissonanz, erlernte Hilflosigkeit und selbsterfüllende Prophezeiungen herangezogen, um die negativen Auswirkungen von Urteilen und Befehlen zu untermauern. Zusätzlich wird das Konzept der Reaktanz erläutert, um die Wirksamkeit von Bitten gegenüber Befehlen zu begründen. Der Kapitel behandelt auch empathisches Zuhören und Mediation als Anwendung der GfK im Schulkontext. Schließlich wird die Bedeutung der Haltung der bedingungslosen Wertschätzung für den Erfolg der GfK hervorgehoben.
3 Fehlanwendungen der GfK: Dieses Kapitel befasst sich mit den Herausforderungen und Problemen bei der Anwendung der GfK. Es greift auf das Modell der Spiral Dynamics zurück, um verschiedene Bewusstseinsebenen zu beschreiben und zu erklären, warum die GfK auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich erfolgreich angewendet werden kann. Die sechs Entwicklungsstufen nach Fischer werden vorgestellt und mit entwicklungspsychologischen Forschungsergebnissen abgeglichen. Der Fokus liegt auf der Analyse möglicher Fehlschlüsse und Missverständnisse, die auf diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen auftreten können.
4 Selbstreflexion: Kapitel 4 betont die Bedeutung der Selbstreflexion für den erfolgreichen Einsatz der GfK. Es wird erläutert, wie frühere Verletzungen und Tendenzen die Anwendung der GfK behindern können (z.B. Bedürfnisse über- oder unterzustellen, Perfektionismus). Das Kapitel zeigt auf, wie die GfK zur Selbstreflexion genutzt werden kann und verweist auf das Konzept der Achtsamkeit als unterstützende Methode zur Steigerung der Empathie und besseren Bewertung von Reizen.
5 Bedarf an empirischer Forschung über den Erfolg der GfK: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die empirische Forschung zur Wirksamkeit der GfK bei Erwachsenen und Kindern/Jugendlichen. Es werden 19 empirische Studien kurz dargestellt und ihre Ergebnisse zusammengefasst. Der große Bedarf an weiterer qualitativer und quantitativer Forschung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Gewaltfreie Kommunikation (GfK), Marshall Rosenberg, Schule, Lehrer, Schüler, Konfliktlösung, Mediation, Empathie, Selbstreflexion, Achtsamkeit, Spiral Dynamics, Bewusstseinsebenen, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Gewaltfreie Kommunikation im Schulkontext
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Anwendung der Gewaltfreien Kommunikation (GfK) nach Marshall Rosenberg im schulischen Kontext. Sie zielt darauf ab, Lehrkräften praktische Hilfestellungen zur erfolgreichen Anwendung der GfK zu geben und potenzielle Herausforderungen zu beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gewaltfreie Selbstoffenbarung, empathisches Zuhören und Perspektivübernahme, Mediation als Konfliktlösung mittels GfK, Herausforderungen und Fehlanwendungen der GfK sowie den Bedarf an empirischer Forschung zur Wirksamkeit der GfK. Es werden verschiedene psychologische Theorien und das Modell der Spiral Dynamics herangezogen, um die Anwendung und Herausforderungen der GfK zu analysieren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Gewaltfreie Kommunikation (inkl. Selbstoffenbarung, Empathie und Mediation), Fehlanwendungen der GfK (inkl. Analyse verschiedener Bewusstseinsebenen nach Spiral Dynamics), Selbstreflexion, Bedarf an empirischer Forschung und Fazit. Jedes Kapitel fasst die wichtigsten Inhalte zusammen.
Was sind die vier Komponenten der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg?
Die vier Komponenten der GfK sind: Beobachtungen ohne Bewertung, Gefühle ohne Interpretationen, Bedürfnisse und Bitten statt Forderungen.
Welche psychologischen Theorien werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Theorien wie kognitive Dissonanz, erlernte Hilflosigkeit, selbsterfüllende Prophezeiungen und Reaktanz, um die Auswirkungen von Urteilen und Befehlen im Gegensatz zu Bitten zu verdeutlichen.
Wie wird das Modell der Spiral Dynamics in der Arbeit eingesetzt?
Das Modell der Spiral Dynamics wird verwendet, um verschiedene Bewusstseinsebenen zu beschreiben und zu erklären, warum die GfK auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich erfolgreich angewendet werden kann. Die sechs Entwicklungsstufen nach Fischer werden vorgestellt und mit entwicklungspsychologischen Forschungsergebnissen abgeglichen.
Welche Rolle spielt die Selbstreflexion in der Arbeit?
Die Selbstreflexion wird als essentiell für den erfolgreichen Einsatz der GfK hervorgehoben. Die Arbeit zeigt auf, wie frühere Verletzungen und Tendenzen die Anwendung der GfK behindern können und wie die GfK zur Selbstreflexion genutzt werden kann. Achtsamkeit wird als unterstützende Methode genannt.
Wie wird der Bedarf an empirischer Forschung dargestellt?
Die Arbeit gibt einen Überblick über 19 empirische Studien zur Wirksamkeit der GfK und betont den großen Bedarf an weiterer qualitativer und quantitativer Forschung, insbesondere im schulischen Kontext.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewaltfreie Kommunikation (GfK), Marshall Rosenberg, Schule, Lehrer, Schüler, Konfliktlösung, Mediation, Empathie, Selbstreflexion, Achtsamkeit, Spiral Dynamics, Bewusstseinsebenen, empirische Forschung.
Wo finde ich weitere Informationen?
(Hier könnten Sie einen Link zu einem Repository oder der vollständigen Arbeit hinzufügen, falls verfügbar)
- Quote paper
- Theresa Paas (Author), 2021, Gewaltfreie Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg in der Schule. Eine kritische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1037273