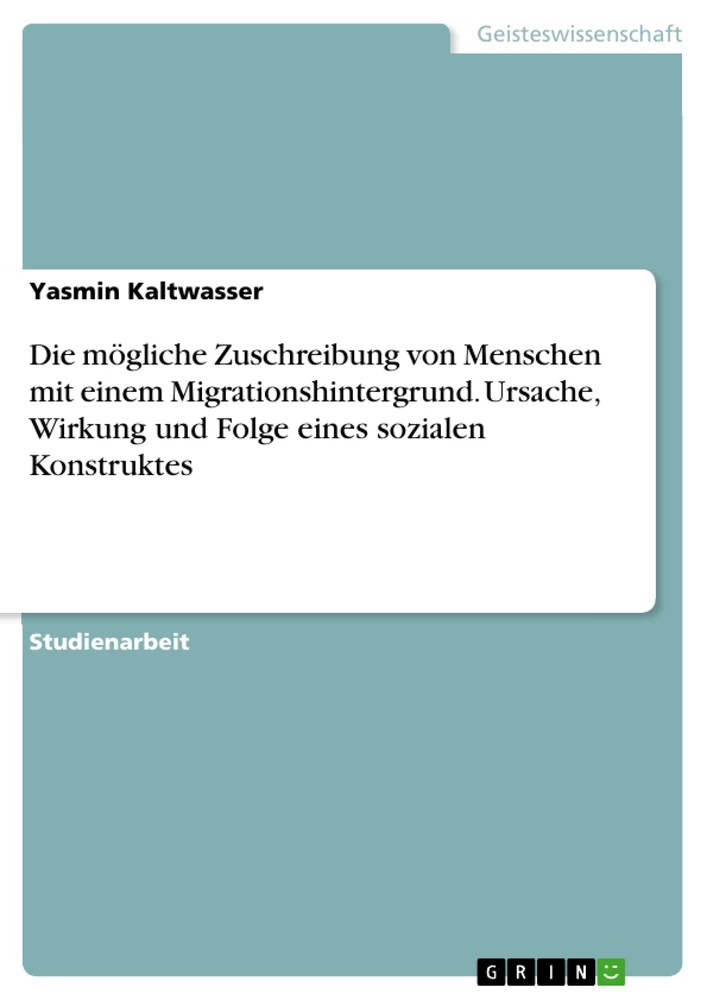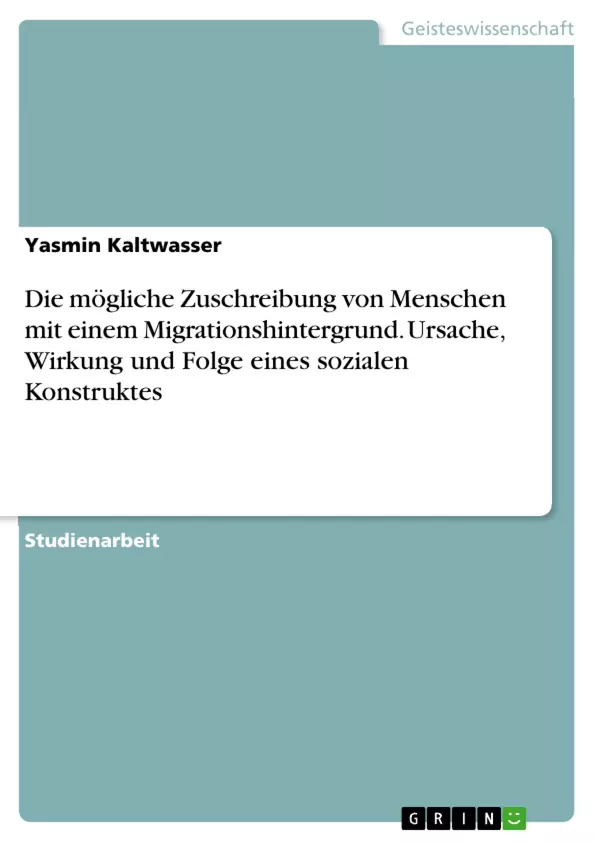In der Hausarbeit wird beschrieben, wie Menschen anderen Menschen mit Migrationshintergrund begegnen. Sie beschäftigt sich also mit der Fragestellung, wie Zuschreibungen hinsichtlich der Menschen mit Migrationshintergrund entstehen und welche Auswirkungen diese möglicherweise auf den einzelnen Menschen und das gesellschaftliche Zusammenleben haben. Die Begriffe "Migrationshintergrund" und "Ausländer:innen", werden in dieser Arbeit in Anführungszeichen gesetzt, da diese nicht als passende Ausdrücke empfunden werden.
Damit erkennbar wird, um welche Alltagsproblematik es geht, werden die Begriffe trotzdessen verwendet. Zunächst wird kurz die Einwanderungsgeschichte Deutschlands dargestellt, um den Prozess der Entstehung von gesellschaftlichen Verhältnissen, vor allem die der Migrationsbewegungen, deutlich zu machen. Danach wird näher darauf eingegangen, dass Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund oft als fremd oder anders empfunden werden, was auch sozial konstruiert wird. Daraufhin wird verdeutlich, welche Folgen dies auf einzelne Menschen und unsere Gesellschaft haben kann. Diese möglichen Folgen werden sodann beleuchtet. Des Weiteren wird die Bedeutung der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund aus der dritten Generation innerhalb der Gesellschaft aufgezeigt. Am Ende wird zu dem Thema Stellung genommen. Es wird der gesellschaftliche Anteil am Prozess der Entstehung von Migrationsbewegungen erläutert sowie eine eigene Perspektive dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kurzer Einstieg in die Einwanderungsgeschichte Deutschlands
- 3. Fremde Kultur als Andersartigkeit – Entstehung eines sozialen Konstruktes
- 4. Mögliche Folgen für Menschen mit „Migrationshintergrund“
- 4.1 Bedeutung und Wirkung für Menschen mit „Migrationshintergrund der zweiten und dritten Generation“
- 5. Fazit: Gesellschaftliche Aufgabe
- 5.1 Eigene Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entstehung von Zuschreibungen gegenüber Menschen mit „Migrationshintergrund“ und den möglichen Auswirkungen auf den Einzelnen sowie das gesellschaftliche Zusammenleben. Sie analysiert, wie diese Zuschreibungen entstehen und welche Folgen sie haben können. Dabei werden die Begriffe „Migrationshintergrund“ und „Ausländer:innen“ kritisch beleuchtet, da sie als ungeeignet empfunden werden.
- Die Entstehung von Zuschreibungen an Menschen mit „Migrationshintergrund“
- Die Rolle der Einwanderungsgeschichte Deutschlands in der Konstruktion von Andersartigkeit
- Die Auswirkungen von Zuschreibungen auf die Integration von Menschen mit „Migrationshintergrund“
- Die Bedeutung der Integration von Menschen mit „Migrationshintergrund der zweiten und dritten Generation“
- Die gesellschaftliche Verantwortung für die Entstehung von Zuschreibungen und die Förderung von Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Zuschreibungen an Menschen mit „Migrationshintergrund“ ein und stellt die statistischen Gegebenheiten sowie die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die Problematik der Begriffe „Migrationshintergrund“ und „Ausländer:innen“.
- Kapitel 2: Kurzer Einstieg in die Einwanderungsgeschichte Deutschlands
Dieses Kapitel skizziert die Einwanderungsgeschichte Deutschlands vom 19. bis zum 20. Jahrhundert, wobei es sowohl auf Ein- als auch Auswanderungsbewegungen eingeht. Es beschreibt die Rolle von Gastarbeitern, Fluchtbewegungen und den Wandel der deutschen Einwanderungspolitik.
- Kapitel 3: Fremde Kultur als Andersartigkeit - Entstehung eines sozialen Konstruktes
Dieses Kapitel behandelt die Konstruktion von „Fremdheit“ und „Andersartigkeit“ im Kontext kultureller Unterschiede. Es beleuchtet die Folgen dieser Zuschreibungen für die Integration von Menschen mit „Migrationshintergrund“.
- Kapitel 4: Mögliche Folgen für Menschen mit „Migrationshintergrund“
Dieses Kapitel analysiert die möglichen Folgen von Zuschreibungen für Menschen mit „Migrationshintergrund“, insbesondere die Auswirkungen auf ihre Integration und das gesellschaftliche Zusammenleben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: „Migrationshintergrund“, „Ausländer:innen“, Zuschreibungen, soziale Konstruktion, Andersartigkeit, Integration, Einwanderungsgeschichte, gesellschaftliche Verantwortung, Inklusion, Diskriminierung.
- Citar trabajo
- Yasmin Kaltwasser (Autor), 2021, Die mögliche Zuschreibung von Menschen mit einem Migrationshintergrund. Ursache, Wirkung und Folge eines sozialen Konstruktes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1040212