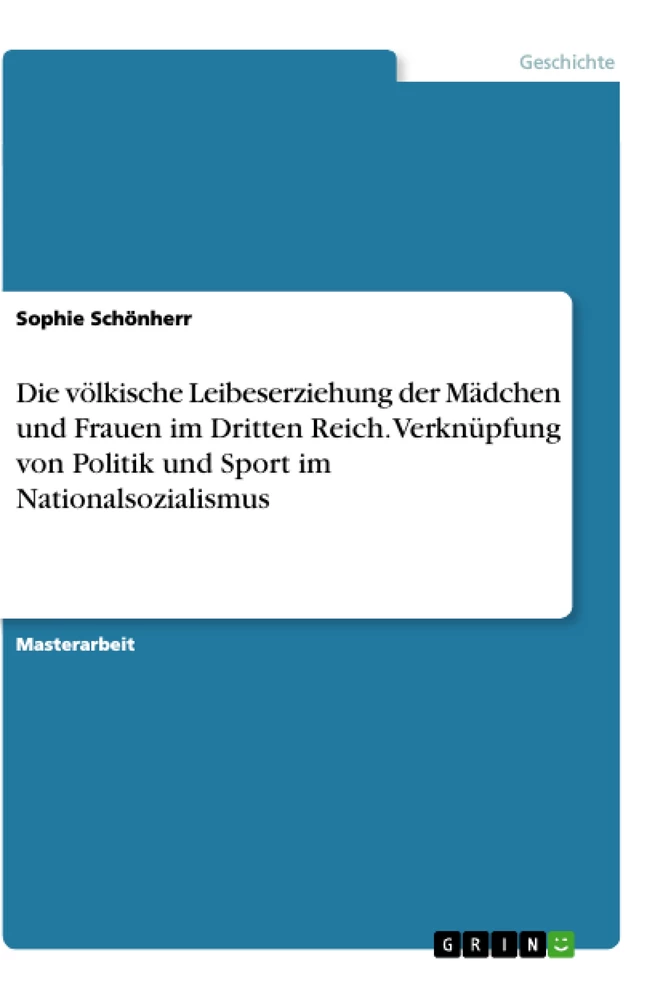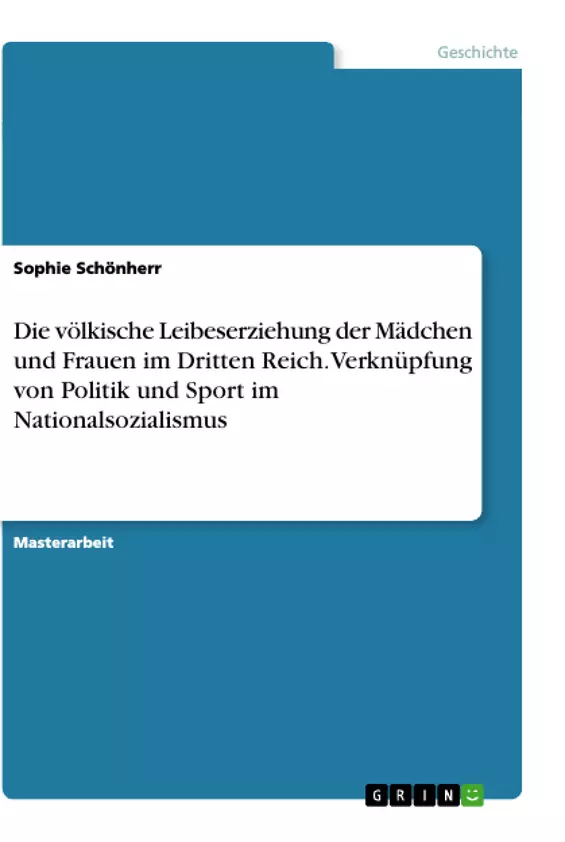Die Forschungsfrage dieser Masterarbeit ist, inwiefern die völkische Leibeserziehung der Mädchen und Frauen im Dritten Reich für die Zielführung der nationalsozialistischen Ideologie instrumentalisiert worden ist. Für die Darstellung und Ermittlung der völkischen Leibeserziehung werden der politikgeschichtliche und sportgeschichtliche Ansatz miteinander verknüpft. Damit wird sowohl die Auffassung der schulischen Leibeserziehung im Nationalsozialismus anhand historischer Sinn- und Wahrnehmungsstrukturen des Sports untersucht als auch gleichzeitig diese sporthistorische Wahrnehmung im Dritten Reich in Verbindung mit politisch handelnden Personen und staatlichen Maßnahmen gesetzt.
Inhaltlich werden zunächst die historischen Voraussetzungen der Leibeserziehung zur Zeit der Weimarer Republik erklärt, sodass eine Kontextualisierung der reformpädagogischen Leibeserziehung mit der völkischen Leibeserziehung der Mädchen und Frauen im Dritten Reich möglich ist. Daraufhin werden die ideologischen und bildungstheoretischen Grundsätze der Leibeserziehung dargelegt, wobei inhaltlich eine deutliche Abgrenzung zwischen der Leibeserziehung der Jungen und der Mädchen erfolgt.
Mit Beginn des vierten Kapitels startet der Schwerpunkt dieser Arbeit, indem die nationalsozialistischen Körperbilder, welche eng mit der nationalsozialistischen Leibeserziehung verbunden waren, erklärt werden. Hierbei steht das nationalsozialistische Rasseverständnis im Mittelpunkt, in welchem der arische Körper als Leitbild diente und der weibliche Körper auf die Funktion beschränkt wurde, gesunde Nachkommen zu gebären. In dem darauffolgenden Kapitel wird die hier zu untersuchende Forschungsfrage beantwortet, indem die schulsportlichen Vorgaben und Maßnahmen für Mädchen und Frauen im Verhältnis zur nationalsozialistischen Ideologie untersucht werden. Dabei werden die veränderten Zielstellungen, Inhalte und Methoden der Leibeserziehung betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Leibeserziehung in der Weimarer Republik
- Der Auftrag der politischen Leibeserziehung im Kontext der ideologischen und bildungstheoretischen Grundsätze der Nationalsozialisten
- Die schulisch-nationalsozialistische Leibeserziehung in Beziehung zu Adolf Hitlers weltanschaulichem Konzept
- Alfred Baeumlers erziehungstheoretische Auffassung einer politischen Leibeserziehung
- Die Beurteilung der Funktion der völkischen Leibeserziehung der Mädchen und Frauen in weiteren nationalsozialistischen Publikationen
- Die Rolle des Körpers in der nationalsozialistischen Leibeserziehung
- Der ,arische‘ Körper als Leitbild
- Das Rollenverständnis und der ,Auftrag‘ des weiblichen Körpers
- Die Inhalte und Methoden der schulischen Leibeserziehung im Dritten Reich
- Schulische Leibeserziehung an Jungenschulen
- Schulische Leibeserziehung an Mädchenschulen
- Die Leitlinien für die körperliche Erziehung der Mädchen
- Die inhaltliche Strukturierung der Leibeserziehung
- Die methodischen Empfehlungen
- Die besondere Rolle der Gymnastik- und Tanzerziehung
- Die Schwierigkeiten zur Umsetzung der nationalsozialistischen Leibeserziehung während der Kriegsvorbereitung und des Zweiten Weltkrieges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der völkischen Leibeserziehung der Mädchen und Frauen im Dritten Reich und untersucht, inwiefern diese für die Durchsetzung der nationalsozialistischen Ideologie instrumentalisiert wurde. Die Arbeit analysiert die theoretischen Grundlagen der nationalsozialistischen Leibeserziehung, insbesondere die Ansätze von Adolf Hitler und Alfred Baeumler, sowie die Verbreitung dieser Ideen in weiteren Publikationen der Zeit. Darüber hinaus beleuchtet sie die nationalsozialistischen Körperbilder und Rollenvorstellungen für Mädchen und Frauen im Sport und analysiert die Inhalte, Methoden und Ziele der schulischen Leibeserziehung in diesem Kontext. Die Arbeit untersucht auch die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der nationalsozialistischen Leibeserziehung während der Kriegsvorbereitung und des Zweiten Weltkrieges.
- Die Rolle der nationalsozialistischen Ideologie in der Gestaltung der Leibeserziehung für Mädchen und Frauen
- Die instrumentalisierung der Leibeserziehung für die Durchsetzung von rassistischen und antiemanzipatorischen Zielen
- Die Vermittlung von Geschlechterrollen und die Unterordnung des weiblichen Körpers unter das nationalsozialistische Frauenbild
- Die Auswirkungen der Kriegsvorbereitung und des Zweiten Weltkrieges auf die schulische Leibeserziehung
- Die Umsetzung der nationalsozialistischen Leibeserziehung in der Praxis, einschließlich der methodischen und inhaltlichen Vorgaben für den Sportunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und die Methodik der Arbeit erläutert. Anschließend wird die Leibeserziehung in der Weimarer Republik beleuchtet, um den historischen Kontext für die Entwicklung der nationalsozialistischen Leibeserziehung zu schaffen. Das dritte Kapitel widmet sich den ideologischen und bildungstheoretischen Grundlagen der nationalsozialistischen Leibeserziehung und analysiert die Ansätze von Adolf Hitler und Alfred Baeumler sowie weitere Publikationen der Zeit. Das vierte Kapitel untersucht die Rolle des Körpers in der nationalsozialistischen Leibeserziehung und analysiert das nationalsozialistische Körperbild und die Geschlechterrollen im Sport. Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Inhalten und Methoden der schulischen Leibeserziehung im Dritten Reich, wobei die Unterschiede zwischen der Leibeserziehung an Jungenschulen und Mädchenschulen hervorgehoben werden. Das sechste Kapitel untersucht die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der nationalsozialistischen Leibeserziehung während der Kriegsvorbereitung und des Zweiten Weltkrieges.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: völkische Leibeserziehung, nationalsozialistische Ideologie, Geschlechterrollen, Körperbild, Frauenbild, Instrumentalisierung, Rassenhygiene, Krieg, Sportunterricht, Gymnastik, Mädeltanz.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Ziel der völkischen Leibeserziehung für Mädchen im NS-Staat?
Das Ziel war die Instrumentalisierung des weiblichen Körpers zur Erfüllung der nationalsozialistischen Ideologie, insbesondere die Vorbereitung auf das Gebären "gesunder Nachkommen".
Wer waren die theoretischen Vordenker dieser Erziehung?
Neben Adolf Hitler war vor allem Alfred Baeumler mit seiner erziehungstheoretischen Auffassung einer politischen Leibeserziehung prägend.
Wie unterschied sich der Sportunterricht für Mädchen von dem für Jungen?
Während bei Jungen Wehrhaftigkeit im Vordergrund stand, lag der Fokus bei Mädchen auf Gymnastik, Tanz und der Ausbildung eines "arischen" Körperideals für die Mutterrolle.
Welche Rolle spielten Gymnastik und Tanz?
Diese Sportarten wurden besonders gefördert, um Anmut und körperliche Fitness im Sinne der NS-Frauenrolle zu vermitteln.
Gab es Probleme bei der Umsetzung während des Krieges?
Ja, die Kriegsvorbereitung und der Zweite Weltkrieg erschwerten die praktische Durchführung der schulischen Leibeserziehung erheblich.
- Citation du texte
- Sophie Schönherr (Auteur), 2021, Die völkische Leibeserziehung der Mädchen und Frauen im Dritten Reich. Verknüpfung von Politik und Sport im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1042626