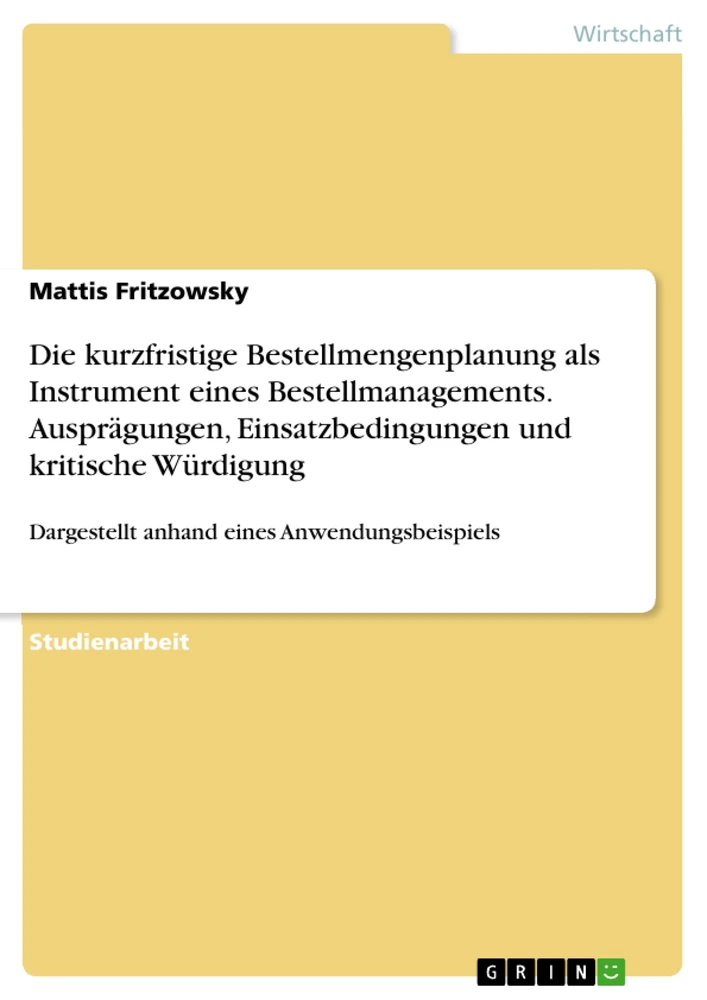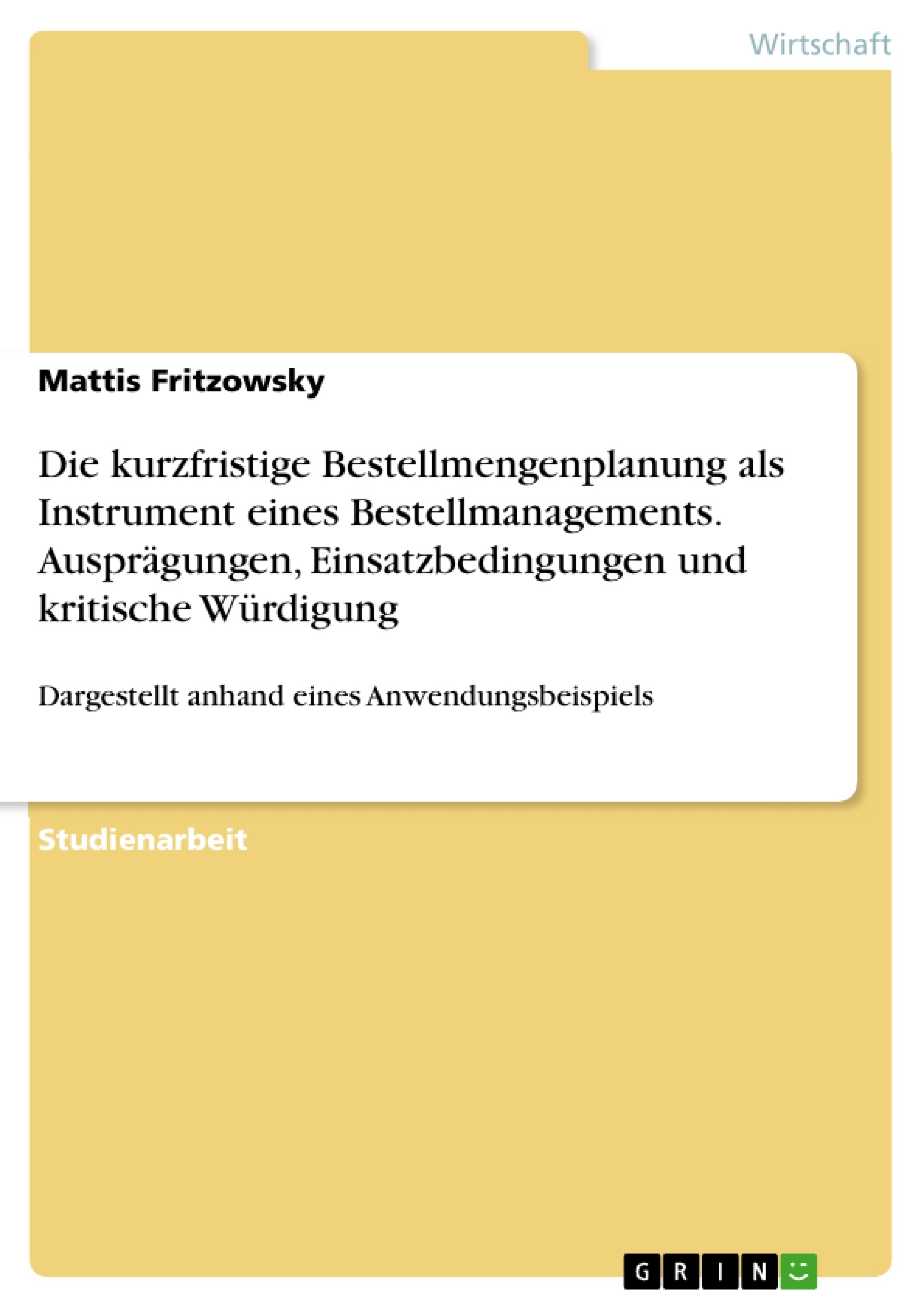In jedem Unternehmen, unabhängig der jeweiligen Branche und Größe, stellt die Beschaffung einen Geschäftsprozess dar, welcher stets auf dieselbe Weise aufgebaut ist. Dabei besteht das Ziel stets in der Beschaffung der gewünschten Produkte und Dienstleistungen zum gewünschten Termin in der benötigten Menge mit den geforderten Eigenschaften (Qualität) zu geringstmöglichen Kosten. Zur Erreichung dieses Ziels bedarf die Fülle an Aufgaben, auf welchen die Beschaffung aufbaut, einem Management, dem sogenannten Beschaffungsmanagement.
Im Folgenden wird daher die kurzfristige Bestellmengenplanung als Instrument eines Beschaffungs- bzw. Bestellmanagements unter Betrachtung der zugrunde liegenden Ausprägungen und Einsatzbedingungen erläutert werden. Im Anschluss wird anhand eines Anwendungsbeispiels eine kritische Würdigung vorgenommen werden, welche möglicherweise auftretende Probleme bzw. Grenzen analysiert, sowie auch mögliche Stärken des Instruments aufzeigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung der kurzfristigen Bestellmengenplanung
- 3. Ausprägungen und Einsatzbedingungen
- 3.1 Die optimale Bestellmenge
- 3.2 Bestellpunktverfahren
- 3.3 Bestellrhythmusverfahren
- 4. Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die kurzfristige Bestellmengenplanung als Instrument des Bestellmanagements. Ziel ist es, die verschiedenen Ausprägungen und Einsatzbedingungen dieser Planung zu erläutern und anhand eines Anwendungsbeispiels kritisch zu würdigen. Dabei werden sowohl Stärken als auch potentielle Probleme und Grenzen des Instruments analysiert.
- Einordnung der kurzfristigen Bestellmengenplanung in das operative Beschaffungsmanagement
- Ausprägungen der kurzfristigen Bestellmengenplanung (optimale Bestellmenge, Bestellpunktverfahren, Bestellrhythmusverfahren)
- Einsatzbedingungen der verschiedenen Verfahren
- Kostenoptimierung im Kontext der Bestellmengenplanung
- Kritische Bewertung der kurzfristigen Bestellmengenplanung und ihrer Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Beschaffung im Unternehmen ein und betont die Bedeutung eines effizienten Beschaffungsmanagements. Sie hebt die kurzfristige Bestellmengenplanung als ein zentrales Instrument hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit: die Erläuterung der Ausprägungen und Einsatzbedingungen, gefolgt von einer kritischen Würdigung anhand eines Anwendungsbeispiels. Der Fokus liegt auf der Optimierung der Beschaffungsprozesse zur Erreichung der gewünschten Produkte und Dienstleistungen zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge und Qualität zu minimalen Kosten.
2. Einordnung der kurzfristigen Bestellmengenplanung: Dieses Kapitel ordnet die kurzfristige Bestellmengenplanung in den Kontext des operativen Beschaffungsmanagements ein. Es wird die Unterscheidung zwischen programmorientierter und verbrauchsorientierter Disposition erläutert, wobei die Arbeit sich auf letztere konzentriert. Die kurzfristige Bestellmengenplanung wird als Teil der verbrauchsorientierten Disposition beschrieben, die im Gegensatz zur programmorientierten Disposition einen durchschnittlichen Periodenbedarf prognostiziert und diesen mit Regeln zur Vorratsbeschaffung verbindet. Der Fokus liegt auf der Kostenoptimierung durch die Ermittlung der optimalen Bestellmenge, um einen Kompromiss zwischen hohen Beschaffungskosten bei kleinen Bestellmengen und hohen Lagerkosten bei großen Bestellmengen zu finden.
3. Ausprägungen und Einsatzbedingungen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Ausprägungen der kurzfristige Bestellmengenplanung: die optimale Bestellmenge, das Bestellpunktverfahren und das Bestellrhythmusverfahren. Es wird die Berechnung der optimalen Bestellmenge als ein Kompromiss zwischen Beschaffungs- und Lagerkosten erläutert. Die Kapitel beschreiben die jeweiligen Verfahren detailliert und beleuchten deren Einsatzbedingungen. Der Fokus liegt auf der Kostenoptimierung in Abhängigkeit der gewählten Methode und der jeweiligen Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter
Kurzfristige Bestellmengenplanung, Beschaffungsmanagement, Operatives Beschaffungsmanagement, Optimale Bestellmenge, Bestellpunktverfahren, Bestellrhythmusverfahren, Kostenoptimierung, Lagerhaltungskosten, Beschaffungskosten, Vorratsbeschaffung, verbrauchsorientierte Disposition.
Häufig gestellte Fragen zur kurzfristigen Bestellmengenplanung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der kurzfristigen Bestellmengenplanung als Instrument des Bestellmanagements. Sie untersucht verschiedene Ausprägungen und Einsatzbedingungen dieser Planung und bewertet diese kritisch anhand eines Anwendungsbeispiels.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Einordnung der kurzfristigen Bestellmengenplanung in das operative Beschaffungsmanagement, verschiedene Ausprägungen (optimale Bestellmenge, Bestellpunktverfahren, Bestellrhythmusverfahren), deren Einsatzbedingungen, die Kostenoptimierung im Kontext der Bestellmengenplanung und eine kritische Bewertung der Methode und ihrer Grenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Einordnung der kurzfristigen Bestellmengenplanung, ein Kapitel zu den Ausprägungen und Einsatzbedingungen (inkl. optimaler Bestellmenge, Bestellpunkt- und Bestellrhythmusverfahren) und eine abschließende kritische Würdigung.
Wie wird die optimale Bestellmenge behandelt?
Die Berechnung der optimalen Bestellmenge wird als Kompromiss zwischen Beschaffungs- und Lagerkosten erläutert. Das Kapitel beschreibt detailliert, wie dieser optimale Wert ermittelt und im Kontext der Kostenoptimierung eingesetzt werden kann.
Was sind die Unterschiede zwischen Bestellpunkt- und Bestellrhythmusverfahren?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Bestellpunkt- und Bestellrhythmusverfahren und beleuchtet die jeweiligen Einsatzbedingungen und deren Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Kostenoptimierung.
Welche Art der Disposition wird betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf die verbrauchsorientierte Disposition, im Gegensatz zur programmorientierten Disposition. Die verbrauchsorientierte Disposition prognostiziert einen durchschnittlichen Periodenbedarf und verbindet diesen mit Regeln zur Vorratsbeschaffung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Kurzfristige Bestellmengenplanung, Beschaffungsmanagement, Operatives Beschaffungsmanagement, Optimale Bestellmenge, Bestellpunktverfahren, Bestellrhythmusverfahren, Kostenoptimierung, Lagerhaltungskosten, Beschaffungskosten, Vorratsbeschaffung, verbrauchsorientierte Disposition.
Welches Ziel verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die verschiedenen Ausprägungen und Einsatzbedingungen der kurzfristigen Bestellmengenplanung zu erläutern und anhand eines Anwendungsbeispiels kritisch zu würdigen, inklusive Stärken und potentieller Probleme.
Wie wird die kritische Würdigung vorgenommen?
Die kritische Würdigung analysiert Stärken, Probleme und Grenzen der kurzfristigen Bestellmengenplanung und beleuchtet diese anhand eines Anwendungsbeispiels (welches im gegebenen HTML-Ausschnitt nicht detailliert dargestellt ist).
- Quote paper
- Mattis Fritzowsky (Author), 2020, Die kurzfristige Bestellmengenplanung als Instrument eines Bestellmanagements. Ausprägungen, Einsatzbedingungen und kritische Würdigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1060769