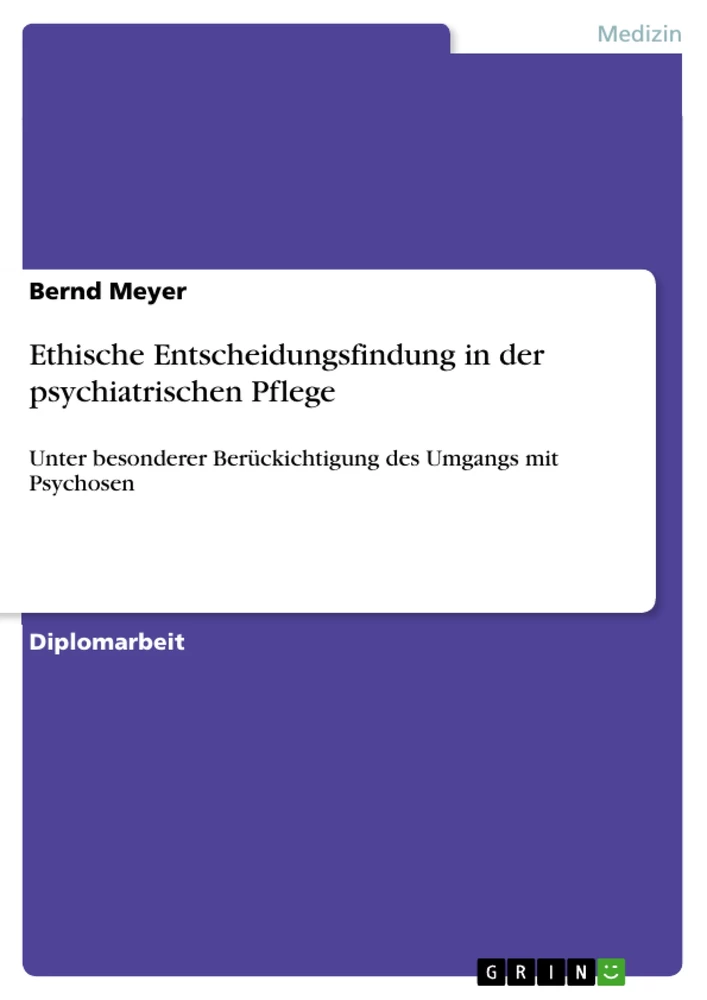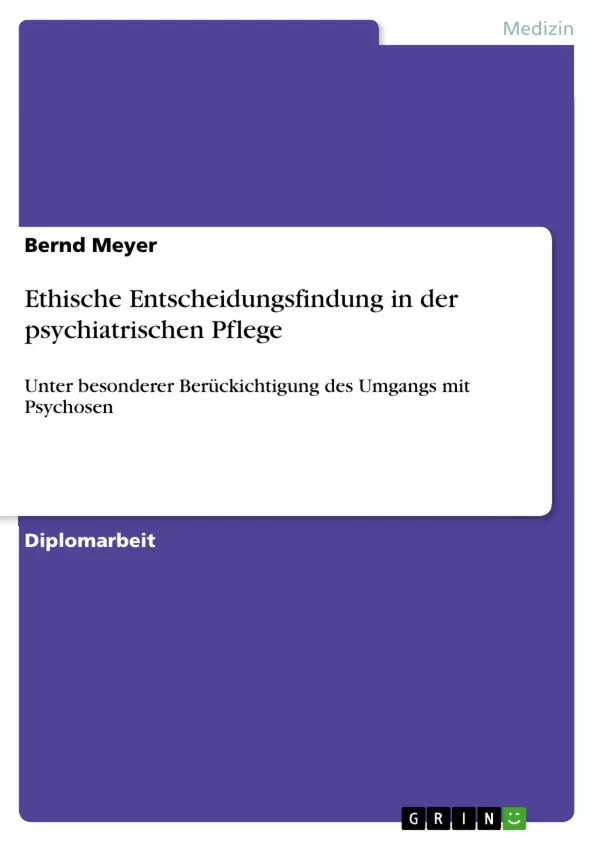Bei 115 Pflegekräften, aus unterschiedlichen psychiatrischen Weiterbildungseinrichtungen in Deutschland, wurde das eigene berufliche Selbstverständnis mit dem, aus der Literatur abgeleiteten, Selbstverständnis der psychiatrischen Pflege verglichen. In sechs von acht Aspekten gab es eine sehr hohe Übereinstimmung.
Dann wurden die TeilnehmerInnen der Befragung mit zwei Fallbeispielen konfrontiert, in denen eine ärztliche Anordnung im Widerspruch zu dem angenommenen beruflichen Selbstverständnis stand. In beiden Fallbeispielen hätte die Ausführung der Anordnung schädliche Folgen für die Patientinnen haben können. Zudem wäre, bei der Ausführung der Anordnung, in beiden Fallbeispielen auch gegen Grundrechte verstoßen worden.
Die Erwartung, dass eine Mehrheit der Befragten die Durchführung der ärztlichen Anordnung in beiden Fallbeispielen ablehnen würde, wurde durch das Ergebnis widerlegt. Nur 14 von 115 Befragten lehnten in beiden Fallbeispielen die Durchführung der ärztlichen Anordnung ab. Bei diesen TeilnehmerInnen zeigten sich, in den Antworten zum beruflichen Selbstverständnis, in den zwei Aspekten („Einfluss der Pflege auf therapeutische Entscheidungen“ und „Aufgabe der Pflege ist es auch, den Patienten vor unangemessenen Anforderungen durch andere zu schützen“) deutliche Unterschiede zu den anderen Befragten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Konfliktfelder in den Tätigkeitsbereichen der psychiatrischen Pflege
- Professionalisierung in der Pflege
- Professionalisierung der psychiatrischen Pflege
- Zum beruflichen Selbstverständnis der psychiatrischen Pflege
- Zum Verständnis von Psychosen
- Psychiatrische Pflege und Ethik
- Theoretische Grundlagen
- Ethische Prinzipien und moralisches Handeln in der psychiatrischen Pflege
- Zusammenfassung
- Explorative Studie
- Auswahl und Begründung der Fragen
- Auswahl und Begründung der Fallbeispiele und der dazu gehörenden Fragen
- Ergebnisse
- Ergebnisse und Interpretation der persönlichen Daten
- Ergebnisse und Interpretation der Fragen zum Berufsverständnis
- Zusammenfassung berufliches Selbstverständnis
- Ergebnisse der geschlossenen Fragen zu den Fallbeispielen
- Auswertung der offenen Fragen zu den Fallbeispielen
- Argumente gegen die Durchführung der ärztlichen Anordnung in den Fallbeispielen
- Vergleichende Betrachtung der TeilnehmerInnen, die in beiden Fallbeispielen die Anordnung nicht ausführen.
- Argumente bei einer Durchführung der ärztlichen Anordnung in den Fallbeispielen
- Interpretation der Aussagen bei einer Durchführung der ärztlichen Anordnung in beiden Fallbeispielen
- Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der ethischen Entscheidungsfindung in der psychiatrischen Pflege, insbesondere im Kontext des Umgangs mit Psychosen. Die Arbeit untersucht, wie Pflegekräfte in der Psychiatrie bei ethischen Problemen Entscheidungen treffen und welche Faktoren, wie Geschlecht, Alter, Berufserfahrung und Berufsverständnis, diese beeinflussen.
- Professionalisierung der psychiatrischen Pflege und deren Auswirkungen auf ethische Entscheidungsfindung
- Verständnis von Psychosen und deren Herausforderungen für die psychiatrische Pflege
- Ethische Prinzipien und moralische Konflikte in der psychiatrischen Pflege
- Entwicklung eines ethisch-didaktischen Unterrichtskonzepts für die Fort- und Weiterbildung in der psychiatrischen Pflege
- Analyse von Konfliktfeldern in den unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen der psychiatrischen Pflege
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problemfeld der ethischen Entscheidungsfindung in der psychiatrischen Pflege dar und führt die Zielsetzung der Arbeit aus. Kapitel 1 beleuchtet die Konfliktfelder in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen der psychiatrischen Pflege, die eine besondere Herausforderung für die ethische Entscheidungsfindung darstellen. Kapitel 2 befasst sich mit der Professionalisierung in der Pflege, wobei der Fokus auf das Berufsverständnis, das Verständnis vom Umgang mit psychosekranken Menschen und die ethische Diskussion in der psychiatrischen Pflege liegt. Kapitel 3 beschreibt die Explorative Studie, die zur Beantwortung der Forschungsfragen durchgeführt wurde. Die Ergebnisse der Studie werden in Kapitel 4 und 5 detailliert vorgestellt und interpretiert. Abschließend fasst Kapitel 6 die Ergebnisse zusammen, diskutiert diese und stellt Möglichkeiten zur Erleichterung der ethischen Entscheidungsfindung in der psychiatrischen Pflege vor.
Schlüsselwörter
Ethische Entscheidungsfindung, psychiatrische Pflege, Psychosen, Professionalisierung, Berufsverständnis, ethische Prinzipien, moralisches Handeln, Konfliktfelder, Explorative Studie, Fallbeispiele, Unterrichtskonzept, Fort- und Weiterbildung.
Häufig gestellte Fragen
Wie treffen Pflegekräfte in der Psychiatrie ethische Entscheidungen?
Die Studie zeigt, dass viele Pflegekräfte Schwierigkeiten haben, ärztliche Anordnungen abzulehnen, selbst wenn diese gegen das pflegerische Selbstverständnis oder Grundrechte verstoßen könnten.
Welche Faktoren beeinflussen das moralische Handeln in der Pflege?
Faktoren wie Berufserfahrung, Alter, Geschlecht und insbesondere das individuelle Berufsverständnis spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung.
Was war das Ergebnis der Fallbeispiele in der Studie?
Nur 14 von 115 Befragten lehnten in beiden kritischen Fallbeispielen die Durchführung einer potenziell schädlichen ärztlichen Anordnung konsequent ab.
Welche Rolle spielt der Schutz des Patienten vor unangemessenen Anforderungen?
Dies wird als Kernaufgabe der Pflege identifiziert, jedoch zeigten sich in der Praxis deutliche Unterschiede darin, wie aktiv Pflegekräfte diesen Schutz gegenüber anderen Berufsgruppen durchsetzen.
Was ist das Ziel des vorgeschlagenen Unterrichtskonzepts?
Es soll ein ethisch-didaktisches Modell für die Fort- und Weiterbildung bieten, um Pflegekräfte besser auf moralische Konfliktfelder in der Psychiatrie vorzubereiten.
- Citation du texte
- Bernd Meyer (Auteur), 2001, Ethische Entscheidungsfindung in der psychiatrischen Pflege, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/10756