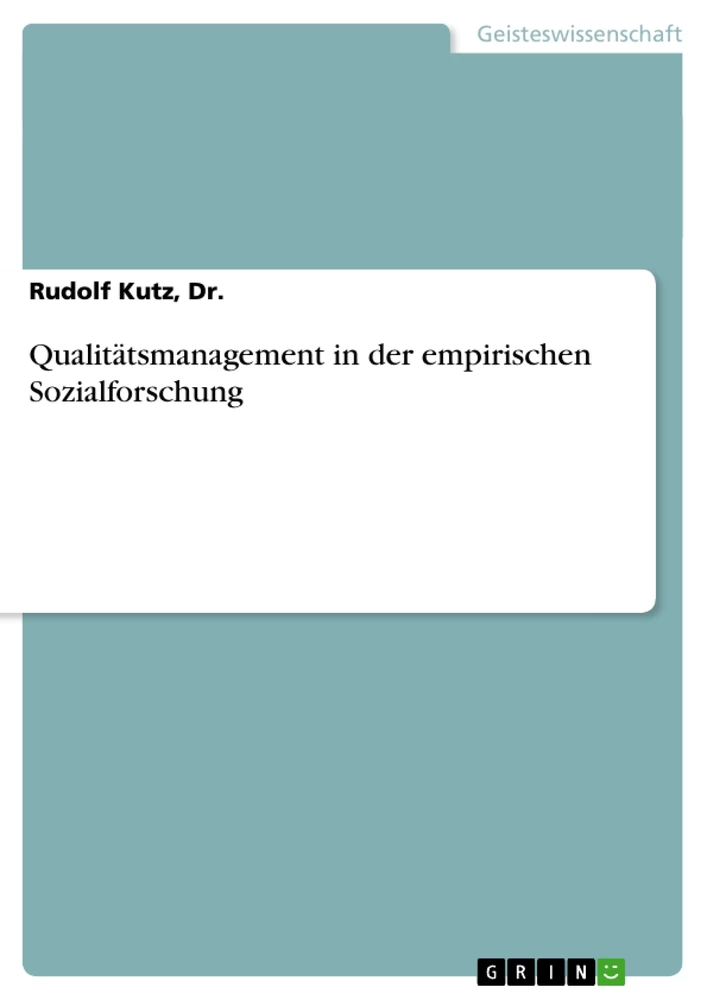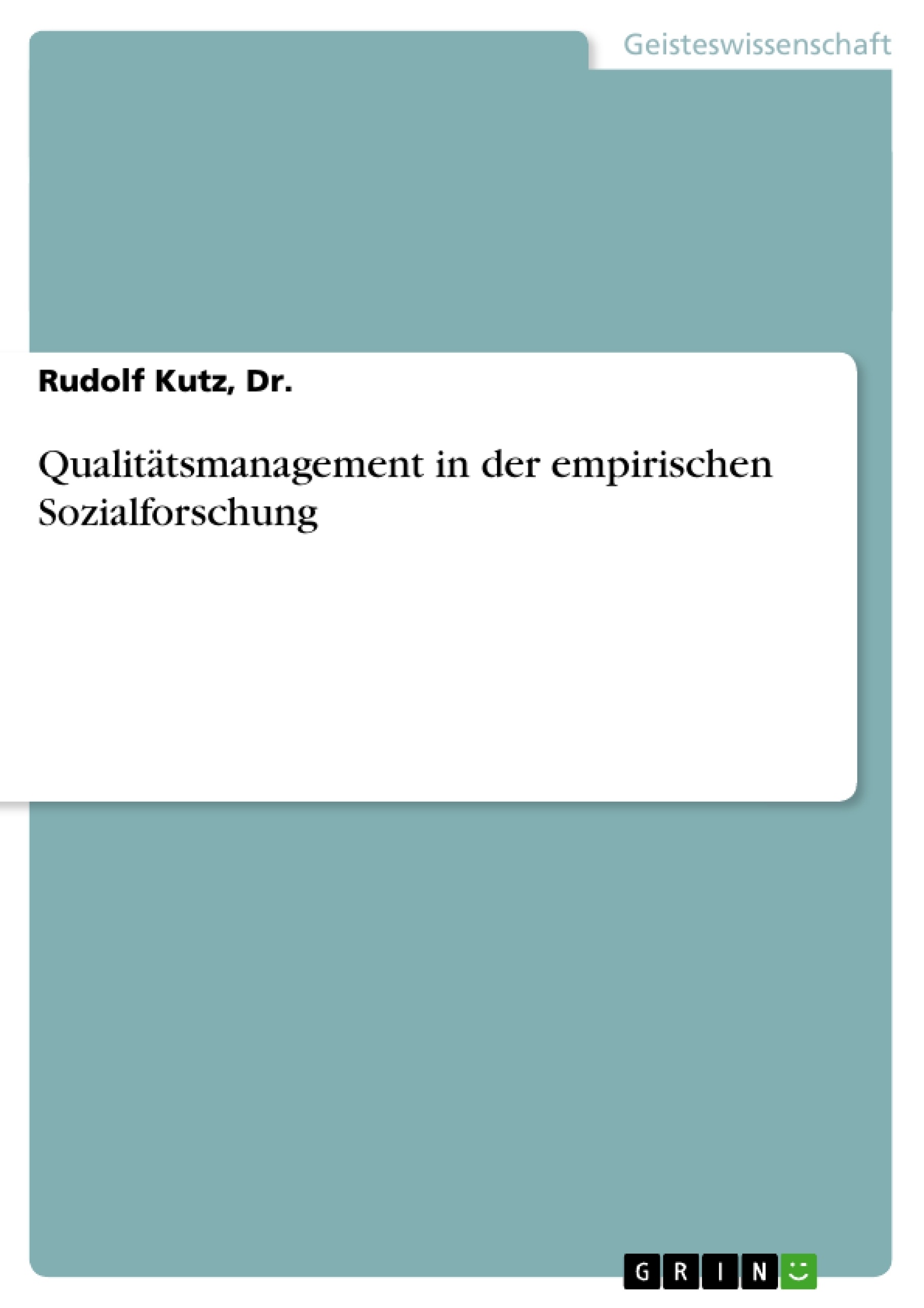Qualitätsmanagement in der empirischen Sozialforschung - Qualitative vs. quantitative Sozialforschung – Rudolf Kutz
Zusammenfassung: Gegenstand dieses Aufsatzes ist die Relativierung der empirischen Paradigmen in bezug auf die theoretisierte Diskussion der ‘besseren Methodik‘, sei es im Hinblick auf qualitative, angeblich verstehende Forschung, (Glaser, Strauß 1979, Hoffmann-Riem 1980, Kleining 1982, Soeffner 1988, Mayring 2001 usw.) oder sei im Hinblick auf quantitative, angeblich naturwissenschaftlich-mathematische, hypothesengeleitete und theoriebasierende Forschung (Cattel 1980, Campbell 1963, Opp 1984, Lienert 1969, Glaser 1978, Voss 1997, Ostendorf/Angleitner/Ruch 1986, Siegel 1985, Diehl/ Staufenbiel 1997 usw.). Dabei ist die Diskussion unter dem Aspekt der Zielorientierung von empirischer Forschung angelegt, auf die Differenzierung zwischen ‘theorieorientierter’ und ‘angewandten’ Forschung, die mithin das Erkentnisinteresse von Forschungsintentionen, insbesondere die Qualität von Forschungen im Rahmen der Konzeptionen, Kategorien, Auswertungsstrategien und Veröffentlichung in den Mittelpunkt stellt.
1. Paradigmen der empirischen Sozialforschung
Meine Intention läßt sich paraphrasierend festmachen an einer nicht mehr übersehbaren Anzahl von Veröffentlichungen hinsichtlich vorwiegend quantitativ ausgerichteter Methodik, sei es in der Soziologie, Psychologie oder Medizin. Der quantitativen Forschung, eine angeblich hypothesengeleitete und damit dem naturwissenschaftlichen Paradigma sehr viel näher stehende, angeblich objektivere, validere und reliablere Forschung, steht eine qualitative - eher immer noch ein Schattendasein führende -, angeblich verstehende, das Subjekt und seinen alltäglichen Interaktionskontext berücksichtigende Forschung gegenüber, wobei Autoren der letzteren Kategorie immer unter einem Legitimationszwang ihrer eigenen Forschungsansätze zu stehen scheinen (vgl. Kleining 1982, Hoffmann-Riem 1980, Oevermann 1979, 1982, Jüttemann 1985, Meinefeld 1985, 1997, Gerhardt 1985, Kohli 1985, Mayring 1986, Fuchs 1984, Walter 1983, von Quekelberghe 1985, Fuchs 1984, Schneider 1988 usw.)
Die Kontroverse ist nicht nur aus theoretischer Sicht problematisch, sondern für einen flexiblen Forschungspragmatismus unfruchtbar, weil innovationshemmend - wie der Literatur zu entnehmen ist -. Z. T. werden mehr die theoretischen Positionen Nassehi/Saake 2002, Höffling, Plaß, Schetsche 2002, Schilling 2002, Mayring 2001) von empirischer Sozialforschung diskutiert als die intentionalen Ziele, die Ethik der Forschung selbst - was heißen soll wissenschaftliche Redlichkeit und Wahrhaftigkeit im Sinne einer ex-ante Beschreibungen des Erkenntniszieles. Wann und unter welchen Voraussetzungen eine Falsifizierung von Hypothesen rsp. Ansätzen sinnvoll, wie eine flexible Handhabung von auf spezifischen Methoden basierenden Konzeptionen und Implementationen einzuschätzen ist (vgl. Meinefeld 1997), wird bei dieser Kontroverse aus der Diskussion ausgeblendet. Die gegenwärtige Diskussion im Hinblick auf Paradigmen der Sozialforschung vernachlässigt den aktuellen Diskurs über die Qualität des Forschungsprozesses, insbesondere im Rahmen der Struktur-, Prozeß- und Ergebnisqualität. Forschung entzieht sich bislang immer noch einer neutralen Qualitätskontrolle.
Die Realität der quantitativen Ansätze stellt sich derzeit so dar, dass die größte Anzahl von empirischen Studien primär in Zeitschriften veröffentlicht wird. Die Studien selbst werden - sofern es um Auftragsforschung geht - dem Auftraggeber nur in Form einer oberflächlichen Konzeption zur Verfügung gestellt und leider auch so akzeptiert. Der Forschungsprozeß wird selten kontrolliert, d.h. sogenannte Randomisierungskriterien und anzuwendende statistische Tests werden nur sehr selten expliziert oder extern kontrolliert. Dies hat zur Folge, dass zwischen einer ex-post und einer ex-ante Konzeption und Auswertungsstrategie gerade in Zeitschriftenartikeln nicht mehr differenziert werden kann (vgl. Meinefeld 1997). Sofern keine Auftragsforschung intendiert ist, läßt sich nicht einmal ansatzweise prüfen, ob es sich um eine ex-ante oder ex-post Konzeption und Auswertungsstrategie handelt.
Die qualitative Forschung hingegen entzieht sich aufgrund ihres Prinzips der ‘Offenheit’- es besagt, “..., daß die theoretische Strukturierung des Forschungsgegenstandes zurückgestellt wird, bis sich die Strukturierung des Forschungsgegenstandes durch die Forschungssubjekte herausgebildet hat” (Hoffmann-Riem 1980:343); Glaser und Strauß gehen sogar soweit, einen Verzicht auf Literaturstudien vor der Feldforschung zu propagieren (Glaser/Strauß 1979) - jeder Art von Qualitätskontrolle, obwohl vor dem Hintergrund des hermeneutischen Zirkels keine Forschung existiert, die ohne Berücksichtigung impliziter Theorien bzw. Forschungsintentionen durchführbar ist. Das Prinzip der Offenheit, das ja durchaus seine Berechtigung hat, wird forschungslogisch nur dann der Illusion entzogen, wenn es auf der Basis einer expliziten Konzeption oder zumindest eines expliziten Erkenntnisinteresses implementiert wird, d.h. das Prinzip der Offenheit kann nur dann Validität beanspruchen, wenn es als Erkenntniskriterium - im Sinne einer Objektivierung und Neutralität in bezug auf prognostizierbare Daten und Ergebnisse – eine ressentimentlose Erforschung eines Objektbereiches gewährleistet.
1. 1 Probleme quantitativer Forschung am Beispiel der Medizin
Den quantitativen Forschungen in der Medizin wird nach heutigem Verständnis primär eine naturwissenschaftliche Perspektive unterstellt, insbesondere im Hinblick auf die optimale Strategie experimenteller Designs. Dies mag in einigen Bereichen sehr wohl zutreffen, in anderen wiederum nicht.
Von 1996-1998 wurde in Bayern die sogenannte Hämoccult-Studie - eine auf der Basis von Tests, die occultes Blut im Stuhl nachweisen, verwendete Früherkennungsmethode für colorektale Karzinome - (Altenhofen et.al.1999) - durchgeführt.
Zunächst findet man im Inhaltsverzeichnis keine expliziten Ausführungen zur Konzeption generell, vielweniger noch zu den verwendeten statistischen Methoden oder explizite Hypothesenformulierung und deren Operationalisierung. Es wird konzeptionell keine Aussage über die Differenzen von Rektum- und Colonkarzinom beschrieben, was gerade vor den Hintergrund geschlechtsspezifischer Inzidenzen relevant gewesen wäre.
Die Inzidenzen zwischen Männern und Frauen variieren signifikant beim Rektum-Karzinom, nur etwa halb soviele Frauen erkranken im Vergleich zu den Männern an einem Rektum-Ca (Kutz 1999, Wittekind/Tannenapfel 1995). Diese Tatsache allein hätte eine geschlechtsspezifische Differenzierung beim Rektum-Karzinom impliziert, wobei ein zusätzlicher Faktor unberücksichtigt geblieben ist. Von ca. 310000 durchgeführten Tests wurden nur 30,6% von Männern in Anspruch genommen. Diese Fakten werden im Verlauf der Ergebnisdarstellung (insbesondere bei den Karzinomen) kaum noch thematisiert bzw. problematisiert, ebensowenig wie der gravierende systematische Fehler, nur niedergelassene Ärzte in die Studie einzubeziehen.
Das deutet zunächst auf eine durch die Forscher determinierte Selektion des Forschungsdesigns und des Auswertungsmaterials hin, ein häufig unterschätztes Problem, wenn die wissenschaftliche Qualität von Studien diskutiert wird.
Eine wesentlich problematischere Datenselektion ist im Bereich der entdeckten Karzinome zu beobachten. 88 von 275 Karzinomen hätten im Rahmen einer stadienspezifischen Auswertung als Missings betrachtet werden müssen; denn ein TX, NX oder MX bedeutet, dass die maligne Erkrankung im Hinblick auf die Tumorausdehnung (T), der regionäre Lymphknotenbefall (N) und die Fernmetastasierung (M) als nicht beurteilbar einzustufen sind (UICC 1995). Sofern ein TX, NX oder MX beobachtbar ist, kann eine Stadieneinteilung nicht mehr durchgeführt werden. Die Stadieneinteilung hat aber Therapierelevanz. Um die 88 Karzinome in die Datenauswertung einbeziehen zu können, wurden aus MX, bei Vorliegen von T1 und T2 sowie N0, ein M0 (keine Fernmetastasen) konstruiert, was fachlich nicht konsensfähig ist und möglicherweise Fehlbehandlungen impliziert
Aufgrund unzureichender Dokumentation bzw. unzureichend valider Daten oder unzureichender Diagnostik wird die Anzahl der Frühkarzinome (von ca. 21% auf ca. 27%) erhöht, um zumindest aproximativ repräsentative Ergebnisse vorweisen zu können.
Wenn darüber hinaus in Verbindung mit internationalen Studien, die über einen wesentlich längeren Zeitraum durchgeführt wurden, eine Schätzung hinsichtlich der Mortalitätsreduktion von 23% prognostiziert wird, dann ist an der Qualität des Studiendesigns, der Implementation sowie insbesondere an der Dateninterpretationen ganz erheblich zu zweifeln (vgl. Altenhofen et.al. 1999, insbesondere S. 14 sowie Fußnote S. 93, S. 96).
Diese ‘Studienergebnisse’ waren Entscheidungsgrundlage für die Einführung des Hämoccult-Tests in die Regelversorgung (KFU) der Krankenkassen, was die gesundheitspolitischen und gesundheitsökonomischen Auswirkungen zeigt. Darüber hinaus wurde an der Einführung des Tests für die Altersgruppe ab dem 45. Lebensjahre festgehalten, obwohl die Studiendaten und die Daten des TUZ Regensburg eindeutig belegen, dass erst nach dem 50. Lebensjahr ein überproportionaler Anstieg des Karzinomrisikos konstatierbar ist (s. Graphik 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Graphik 1: Alterspezifische Inzidenzen von Colon- und Rektumkarzinomen (1992-1997)
Einen anderen Forschungsaspekt möchte ich beispielhaft anhand von Überlebenskurven (quantitative Forschung) aus der Onkologie verdeutlichen. Überlebenskurven werden vorwiegend zur Darstellung von Überlebensprognose (kurz- oder langfristig) bei Einsatz spezifischer Treatments (primär Chemo-Therapien) angewendet. Die Datenerhebung wird dabei primär im Hinblick auf die Wirkungen von Therapien konzipiert, wobei standardisierte Dokumentationen und statistische Verfahren (Kaplan - Meier - univariat, oder logistische Regression - multivariat, eher selten - vgl. SPSS 8.0 Benutzerhandbuch 1998, Cox/Oakes 1984) eingesetzt werden. Die Datenerhebung wird nur auf krankheitsspezifische Variablen beschränkt, die den Schweregrad der Krankheit, den körperlichen Allgemeinzustand (Karnowski-Index, wissenschaftlich sehr problematisch) und die therapeutischen Interventionen betreffen. Die Datenerhebung ist krankheitsspezifisch und unterliegt ‘angeblich’ Randomisierungskriterien (die aber weder kontrolliert werden können noch eindeutig expliziert werden). Psychische und/oder soziale Einflußfaktoren werden ausgeblendet.
Es wird unrefelktiert angenommen, dass die therapeutischen Interventionen unabhängig von psychischen und/oder sozialen Einflußfaktoren betrachtet werden können, was zweifelhaft erscheint. Randomisierungskriterien sowie Ein- oder Ausschlußkriterien können nur dann sinnvoll sein, wenn sie spezifische bio-psycho-soziale Merkmale definieren, d.h. auch intervenierende und zu kontrollierende Variablen explizieren und vor allem bereits durchgeführte Therapien hinreichend berücksichtigen (OP, Chemo-, Schmerztherapien, möglicherweise Homöopathische Therapien usw.).
Die Therapiestudien werden fast ausschließlich von der Pharmaindustrie kontrolliert, eine neutrale Kontrollinstanz ist derzeit nicht in Sicht, so dass die Ergebnisse eher eine Frage des Glaubens sind als objektiv, transparent und nachvollziehbar (z.B. Contergan, Lipobay usw). Problematisch daran sind nicht die Studien an sich, sondern vielmehr die Tatsache des “nicht unterscheiden Könnens”, welche Studien wissenschaftlichen Kriterien standhalten und welche Studien nicht (dies läßt sich nicht am sogenannten wissenschaftlichen Renomee einer Zeitschrift festmachen) (vgl. z.B. die Diskussion um den Einsatz der Hochdosistherapie beim Mamma-Karzinom, bei sich herausstellte, das die Daten manipuliert waren).
Ebenso problematisch ist die Interpretation der sogenannten medianen Überlebenszeiten, insofern als sie zu Prognosevermittlungen in die alltägliche Praxis projiziert werden. Die mediane Überlebenszeit ist nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsaussage über die durchschnittliche Überlebenszeit eines durch eine therapeutische Intervention beeinflußten Krankheitsverlaufes. Sie trifft nicht zwangsläufig auf individuelle Krankheitskonstellationen zu, ist somit auch nicht individualisierbar (vgl. Kutz 2001). Werden vor diesem Hintergrund Wahrscheinlichkeitsaussagen im Rahmen individueller Prognosen vermittelt, impliziert dies Internalisierung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse unreflektiert in das professionelle Alltagswissen zu übernehmen, mit möglicherweise fatalen individuellen, sozialen und ökonomischen Folgen.
Gleichwohl werden die Subgruppen, die eine kürzere bzw. längere Überlebenszeit aufweisen, ganz selten einer weiteren statistischen Analyse unterzogen. Einflüsse die hier eine Rolle spielen könnten, werden aus der Analyse ausgegrenzt, obwohl es von entscheidender Relevanz wäre, defizitäre bzw. erfolgreiche Ein- und Ausschlußkriterien (psychische oder soziale Einflüsse, Copingstrategien usw.) herauszukristallisieren, die für eine Verkürzung oder Verlängerung der Überlebenszeit evident sind. Dies ist um so wichtiger, je spezifischer die Zielgruppe eruiert werden soll, die von einer spezifischen therapeutischen Intervention auch faktisch profitiert, was angesichts der gesundheitsökonomischen Auswirkungen von erheblicher Bedeutung wäre.
Diese Studien haben einen entscheidenden Einfluß auf
1. die Zulassung von Medikamenten (Entscheidungsgrundlage),
2. die Verbreitung in der Praxis (individuelle und ökonomische Auswirkungen),
3. Therapieentscheidungen (pragmatische Relevanz),
4. die wissenschaftliche Diskussion, da Ergebnisse unreflektiert und ungeprüft übernommen werden. (vgl. beispielsweise Möbus 1999, Ludwig 1999, usw.), es werden primär keine Studien angegeben, sondern Zeitschriftenartikel und diese wiederum primär aus den USA. Wer kann von sich behaupten, aus einem Artikel extrahieren zu können, welche wissenschaftlichen Kriterien kontrolliert worden sind und welche nicht? Welche Ergebnisse wissenschaftliche Kriterien erfüllen oder nicht? Wer die Ergebnisse kontrolliert und nachgeprüft hat? Ex-ante Konzeptionen werden in den Artikeln selten diskutiert), hier geht man von dem latenten Konsens aus, nur noch Ergebnisse darzustellen. Die wissenschaftliche Wahrhaftigkeit und Redlichkeit wird ebenfalls latent präsupponiert, d.h. wir kehren zurück ins Mittelalter, wir glauben und vertrauen, statt gemäß dem Prinzip der wissenschaftlichen Rationalität Konzeption und Ergebnisse zu kontrollieren.
5. die Konzeption und Implementation neuer Studien.
Gesellschaftlich betrachtet könnten aufgrund unkontrollierbarer Ergebnisse Weichenstellungen für therapeutische Interventionen vermittelt werden, deren gerade sozialökonomische Auswirkungen finanzielle Ressourcen binden und fachspezifische rsp. fachlich-professionelle Ressourcen kanalisieren, was im Rahmen von Ausbildung, Fortbildung, pragmatischen Therapieansätzen und Forschungspräferenzen evident wird.
Für die quantitative Forschung bedeutet das konkret:
1. Quantitative Studien müssen wesentlich stärker von neutralen Organisationen kontrolliert werden (Strukturqualität der Forschung).
2. An die Darstellung von Forschungsergebnissen müssen Qualitätsstandards im Hinblick auf Konzeption, Implementation, Auswertung sowie Ergebnispräsentation formuliert werden (Implementationsqualität der Forschung).
3. Studienergebnisse, die nur in Fachzeitschriften abgedruckt werden, bedürfen einer wissenschaftlichen Kontrolle in Form einer Prüfung der Gesamtstudie (Qualitätskontrolle).
4. Studienergebnisse müssen sehr kritisch geprüft werden, insbesondere dann, wenn sie als therapeutische, gesundheits-, sozialpolitische, politische, ökonomische oder ökologische Entscheidungsgrundlage dienen sollen. (Ergebnisqualität)
1.2 Probleme qualitativer Sozialforschung
Zu Beginn der 80iger Jahre wurde die ‘objektive Hermeneutik’ von Oevermann et. al. (1979, 1983, vgl. auch Schneider 1985,1988, Kleining 1982, kritisch dazu Kutz 1983, Reichertz 1988) als innovatives Paradigma der qualitativen Sozialforschung mit der Zielvorstellung ‘universelle Strukturen der sozialen Kostituierung des Subjektes zu rekonstruieren’ wissenschaftlich hochgelobt. Die Diskussion kann hier im einzelnen nicht wiederholt werden, jedoch ist darauf hinzuweisen, dass bislang keine ehemals prognostizierten Ergebnisse vorliegen. Forschungen, die den Ansatz verfolgten, haben sich entweder als Illusion erwiesen oder sie sind der wissenschaftlichen Diskussion entzogen und in einen eher privaten Bereich verlagert worden (wie die Kommerzialisierung der ‘objektiven Hermeneutik’ belegt).
In eine ähnliche Richtung geht beispielsweise der qualitative Ansatz der ‘Deutungsanalyse im diskursiven Interview’ (Ullrich 1999). Dieser Ansatz zeigt in idealtypischerweise ein qualitatives Verfahren, das als neu bezeichnet wird, historisch als hermeneutisches Verfahren gekennzeichnet werden kann, ohne aber - und das ist evident -, anhand von forschungspragmatischen Beispielen aufzuzeigen, wie dieses Verfahren anzuwenden und welche wissenschaftliche Relevanz intendiert ist. “Beim diskursiven Interview handelt es sich insofern um ein ‘neues’ Interviewverfahren, als hier sowohl neue (welche?) wie auch aus anderen (welche?) Interviewformen bekannte Elemente verbunden werden, bei der die einzelnen Forschungsphasen (Auswahl, Erhebung und Auswertung) aufeinander abgestimmt und konsequent auf das Ziel der Rekonstruktion sozialer Deutungsmuster ausgerichtet sind” (Ullrich 1999: 429). (Hier wird anscheinend impliziert, dass bei anderen hermeneutischen Verfahren die Forschungsphasen nicht aufeinander abgestimmt und konsequent auf die Rekonstruktion sozialer Deutungsmuster gerichtet sind.)
Das diskursive Interview wird als halbstrukturiertes, leitffadengestütztes Interview beschrieben. “Die Notwendigkeit zu einer stärkeren Strukturierung des Interviews ergibt sich ... daraus, daß die Evokation von Deutungsmustern erhebliche Eingriffsmöglichkeiten seitens der Interviewer erfordert. Denn diese müssen in der Lage sein, das Gespräch auf die forschungsrelevanten Bezugsprobleme hinzuleiten (Steuerungsfunktion). Noch wichtiger ist jedoch, daß für den Interviewer die Möglichkeit zu ‘spontanen’ und direkten Begründungsaufforderungen besteht sowie zur Konfrontation des Befragten mit Widersprüchen in seinen Ausführungen” (Ullrich 1999: 434).
Dieser Ansatz widerspricht zunächst dem Prinzip der ‘Offenheit’ (Hoffmann-Riem 1980, Schütz 1977) – das in der qualitativen Sozialforschung durchaus seinen Sinn hat - der qualitativen verstehenden Forschungsansätze, die gerade die Intervention des Interviewers soweit wie möglich zu reduzieren intendieren, um Manipulationsvariationen (die übrigens in dem Artikel überhaupt nicht thematisiert werden) durch den Interviewer zu verhindern. Darüber hinaus sind ‘soziale Deutungsmuster’ nicht definiert, und ob nicht gerade Widersprüche und subjektive Konstruktionen immanenter Bestandteil ‘sozialer Deutungsmustern’ sind, müßte zunächst einmal diskutiert werden
Daneben wird die Position des Interviewers interessant, wann und unter welchen Voraussetzungen darf der Interviewer ‘spontan’ und ‘direkt’ eine Begründungspflicht beim Interviewten einfordern (wird nicht problematisiert)? Wann darf der Interviewte mit ‘vom Forscher subjektiv perzipierten Widersprüchen’ (Eindruck des Interviewers) konfrontiert werden? Sollte es faktisch möglich sein, im Rahmen qualitativer Forschungspragmatik den Interviewten unabhängig von möglichen ‘Widerständen’ rsp. ‘Sensibilitäten’ eine Erzählsequenz zu konterkarieren und ihn mittels direkter Intervention auf Widersprüche hinzuweisen? Vor allem, welchen Sinn hat diese Vorgehensweise, wenn das primäre Ziel ist, ’soziale Deutungsmuster’ von Subjekten zu eruieren, die doch allemal subjektiv und damit z..T. auch widersprüchlich sind?
Ist es nicht vielmehr so, dass Interviewpartner ihre Offenheit bzw. Motivation angesichts einer derart direkten Intervention vollends verlieren? Ist nicht vielmehr die Interaktions- bzw. Kommunikationskompetenz, Kritikfähigkeit und Motivationsbasis des (Interview-) Interaktionspartners zu eruieren, bevor Begründungszwänge eingefordert werden (ich komme später nochmals darauf zurück)?
Die selektive Perzeption ist ein Phänomen, das bei einem Forscher mit einer spezifischen Forschungsintention die Ergebnisse gerade dann beeinflussen kann, wenn ‘spontan’ und ‘direkt’ auf spezifische Erzählsequenzen reagiert wird. Die kommunikativen Regeln eines qualitativen Intenviews sollten zumindest ansatzweise das Prinzip der Offenheit – im Sinne einer Akzeptanz subjektiver Deutungsmuster - realisieren. Einen Begründungszwang beim Interviewten einzufordern oder problematischer noch, ihn auf Widersprüche hinzuweisen, bedarf nicht nur eines hohen Maßes an empathischen Fähigkeiten und der Berücksichtigung situativer und zeitlicher Aspekte, sondern vielmehr noch eines hinreichenden Wissens über den Interaktionskontext des Befragten bezüglich seiner Frustrationstoleranz und Kritikfähigkeit. Durch eine direkte Intervention seitens des Interviewers werden die interaktionskohärenten Regeln, die auf der Basis eines kommunikativen Arrangements erst zustande kommen, erheblich verletzt und die Manipulationsmöglichkeiten im Hinblick auf ‘erwünschte Ergebnisse’ (Validität Reliabilität) entziehen sich der forschungslogischen Transparenz, da es prinzipiell nicht möglich ist, die Basisdaten zu überprüfen.
Für die qualitative Forschung bedeutet das konkret:
Qualitative Forschungsansätze (objektive Hermeneutik), die mit einer spezifischen Zielorientierung antreten, müssen auch Ergebnisse vorweisen, die theoretische Relevanz oder zumindest pragmatische Relevanz besitzen. Ein Rückzug in eine eher private Sphäre birgt die Gefahr, dass der ehemals vertretene Ansatz den präsupponierten Anforderungen nicht standhalten konnte und deshalb der wissenschaftlichen Diskussion entzogen wird. Bis heute steht der Nachweis, den die Vertreter der objektiven Hermeneutik selbst formuliert haben - Eruierung universeller Strukturen im Hinblick auf die soziale Konstituierung des Subjektes -, noch aus.
Andererseits (diskursives Interview) werden Ergebnisse der qualitativen Forschung zweifelhaft, wenn ein forschungslogischer bzw. forschungspragmatischer Konsens in der Anwendung der qualitativen Sozialforschung mit Hilfe problematischer Methoden wieder konterkariert wird; denn Offenheit und Neutralität des Forschers müssen in Zweifel gezogen werden, sofern grundlegende methodische Prinzipien verletzt werden.
Aus den Erfahrungen von ca. 300 (50 Gruppeninterviews im Rahmen einer Patientenzufriedenheitsstudie, vgl. Kutz 2001) narrativen Interviews sind folgende Probleme von erheblicher Bedeutung:
a) Alltagssprache
in der alltagssprachlichen Kommunikation muß der Interviewer als Interaktionspartner auftreten, was heißen soll, er muß sich jeweils auf die unterschiedlichen Sprachniveaus seiner Partner einstellen können. Dazu gehört zunächst eine alltagskommunikative Regel des Verstehens, sie präsupponiert quasi latent, gegenseitige Versicherung der Validität der verwendeten sprachlichen Symbole und Bedeutungsmuster (vgl. Habermas 1968). Ohne diese latente Implikation der verbalen Validität käme keine Kommunikation zustande und ohne eine diesbezügliche Vermittlungsfähigkeit des Forschers gegenüber seinem Gesprächspartner könnte ein Interview abgebrochen, die Offenheit und das Vertrauensverhältnis auf Seiten des Interviewten erheblich gestört werden und bei einer ‘Verlaufsbeobachtung’ wird das Interview nach kurzer Zeit abgebrochen (vgl. auch Buchmann/Gurny 1984).
b) Tonbandaufzeichnung
Um eine Alltagskommunikation aufrechtzuerhalten muß die Tonbandaufnahme problematisiert werden; denn sofern ein Befragter in seinen eigenen vier Wänden aufgesucht wird, kann eine Alltagssituation unterstellt werden. Zunächst - auch um die Situation zu entspannen - wird das Begrüßungsritual durchgeführt, danach beginnt eine Phase, die mit Gastfreundlichkeit beschrieben werden kann (Angebot von Getränken, manchmal auch Kuchen, Kekse usw.). Hat dann jeder seinen Platz eingenommen, so beginnt teils das Interview, teils wird ein angefangener Gesprächsfaden weitergesponnen, teils entsteht eine künstliche Situation, teils aber auch eine vertraute, wenn man so will eine Alltagssituation - Gast und Gastgeber -.
Wann stellt man Mikrofon und Band auf, um mit der Aufnahme zu beginnen??
Eine wesentliche Frage, die ich bislang in keinem Artikel problematisiert fand. Es wäre nicht nur unfreundlich, sondern verstöße gegen jede Form von Vertrauen, wenn man mit dem Mikro in der Hand eine Wohnung betritt. Während der Begrüßung ist es ebenfalls nicht möglich das Mikro aus der Tasche zu holen, ebensowenig während des Rituals der Gastfreundlichkeit (also wann??), aber zwingend ist, die Einwilligung für die Bandaufnahme einzuholen.
Meinen Interviews konnte ich entnehmen, dass die Anfangsphase des Besuches größtenteils nicht aufgezeichnet ist. Die Frage nach der Aufzeichnungserlaubnis wurde fast ausschließlich gestellt, nachdem die Begrüßungs- und Sitzrituale abgeschlossen waren und eine kleine Pause entstand, die mit ‚Erwartungspause‘ von seiten des Befragten bezeichnet werden kann. Diese Chance kann man nutzen, um die Einwilligung des befragten einzuholen, auch wenn ein kurzer Moment der Unsicherheit und Künstlichkeit entsteht. Der wiederum läßt sich durch Fragestellung, eine kurze Erzählung oder durch Vorlage eines Tests (hier handelte es sich um Persönlichkeitstests) auf ein Minimum reduzieren.
Diese Problematik gestaltet sich anders, wenn
- der Befragte zum Interviewer kommt,
- die Befragung in einer Institution stattfindet,
- die Befragung an einem neutralen Ort stattfindet,
- oder die Befragung in Richtung Expertenbefragung intendiert ist bzw.
- Menschen befragt werden, die eine sehr gute Verbalisierungsfähigkeit besitzen.
Aber qualitative Interviews sind auf die subjektive Betroffenenheit ausgerichtet, wobei möglicherweise auch sehr persönliche Aspekte angesprochen werden und es handelte sich häufig um ganz ‘normale’ Gesprächspartner (Alltagsbetroffene (Krankheitskarrieren) ohne Selektionskriterien in bezug auf Herkunft, Beruf, Schulbildung, Verbalisierungsfähigkeit o.ä.) (vgl. diesbezügliche Problematik bei Buchmann/Gurny 1984).
c) Geschlechtsspezifische Problematik
Gerade in der Anfangsphase von beispielsweise narrativen Interviews wird präsupponiert, eine längere Erzählsequenz bei den Betroffenen hervorzulocken. Im Rahmen von Krankheitsverlaufsbeobachtungen sind - wie bereits erwähnt - teilweise sehr persönliche und private Aspekte betroffen, die gerade von Männern nicht ausgesprochen werden rsp. nicht ausgesprochen werden können. Die Anfangssequenz der Erzählfolie wird dadurch apriori eingeschränkt, teils - sofern es sich um sachliche Aspekte der Krankengeschichte handelt - wird eine narrative Sequenz zumindest teilweise im Zusammenhang dargestellt, teils zeigt sich aber auch eine extreme Zurückhaltung, die den Forscher dazu veranlaßt, wesentlich mehr Fragen zu stellen als beabsichtigt, teils muß der Interviewer sogar kleine Anekdoten, Geschichten oder auch Erlebnisse selbst schildern, um dem Betroffenen einen Ansatzpunkt für eine längere Erzählung zu liefern. Dies dient der Vertrauensbildung im Rahmen von qualitativen Längschnittsstudien. Vertrauen wird teilweise erst über einen wechselseitigen Kommunikationsprozeß hergestellt.
Bei Frauen ist dies ganz anders - zumindest bei denen, die ich interviewt habe -, sie erzählen bereits bei einem adäquaten Stichwort ohne Aufforderung ihre Krankengeschichte, mit entsprechenden biographischen Daten, Emotionen und Bewältigungs-, Abwehr- oder Anpassungsstrategien. Ebenso ist bei Frauen zu bemerken, dass sehr viel schneller eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann und dadurch auch über ganz private und persönliche Probleme, Alltagsprobleme, emotionale Problematiken bis hin zu sehr intimen Aspekten gesprochen wird. Um es ganz deutlich zu sagen, Frauen sind ehrlicher, gefühlsbetonter, die verbale Kompetenz ist ausgeprägter (lebendige affektbetonte Sprache) und sie können ihre Erzählsequenzen ohne Rationalisierungen darstellen - was hier auf alle Frauen zutrifft, die ich interviewt habe -.
d) Verbalisierungsfähikeit (strategische Handlungen)
Die Verbalisierungsfähigkeit von Gesprächspartnern kann unter verschiedenen Aspekten diskutiert werden, teils ist Sprache persönlichkeitsspezifisch lebendig, fröhlich, fantasievoll, emotional, unkontrolliert usw., teils aber auch langsam, bedächtig, sachlich, eintönig, überlegt, ernst oder kontrolliert, kurzum manchmal instrumentalisiert oder auch funktionalisiert (vgl. Parker 1980). Nach meinen Erfahrungen kann das narrative Interview nicht nur auf die Gruppe von Informanten mit guter Verbalisierungsfähigkeit (Schütze 1979), sondern aufgrund der ‚Ehrlichkeit‘ in Situationen der Alltagskommunikation bei allen gesellschaftlichen Gruppen angewendet werden. Gerade im Bereich guter Verbalisierungsfähigkeit darf man unterstellen, dass die Informanten die Sprache gleichsam in Form strategischen Handelns benutzen können. Strategisches Handeln bedeutet in diesem Zusammenhang eine Instrumentalisierung der Sprache hinsichtlich besseren Selbstdarstellung, Modifikation der tatsächlichen Gegebenheiten, Idealisierungen der eigenen Verhaltens- und Handlungsmuster, d.h. der Forscher muß in diesem Falle erst eruieren, wie sein Interaktionspartner Sprache verwendet (Profis beispielsweise reden oft in der 3.Person Plural).
Grundsätzlich darf man supponieren, dass in unserer Gesellschaft lebende Subjekte über hinreichende Verbalisierungskompetenz verfügen, und zwar über alle Bevölkerungsgruppen - dies bestätigen zumindest die Interviews, die ich durchgeführt habe -.
In einer spezifischen Alltagskommunikation mit Alltagsmenschen werden strategische Aspekte und Instrumentalisierung der Sprache kaum angewendet, die diesbezügliche zwischenmenschliche Beziehung impliziert Wahrhaftigkeit des Verbalpotentials. Sofern der Forscher Kommunikationsinstrumente benutzt wie Ironie, Sarkasmus, Belehrungen usw., ist das Vertrauensverhältnis gestört und damit auch die Mitwirkungsmotivation.
Vor diesem Hintergrund ist es höchst evident, dass der Forscher im Rahmen narrativer Verlaufsinterviews eine Sprachebene einnehmen kann, die den Verständigungsprozeß erleichtert und dem Interviewten eine kongruente Sprachebene vermittelt. Verwendung akademischer Vokabeln oder gar akademische Überheblichkeit konterkarieren eine Verlaufsbeobachtung.
Bei einmaligen Interviews mögen diese Aspekte weniger problematisch sein, aber Verlaufsinterviews über mehrere Monate setzen eine Vertrauensbasis und eine verbale Verständigungsebene voraus, die dem Gesprächspartner auch eine alltägliche Kommunikationssituation vermittel. (Diese Ausführungen mögen banal erscheinen, aber machen die größten Probleme, eine Alltagssituation muß von den Interagierenden auch als solche perzipiert werden, nur dann kann eine wahrhaftige Kommunikation hergestellt werden) (vgl. hierzu Buchmann/Gurny 1984 kritisch).
Anhand einer Haupterzählung bereitet man die zweite Phase des Interviews vor, die insbesondere neue oder vervollständigende ,,narrative Sequenzen zu Darstellungsbereichen hervorlocken soll, die bisher nicht genügend oder überhaupt nicht ausgeführt wurden." (Schütz1979: 4)
Die Rückgreifstrategie erfüllt dabei eine Detaillierungsfunktion der bereits erzählten Sequenzen. Gleichwohl ist es aber auch möglich aufgrund der Erzählungen Anhaltspunkte für eine übergangslose neue Erzählsequenz zu finden, die die Betroffenen-Karriere weiter zurückverfolgen läßt. Sofern ein Teil abgeschlossen scheint oder die Antworten abgelehnt werden, bleibt nur die Formulierung einer neuen Frage, um einen neuen Problemkreis anzusprechen, d.h. durch Erzählsequenzen aus tangierenden Lebensbereichen weiteren Aufschluß über die spezifische Karriere zu erhalten. Gerade in dieser Phase ist es wichtig, vorsichtig zu formulieren, um keine Verhörsituation aufkommen zu lassen. Dem Befragte sollte immer das Gefühl vermittelt werden, dass seine subjektiven Erfahrungen und Erlebnissen interessant sind, dass er als Kommunikationspartner jederzeit das Interview abbrechen und Fragen ausweichen oder unbeantwortet lassen kann. Der Interviewer hat immer die Möglichkeit, später evtl. darauf zurückzukommen, entweder wenn der Befragte selbst die Absicht äußert oder wenn die Vertrauensbasis intensiviert wurde oder zum Abschluß des Interviews.
Die Rückgreifstrategien können im Rahmen von Verlaufsinterviews besonders effektiv eingesetzt werden, da der Interviewer die Möglichkeit hat, die Haupterzählung in aller Ruhe nochmals anzuhören und sich auf die nächste Sitzung vorzubereiten. Doch darf dabei nie vergessen werden, dass vorbereitete Fragen möglicherweise nicht gestellt werden können, weil der Partner von sich aus neue Haupterzählungen beginnt, d.h. die Flexibilität des Interviewers muß soweit geschult sein, auf eine neue Erzählsequenz reagieren zu können und nicht an seinen vorbereiteten Fragen festzuhalten. Er muß immer und insbesondere bei Verlaufsbeobachtungen dem Gesprächspartner die Initiative überlassen, denn gerade durch eine so geschaffene Vertrauensbasis ergeben sich teilweise sehr intime und persönliche Erfahrungsschilderungen.
Ebenso realistisch könnte aus der Interviewsituation eine - wenn man so will - ganz ‘normale’ Interaktion entstehen, auch in Form von Erwartungen an den Interviewer in bezug auf Ratschlägen, Informationen, Meinungsäußerungen oder Selbstdarstellungen, die - um den Kommunikationsfluß aufrechtzuerhalten - erfüllt werden sollten.
Problematisch wird es dann - und hier muß der Interviewer sehr vorsichtig agieren -, wenn er eine andere Auffassung vertritt als sein Gegenüber. Weichen die Auffassungen zu sehr von denen des Gesprächspartners ab, kann es sehr leicht zum Abbruch des Interviews kommen und der Forscher merkt erst nach nochmaliger Anhörung des Interviews, welchen Fehler er begangen hat.
Gleichwohl ist auch die zu enge Vertrautheit mit dem Interviewten zu problematisieren (Übertragung/Gegenübertragung, vgl. Kutz 2002); denn es können Erwartungen geweckt werden, die der Interviewer nicht bereit ist zu erfüllen oder besser, die er nicht erfüllen darf, insofern sollte der Forscher bei Verlaufsbeobachtungen unter vier Augen sich der Übertragungsproblematik der Psychoanalyse bewußt sein, um zu enge Bindungen gar nicht erst entstehen zu lassen.
Die letzte Phase des Interviews oder besser der Verlaufsphase bezieht sich mithin auf Bereiche, denen der Interviewte ausgewichen ist oder die er in anderen Phasen verweigert hat. Diese Strategie dient prinzipiell der Plausibilität und weiteren Detaillierung, die darauf abzielen, auch die noch nicht angesprochenen Themen zu behandeln und Mißverständnisse bzw. Unklarheiten zu beseitigen. Die letzte Phase kann auf Wunsch des Befragten auch ohne Tonbandaufzeichnung durchgeführt werden, vor allem dann, wenn er Befürchtungen äußert, die mit der Aufzeichnung zusammenhängen. Aber auch eine Auskunftsverweigerung muß akzeptiert werden. Es sollte nicht der Fehler begangen werden, zum Ende der Verlaufsbeobachtung, die Vertrauensbasis durch unhöfliche oder fordernde Fragestrategien zu zerstören, dies kann nur als eklatanter Verstoß gegen die Mitwirkungsmotivation des Gesprächspartner verstanden werden.
Gerade die freie Entscheidung des Subjekts zu akzeptieren, das Gefühl zu vermitteln, dass der Betroffene eine Situation jederzeit beeinflussen und kontrollieren, Richtung, Form und Umfang der Mitteilungen selbst zu bestimmen kann, dass nicht die Information das Entscheidende ist, sondern die subjektiven Erfahrungen und Geschichten, dass der Befragte nicht einfach als Informationsquelle mißbraucht wird, sind entscheidende Bedingungen zur Wahl des narrativen Interviews.
Bei der Auswertung der Interviews erscheint ein Aspekt - aus meiner Sicht - besonders wichtig. Die Tonbandaufnahmen werden zunächst in Textform gebracht. Auch wenn alle Floskeln (wie hm, ja, lachen, ich verstehe usw.) niedergeschrieben werden, erscheint der Text allein relativ künstlich und die situationalen Zusammenhänge können nicht berücksichtigt werden (vgl. objektive Hermeneutik, reine Textinterpretation).
Erst nachdem ich mir die Tonbandaufzeichnungen nochmals angehört habe, konnte ich den Text und die situationalen Aspekte wieder reproduzieren und bestimmte Unterbrechungen wurden erklärbar oder wenn ein Teil eines Textes fehlte, konnte die neuerliche Anhörung der Aufzeichnungen, die Störfaktoren selektieren (etwa, Kindergeschrei, Hundegebell, Verkehrslärm, kurzes Entfernen des Gesprächspartners usw.). Ein Text, der in Klammern plötzlich ‘Lachen’ enthält, kann als totaler Bruch des Textes aufgefaßt werden oder es stellt sich der Eindruck ein, dass das Lachen fehl am Platze war. Das Lachen bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn die Aufzeichnung abgehört wird, dann wird ‘Lachen’ nämlich situationsspezifisch bewert- und interpretierbar. Der geschriebene Text ‘Lachen’ wirkt wie eine Worthülse und nicht wie eine situationsspezifische Reaktion. Vor diesem Hintergrund erscheint es problematisch, nur einen geschriebenen Interviewtext analysieren zu wollen.
2. Die Relevanz von Forschungsintentionen
Der Literatur zu Folge scheinen sich Methodenartikel (Breuer 2000; Busse, Ehses, Zech 2000; Ertel. 2000; Groeben, Scheele 2000; Mruck, Mey 2000; Witt 2001; Kleining, Witt 2001; Mayring 2001) primär mit theoretischen Implikationen und wissenschaftstheoretischen Verortungsproblemen zu befassen, statt mit an Forschungsintentionen und insbesondere -ergebnissen ausgerichteten Diskussion.
Auf der einen Seite haben wir grundsätzlich eine qualitativ analysierende, primär an theoretischen Ergebnissen orientierte Forschung, eine theoretische Grundlagenforschung, die der Illusion verfallen ist, sie könne Ergebnisse produzieren, ohne Rückgriff auf Vorwissen und subjektive Interpretationsmuster. Sie vermittelt latent, eine objektive Realität abbilden zu können, ohne aber ihr eigenes Erkenntnis- und Regelsystem zu explizieren.
Auf der anderen Seite haben wir eine quantitativ orientierte, primär an der Effektivität eines oder mehrerer Treatments (rsp. retrospektiven Überprüfung einer Theorie, d.h. primär hypothesengeleitete Studien) interessierenden Forschung, die aber nicht - wie präsupponiert wird - primär unter dem Schutz des naturwissenschaftlichen Paradigmas beispielsweise die Wirksamkeit einer Therapie prüft, sondern vielmehr aufgrund ihrer Anwendungsorientierung ganz entscheidende gesellschaftliche Auswirkungen in Form von ökonomischen, gesundheitspolitischen, professionellen sowie sozialen Konsequenzen zeigt; diese jedoch aus der Diskussion ausblendet.
Diese Kennzeichnungen haben, und damit beginnt das Dilemma, einer Paradigmendiskussion Vorschub geleistet, die nicht mehr das Erkenntnisinteresse, die Forschungsintention, die Explikation des spezifischen Regelsystems oder die Kontrolle des Forschungsprozesses in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt, sondern vielmehr die wissenschaftstheoretische Vorortungsproblematik einer jeweils ‘besseren Methodik’.
3. Die Problematik empirischer Kategorien
Die quantitative empirische Forschung arbeitet häufig mit dem Instrument der Befragung, die mit Hilfe eines standardisierten bzw. teilstandardisierten Fragebogens entweder in schriftlicher oder mündlicher Form implementiert wird. Dabei kann oftmals zwischen ex-post oder ex-ante Konzeption nicht differenziert werden. Zwei Beispiele (Kombi-Therapie im Suchtbereich, Diplomarbeit Patientenzufriedenheit 2000) aus jüngster Zeit zeigen, dass die Konzeption eines Fragebogens nicht primär durch das Erkenntnisinteresse bestimmt wird, sondern eine Fragebogenkonstruktion die Basis eines Erkenntnisinteresses zu sein scheint. Dabei wird teilweise unterschlagen, wie die Autoren zu den Items und ihren kategorialen Ausprägungen gekommen sind, ebenfalls fehlen ex-ante Hinweise auf und Begründungen der verwendeten statistischen Tests - eine derzeit weitverbreitete Vorgehensweise, die der empirische Sozialforschung schadet.
Im Jahre 1999 habe ich im Rahmen meiner Dissertation “ Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im Gesundheitswesen - am Beispiel der Onkologie” eine Pilotstudie zur Patientenzufriedenheit initiiert. Basis dieser Studie sind Diskussionen mit theoretischen Ansätzen wie Qualitätssicherung und –kontrolle, Copingforschung, instrumentelle Orientierung, Systemtheorie, Psychoanalyse, Diskurstheorie und symbolischer Interaktionismus. Theoretisch konnte primär die Problematik von Kommunikationsstörungen und mangelndem social support herauskristallisiert werden. Aufgrund dieser Problematik eruierte ich die gegenwärtigen Studiendesigns und deren empirischen Ergebnisse (vgl. Kutz 2001), wobei sich herausstellte, dass generell keine präzisen Faktoren existierten, die die Patientenzufriedenheit bestimmen bzw. die empirisch operationalisiert werden konnten. Die Konstruktion der Fragebögen zeigte Items wie “Wie zufrieden sind sie mit den Ärzten? mit den Ausprägungen “sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, unzufrieden”. Diese Konstruktionen waren unbefriedigend, da sie wenig aussagekräftig sind (vgl.Kutz 2001).
Aufgrund der Problemanalyse (Forschungsintention ex-ante) wurde festgelegt, eine qualitative Exploration durchzuführen, um die Probleme dieses Objektbereiches zu eruieren und einen adäquaten standardisierten Fragebogen für eine spezifische Zielgruppe “onkologische Patienten” zu entwickeln, damit eine quantitative Untersuchung mit einem standardisierten Fragebogen durchgeführt werden konnte. Aufgrund meiner diesbezüglichen Erfahrungen wurde das ‘Narrative Gruppeninterview‘ gewählt, da aus pragmatischen Gründen nur eine Befragung von Selbsthilfegruppen in Betracht kam. (zur Problematik der Durchführung, s. Kutz 2001)
Bei den narrativen Interviews zeigte sich, das zwischen dem, was real noch akzeptiert wird und den individuellen Bedürfnissen eine nicht zu unterschätzende Diskrepanz vorliegt. Dies führte in der Fragebogenkonstruktion dazu, zwischen Realität und Wunsch zu differenzieren.
Um jedoch ansatzweise Vergleichsmöglichkeiten zu berücksichtigen, wurden auch Items aus bereits vorhandenen Studien benutzt. Für die schriftliche Befragung mit einem standardisierten Fragebogen wurde das Prinzip der ‚Rationalität der Beschränkung‘ insofern gewährleistet, als primär die Eruierung von Faktoren, die die Patientenzufriedenheit determinieren, im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stand, also deskriptive Statistik und eine Faktorenanalyse.
Die Inhalte des Fragebogens wurden sowohl innerhalb des Instituts für Soziologie der Universität Regensburg als auch durch einen Pretest geprüft.
Dies zeigt, dass das intendierte Erkenntnisinteresse und die pragmatischen Möglichkeiten die Methodik determinieren und das es notwendig ist, dieses zu formulieren und gerade dadurch das Prinzip der ‘Rationalität der Beschränkung’ ex-ante zu berücksichtigen.
Die Rationalität der Beschränkung ist ein Prinzip, das in der quantitativen Forschung oftmals zu restriktiv und in der qualitativen Forschung sehr selten berücksichtigt wird. (Festzuhalten ist, dass für die Konstruktion des standardisierten Fragebogens ein Zeitraum von 8 Monaten zu Buche schlägt)
Die Auswertung zeigt, dass die Patientenzufriedenheit durch 5 Faktoren bestimmt werden kann:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
die zwei Drittel der Varianz erklären (vgl. Kutz 2001).
Darüber hinaus - und hier komme ich zum Problem der Items und Merkmalsausprägungen -, zeigt sich im Bereich der detaillierteren Kategorien, dass die Interaktionsprobleme zwischen Professionellen und Laien sehr deutlich zum Ausdruck kommen. Der empirisch interessante Aspekt zeigt sich in der Diskrepanz bei der Bewertung von allgemeinen zu differenzierten Kategorien.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab.1: Gesamtzufriedenheit mit Institutionen
Tabelle 1 zeigt ganz offensichtlich sehr allgemeine Kategorien, Zufriedenheit mit dem Krankenhaus, der Rehabilitation und der Nachsorge. Werden diese Kategorien zu Grunde gelegt, dann zeigt sich ein Zufriedenheitsgrad (‘sehr zufrieden’ und ‘zufrieden’) von fast 90%. Die pragmatische Konsequenz wäre eine Interpretation, dass Patienten mit der Qualität der Versorgung zufrieden sind und kein Veränderungsbedarf besteht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Gesamtzufriedenheit mit Personal
Tabelle 2 beinhaltet die Frage nach der Gesamtzufriedenheit mit dem Personal (Ärzte, Pfleger, Schwestern, Arzthelferinnen), mit den Differenzierungen ‘fachliche Kompetenz, Empathie und Gesprächsbereitschaft”. Dabei zeigt sich, dass aufgrund der Differenzierung der Zufriedenheitsgrad abnimmt, bei den Ärzten von Knapp 90% bei der fachlichen Kompetenz auf knapp 75 % bei der Empathie bis auf knapp 70% bei der Gesprächsbereitschaft.
Beim Pflegepersonal werden die Diskrepanzen bereits größer, im Rahmen der fachlichen Kompetenz sind 86% der Patienten zufrieden bzw. sehr zufrieden, im Rahmen der Empathie sind es noch ca. 80% und die Gesprächsbereitschaft zeigt noch einen Zufriedenheitsgrad von 68%.
Mit der fachlichen Kompetenz der Arzthelferinnen sind etwa 88% der Patienten zufrieden, mit der Empathie und der Gesprächsbereitschaft sind ca. 80% der Patienten zufrieden bzw sehr zufrieden. Interessanterweise ist der Zufriedenheitsgrad mit den Ärzten und Arzthelferinnen immer etwas höher als der mit dem Pflegepersonal.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3: Gesamtzufriedenheit mit Informationen
Der Tabelle 3 ist zu entnehmen, dass bei weiterer Differenzierung der Fragen, der Zufriedenheitsgrad stetig sinkt. Bei der Frage “Wie zufrieden waren Sie mit Informationen über ...? sinkt die Zufriedenheit (sehr zufrieden und zufrieden) der Patienten von ca. 65%, sofern es um die ‚Erkrankung‘ geht, auf 60% im Bereich der ‚Therapie‘, 60% ‚Infos über Nachsorge‘, ca. 53% ‚Infos über Hilfsmöglichkeiten‘, auf etwa 49% ‚Infos über Nebenwirkung‘ bis auf ca. 31% bei den Infos über Langzeitfolgen.
Es läßt sich konstatieren, dass der Zufriedenheitsgrad mit dem Grad der Verallgemeinerung von Fragen ansteigt, d.h. je allgemeiner die Kategorien, desto höher der Zufriedenheitsgrad und je detaillierte und problembezogener die Fragen, desto differenzierter der Zufriedenheitsgrad.
Betrachtet man die Antworten im Rahmen der Frage: “Was hat Sie bislang am meisten gestört?” - um nur ein Beispiel zu zeigen, denn ähnliches zeigt sich in den Einzelbereichen wie Diagnose, Therapie, Rehabilitation und Nachsorge, dann verändert sich das Antwortverhalten nochmals (s. Grafik: 1, vgl. Kutz 2001).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Graphik 1: Defizite der Versorgung (Mehrfachnennungen)
Die Diskrepanz zwischen der Beantwortung von allgemeinen Kategorien und direkten Fragen nach spezifischen Problemen läßt sich empirisch nicht übersehen, zeigt aber offensichtlich das Dilemma standardisierter Befragungen.
Zunächst könnte man ein Paradoxon im Antwortverhalten der Befragten unterstellen und dieses Paradoxon akzeptieren. Es entbindet den Forscher von Selbstkritik im Rahmen des konzeptionellen Begründungs- und Verwertungszusammenhanges, von einer kritischen Diskussion mit der eigenen Fragebogenkonstruktion. Es entbindet mithin von der kritischen Diskussion über Defizite der Itemformulierung und deren Merkmalsausprägungen und letztendlich von der Verpflichtung Interviewpartner über den Sinn und die Ziele von spezifischen Fragestellungen und Antworten zu informieren.
Eine andere Interpretation der Ergebnisse offenbart aber auch andere Problemkonstellationen. Betrachtet man die Frage nach der Zufriedenheit mit den Institutionen Krankenhaus, Rehabilitation und Nachsorge, so zeigt sich, dass kein spezifischer Tatbestand abgefragt wird, sondern nur ein genereller Eindruck und dieser orientiert sich primär an der Gesamtheit aller Erlebnisse in den Teilbereichen des Systems Krankenbehandlung. Dabei wird vorwiegend die realisierte Intention in die Bewertung einfließen, hat die Behandlung zur Kuration geführt oder sind im Rahmen der Palliation spezifische Funktionseinschränkungen bzw. -störungen kompensiert worden oder hatte die Behandlung keinen Erfolg? Das primäre Bedürfnis der Kunden/Patienten an das System der Krankenbehandlung ist die Wiederherstellung der Gesundheit.
Darüber hinaus spielen Faktoren der Erfahrungen mit dem System eine entscheidende Rolle. Lange Wartezeiten werden akzeptiert, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass lange Wartezeiten zur Realität dieses Systems gehören. Überflüssige Diagnostik oder Doppeluntersuchung werden akzeptiert, weil auch hier die Erfahrung gelehrt hat, dass es anscheinend keine Alternative gibt. Informationsmangel wird akzeptiert, weil es immer schon so war oder weil man selbst nicht unbedingt alle Informationen wissen möchte oder schlicht Angst hat, Fragen zu stellen. Hinzu kommt die Vermittlung der Profession, auf Fragen des Laien unfreundlich oder überheblich zu reagieren bzw. einen permanenten Zeitmangel zu vermitteln, so dass der Kunde sich gar nicht zu fragen traut. Die Verwendung von Fachbegriffe vermittelt dem Kunden ebenfalls, dass er von der Materie nichts versteht und es besser der Profession überlassen sollte, was gut für ihn ist.
Auf der einen Seite wird Compliance auf der Grundlage von Vertrauen und Glauben erwartet, auf der anderen Seite werden Informationen aber nur latent oder partiell vermittelt und der Patient nicht als Partner akzeptiert. Diese professionelle Auffassung gipfelt dann auch in der Formulierung der Fragen in Patientenzufriedenheitsstudie, wie z. B. “Welchen Gesamteindruck haben Sie von unserer Klinik?” (unveröffl. Diplomarbeit 2001) oder “Wie fühlten Sie sich über Behandlung, Eingriffe und andere oder weitere Behandlungsmöglichkeiten informiert?” (Viethen et.al. 1997) oder “Wie verhielt sich unser Personal im allgemeinen zu Ihnen?” (Spießl et.al. 1997)
Problematisch ist insbesondere die mangelnde Bedürfniseruierung der Patienten im Rahmen der Konstruktion von Fragebögen und Frageformulierungen. Die Operationalisierung des Konstruktes Patientenzufriedenheit fehlt zumeist völlig, der Allgemeinheitsgrad der Fragen, die unpräzise Formulierung, die Vernachlässigung der Begründungspflicht in bezug auf das Erkenntnisinteresse und fehlendes Problembewußtsein gegenüber den realen Patientenbedürfnisse.
Die Fragen sind so formuliert, dass fast ausschließlich Gesamteindrücke oder Gefühle angesprochen werden, nicht in einem dieser Fragebögen werden die oben genannten Faktoren operationalisiert. Es wird nicht einmal ansatzweise diskutiert, mit Hilfe welcher adäquaten Mittel die Patientenbedürfnisse erfragt werden könnten. Es scheint bei diesen Fragebögen eher um eine Legitimation und Bestätigung ‘guter qualitativer’ Versorgung zu gehen als um Zufriedenheit von Patienten mit der Versorgungsinstitution. Defizite, Mängel und Patientenerwartungen werden aus den Fragebögen ausgeblendet.
Das Ziel von Patientenzufriedenheitsstudien ist - gemäß dem Verständnis der Qualitätssicherung - die Kontrolle einer bedarfs- und bedürfnisadäquaten Kranken-/ Patienten-/ Kundenversorgung, um zu eruieren, mit welchen Rahmenbedingungen die Kundendürfnisse korrepondieren oder in welchen Bereichen der Versorgung Defizite, Probleme oder Mängel so gravierend sind, dass das Versorgungsangebot modifiziert werden muß. Patientenzufriedenheitsstudien, die aus Gründen rationeller Datenverarbeitung und Auswertung primär quantitativ orientiert sind, sollten insbesondere die Kundenbedürfnisse eruieren und - nicht wie es derzeit geschieht - nur danach fragen, wie zufrieden die Patienten mit dem Krankenhaus, den Ärzten, Pflegern/Schwestern, dem Service oder den Hotelleistungen sind. Dadurch werden die Bedürfnisse der Patienten nicht erfaßt, sondern eher die Bedürfnisse der Professionen nach Bestätigung eines immer schon vermittelten guten Qualitätsniveaus der Versorgung.
4. Schlußfolgerungen
Rekurrierend auf den Beginn dieser Arbeit stellt sich nicht die Frage nach einem Diskurs über qualitative oder quantitative Paradigmen der Sozialforschung, sondern für die Sozialforschung ist entscheidend zwischen theorieorientierter und angewandter Forschung zu differenzieren. Angewandte Forschung impliziert prinzipiell die Frage nach einer von der jeweiligen Zielorientierung abhängenden Forschungsrationalität und einem adäquaten Forschungspragmatismus. Dabei ist nicht die Art der methodischen Instrumente entscheidend, sondern das bzw. die adäquaten Instrumente einzusetzen, die eine spezifische Beantwortung des (ex-ante) Erkenntnisinteresses gewährleisten. Dies gilt sowohl für quantitative als auch qualitative Verfahren.
Die temporäre und ökonomische Rationalität kann nicht dadurch außer Kraft gesetzt werden, dass restriktive Paradigmen die Forschungsintentionen determinieren und ökonomische, personelle, finanzielle und wissenschaftliche Ressourcen defizitär kanalisieren. Erst eine Verschränkung beider Paradigmen im Netzwerk einer erkenntnisorientierten Forschung impliziert die Reflexion auf genuin erkenntnisbezogene Intentionen, nämlich Beobachtung, Analyse, Reflexion und Veränderung von Gesellschaft.
Während die quantitative Forschung grundsätzlich eine eindeutiges Regelsystem expliziert - obwohl dieses Regelsystem (ex-ante Hypothesen, Operationalisierungen und diesbezüglich auch ex-ante Auswertungsstrategien) häufig verletzt wird -, verstellt die qualitative Forschung sich aufgrund ihres permanenten Legitimationszwanges und ihrer teils rigiden Paradigmen ‘Prinzip der Offenheit’ und ‘Prinzip des Verzichts auf ex-ante-Hypothesen’ (Hoffmann-Riem 1980) den Weg zu einer pragmatischen Rationalität der Forschung.
Die quantitative Forschung wiederum verstelllt sich aufgrund ihres naturwissenschaftlichen Paradigmas, was nichts anderes heißt als jeden zu erforschenden Objektbereich in mathematische Modelle zwängen zu können (was die Rationalität der Beschränkung außer Kraft setzt), den Weg zu interdependenten Kontexten sozialen Geschehens, sie verschließt sich dadurch einem Erkenntnisgewinn im Hinblick auf Veränderbarkeit und Dynamik sozialer Phänomene, die eben nicht mit experimentellen bzw. quasi experimentellen Designs (Campbell 1973) erfaßt werden können.
Die qualitative Forschung ist leider z. T. der Illusion verfallen, sie könne Alltagserfahrung, Alltagstheorien, implizite Persönlichkeitstheorien und ihre professionelle Sozialisation vergessen und einen Objektbereich quasi objektivierend beobachten, oder sie könne, was sie unglaubwürdig macht, universelle Strukturen (Oevermann 1979) - in welcher Form auch immer - eruieren.
Abschließend ist zu konstatieren, dass qualitative Forschung ungleich zeitaufwendiger ist, vom Forscher besondere kommunikative und interpretative Kompetenzen und Schulungen verlangt, auch im Rahmen teilnehmender oder nicht-teilnehmender Beobachtung. Präzise Beschreibungen sowie Analyse- und Abstraktionsfähigkeiten sind ebenfalls nicht zu unterschätzende Kompetenzen, um soziologisch relevante Aspekte aus Deskriptionen extrahieren zu können.
Qualitative Forschungen großer Populationen oder Objektbereiche können aber nur - Rationalität der Beschränkung - unter erheblichem Aufwand personeller, zeitlicher und finanzieller Ressourcen durchgeführt werden. Das Prinzip der Repräsentativität ist häufig aufgrund der kleinen Zahlen reduziert, die Validität kann nur über Konsentierungen bzw. Qualitätskontrolle erreicht werden, die Reliabilität – Zuverlässigkeit der Daten, wird das gemessen, was gemessen werden soll? – wird aus der Diskussion ausgeblendet, da dies zwingend voraussetzen würde, das die Zielorientierung und das Erkenntnisinteresse ex-ante expliziert werden müßten. Reliabilität ist ebenfalls der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle von Forschungen und Forschungsberichten zu subsumieren.
In der quantitativen Forschung wäre es sinnvoll, wenn eine Rückbesinnung auf tradierte Verfahrensregeln im Hinblick auf ein ex-ante Hypothesenbildung, eine fachlich präzise Operationalisierung der zu prüfenden Hypothesen, der Begründungs- und Verwertungszusammenhang sowie eine ex-ante festgelegte Auswertungsstrategie mit den zu verwendenden statistischen Tests gewährleistet wird. Wissenschaftliche Ansprüche der empirischen Sozialforschung in der Soziologie können nicht durch Mediziner, Ökonomen oder Mathematiker allein gewährleistet werden. Ein Fragebogen für die Erforschung eines Objektbereiches darf nicht durch eine willkürliche subjektive Zusammenstellung verschiedener veröffentlichter Fragebögen als wissenschaftlicher Standard verkauft werden, und Begründungs- und Verwertungszusammenhänge orientieren sich am wissenschaftlichen Erkenntnisinteresse und nicht an einem ad hoc erstellten Fragekatalog.
Gegen eine Kontroverse zwischen qualitativer und quantitativer Forschung spricht ebenfalls, dass nicht das methodische Paradigma entscheidend ist, sondern die Rationalität der Beschränkung manifestiert sich durch das Prinzip der adäquaten Methodik im Hinblick auf die forschungslogische bzw. forschungspragmatische Intention unter besonderer Berücksichtigung des explizit, und zwar ex-ante formulierten Erkenntnisinteresses, sei es in Form von Hypothesen, Arbeitshypothesen, Fragestellungen oder sei es in Form von Deskriptionen. Die Forschung, welcher Art auch immer - muß zielorientiert bzw. erkenntnisorientiert sein, und dies ist zu formulieren.
Das derzeitige Dilemma der empirischen Forschung, ließe sich nur dadurch lösen, dass Forschung, ob nun theoretischer und pragmatischer Intentionalität sich dem Primat der Qualität und Qualitätskontrolle von Studien und Studienveröffentlichungen prinzipiell unterordnet. Anforderungsprofile dürfen sich nicht nur auf die Systematik von Studiendesigns, Studienberichten und anderen Veröffentlichungen beziehen, sondern es wäre sinnvoll, ein neutrales interdisziplinäres Gremium zentral zu etabliert, das Forschung auch kontrollieren kann und darf, sowohl im Hinblick auf Konzeption, Einsicht in die Studienunterlagen als auch im Hinblick auf direkte Implementationskontrolle, also Prozeßkontrolle.
Literatur
Altenhofen, L., Brenner, G., Flatten, G., Hofstädter, F., Kutz, R., Oliveira, J.: Modellprojekt ‘Früherkennung des kolorektalen Karzinoms’, Abschlußbericht, Köln, 1999, ZI Wissenschaftliche Reihe - Band 55, Köln 1999
Anger, H.: Befragung und Erhebung, in C. F. Graumann (Hrsg.): Handbuch der Psychologie, Bd. 7, 1.HB, Göttingen 1969: 606-610
Antonovsky, A.: “Health, Stress and Coping”. San Francisco, 1979.
Appelt, H./Straub, B.: “Anwendungen einzelfallstatistischer Methoden in Psychosomatik und Klinische Psychologie”. Springer. Heidelberg 1985.
Atteslander, P./Kneubühler H.-U.: Verzerrungen im Interview Opladen 1975
Bauch, Jost: Psychosomatik als Paradigma, MMG 4 (1979) 199-202
Becker, P.: “Der Interaktions-Angst-Fragebogen”. Testheft und Manual. Weinheim, 1980.
Bredenkamp, J./Feger, H. (Hrsg.): “Hypothesenprüfung. Enzyklopädie der Psychologie”, The-menbereich B, Serie 1, Bd. 5. Göttingen 1982, Hogrefe.
Breuer, Franz: Qualitative Methoden zur Untersuchung von Biographien, Interaktionen und lebensweltlichen Kontexten: Die Entwicklung eines Forschungsstils Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], Volume 1, No. 2 – Juni 2000
Busse, Stefan, Christiane Ehses & Rainer Zech: Kollektive-Autobiografie-Forschung (KAF) als subjektwissenschaftliche Methode, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], Volume 1, No. 2 – Juni 2000
Campbell, D. T./Stanley, J. C.: Experimental and Quasiexperimental Designs for Research on Teaching, in N. L. Gage (Ed.): Handbook of Researchon Teaching, Chicago 1963: 171-146
Cattel, Raymond B.: Handbuch der multivariaten expeerimentellen Psychologie, Frankfurt/M 1980
Coelho, G.V., D.A. Hamburg/Adams J.E. (Eds.): “Coping and adaption”. Basic Books, New York 1974.
Corbin, J.; Strauss, A. (1990): Grounded Theory Research. Procedure, Canons and Evaluative Criteria, Zsch. f. Soz. 19, 6, 418-427
Cox, D.R./Oakes, D.: Analysis of Survival Data, University Press, Cambridge 1984
Dick Michael: Die Anwendung narrativer Gridinterviews in der psychologischen Mobilitätsforschung. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], Volume 1, No. 2 – Juni 2000
Diehl, Joerg M.: Statistik mit SPSS für Windows, Frnakfurt/M 1997
Deppermann, Arnulf: Gesprächsforschung im Schnittpunkt von Linguistik, Soziologie und Psychologie. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], Volume 1, No. 2 – Juni 2000
Ertel, Irmentraud. Qualitative Familien- und Kommunikationsforschung
Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], 1 (2). Verfügbar über: http://qualitative-research.net
Fuchs, Werner: “Biographische Forschung”. Westdeutscher Verlag. Opladen 1984.
Friedrichs, Jürgen: Methoden empirischer Sozialforschung, Hamburg 1973
Holmes, David: Verdrängung und Interferenz, in Eysenck/Wilson: Experimentelle Studien zur Psychoanalyse Sigmund Freuds, Wien 1973: 209 ff.
Gerhardt, Uta: Erzähldaten und Hypothesenkonstruktion, KZSS 37 (1985): 231-256
Glaser, Wilhelm. R.: Varianzanalyse, Stuttgart-New York 1978
Groeben, Norbert & Brigitte Scheele: Dialog-Konsens-Methodik im Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], Volume 1, No. 2 – Juni 2000
Habermas, J.: Thesen zur Theorie der Sozialisation, MS-Druck, Frankfurt/M 1968
Heinz, Walter, R.: Lebenslauf als Soziobiographie, Bremer Beiträge zur Psychologie, Reihe A: Psychologische Forschungsberichte Nr. 9, 1983
Hettlage, Robert: Klassiker der zweiten Generation: Erving Goffman, in Hettlage, Robert/Lenz, Karl (Hrsg.): Erving Goffman - ein soziologischer Klassiker der zweiten Generation, Bern-Stuttgart 1991: 385-441
Hoffmann-Riem, Christa: Die Sozialforschung einer interpretativen Soziologie, KZSS 32 (1980): 339-372
Höffling, Christian, Christine Plaß & Michael Schetsche: Deutungsmusteranalyse in der kriminologischen Forschung Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal],Volume 3, No. 1 – Januar 2002
Holm, Kurt (Hrsg.): Die Befragung 1, München 1975
Jäger, Reinhold, S./ Nord-Rüdiger, Dietlinde: Biographische Analyse, KZSS 36 (1985): 62-82
Jüttemann, Gerd (Hrsg.): Qualitative Forschung in der Psychologie, Weinheim-Basel 1985
Katschnig, H. (Hrsg.): “Sozialer Streß und psychische Erkrankung”. München – Wien – Baltimore, 1980.
Kleining, Gerhard & Witt, Harald (2001, February). Discovery as Basic Methodology of Qualitative and Quantitative Research [81 paragraphs]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Verfügbar über http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs.htm
Kohli, Martin: Die Institutionalisierung des Lebenslaufes, Kölner Zschr. f. Soz. u. Soz-psych 37 (1985): 1-29
Kraus, Wolfgang: Identitäten zum Reden bringen. Erfahrungen mit qualitativen Ansätzen in einer Längsschnittstudie. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], Volume 1, No. 2 – Juni 2000
Krenz, Helga, Hendrik Olandt: Zufriedenheit mit der Klinik steigt im Alter, Gesundheit und Gesellschaft, 12/1999: 20-21
Kutz, R.: Die Psychoanalytische Theorie und die Möglichkeiten ihrer empirischen Überprüfung, unveröffentl. Dipl-Arbeit, Hamburg 1983
Kutz, R.: Empirischer Zwischenbericht Teil I und II, Münster 1994
Kutz, R.: Empirischer Endbericht - Auswertung der Dokumentation des Informationsbüros Pflege, Münster 1995,
Kutz, R.: Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle im Gesundheitswesen - am Beispiel der Onkologie – Tranfer Verlag, Regensburg 2001
Lienert, Gustav, A.: Testaufbau und Testanalyse, Weinheim-Berlin-Basel 1969
Mayring, Philipp: “Erträgnisse biographischer Forschung in der Sozialpsychologie”. Augsburger Berichte zur Entwicklungspsychologie und pädagogischen Psychologie Nr. 7. 1986.
Mayring, Philipp: Kombination und Integration qualitativer und quantitativer Analyse
Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [Online Journal], Volume 2, No. 1 – Februar 2001
Meinefeld, Werner: Ex-ante Hypothesen in der qualitativen Sozialforschung: zwischen ‘fehl am Platz’ und unverzichtbar, Zeitschrift für Soziologie 1 (1997): 22-34
Meinefeld, Werner: Die Rezeption empirischer Forschungsergebnisse - eine Frage von Treu und Glauben? Zeitschr. f. Soz. 4 (1985): 297-314
Merton, Robert, K./ Kendall, Patricia, L.: Das fokussierte Interview, American Journal of Sociology, Bd. 51, (1945/46):541-557
Mey, Günter: Qualitative Forschung und Prozeßanalyse. Überlegungen zu einer "Qualitativen Entwicklungspsychologie"
Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research [On-line Journal], Volume 1, No. 1 – Januar 2000. Verfügbar über: http://qualitative-research.net
Mruck, Katja; Mey, Günther: Qualitative Sozialforschung in Deutschland, Volume 1, No. 1 – Januar 2000, Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 1(2). Verfügbar über http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs.htm
Nassehi, Armin, Saake, Irmhild: Kontingenz: Methodisch verhindert oder beobachtet. Zschr. f. Soz, Jg. 31, Heft 1, 2002: 66-86
Oevermann, Ulrich: Sozialisationstheorie, KZSS (1982):143-167
Oevermann, Ulrich: Programmatische Überlegungen zu einer Theorie der Bildungsprozesse und zur Strategie der Sozialisationsforschung,
Oevermann, U./Tillman Allert/ Elizabeth Konau/ Jürgen Krambeck: Die Methodologie einer “objektiven Hermeneutik” und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften, in Soeffner (Hrsg.):Interpretative Verfahren in den Sozial- und textwissenschaften, (1979): 352-433
Ostendorf, Fritz/ Angleitner, Alois/Ruch, Willibald: Die Multitrait-Multimethod Analyse, Göttingen-Toronto-Zürich 1986
Prystav, Günther: Die Bedeutung der Vorhersagbarkeit und Kontrollierbarkeit von Stressoren für Klassifikationen von Belastungssituationen, Zschr. f. klein. Psychologie, 8 (1979), S.283-301
Quekelberghe, Renaud van: “Albert und Sigrid – eine Einführung in die Lebenslaufanalyse.” Landauer Studien zur klinischen Psychologie, Bd. 4, Landau. 1985.
Reichertz, Jo: Verstehende Soziologie ohne Subjekt, KZSS 40 (1988) 207-222
Scheuch, Erwin: Das Interview in der Sozialforschung, in R. König (Hrsg.): Handbuch der empirischen Sozialforschung, Bd. 2; Stuttgart 1973
Schneider, Gerald: Hermeneutische Strukturanalyse von qualitativen Interviews, KZSS 40 (1988): 223-244
Schütze, F.: Die Technik des narrativen Interviews in Interaktionsfeldstudie, Arbeitsberichte und Forschungsmaterialien der Fakultät für Soziologie, Bielefeld 1977
Seyfarht-Metzger, I; Satzinger, W.; Lindemmeyer, T: Patientenbefragung als Instrument des Qaulitätsmanagements, Das Krankenhaus, 12/97: 739-744
Siegel, S.: “Nichtparametrische statistische Methoden”. Fachbuchhandlung für Psychologie. Frankfurt/M. 1985
Sorbin, L./Wittekind, Ch.: TNM-Klassifikation maligner Tumore, 5. Auflage 1997
Spießl. H.; Cording, C.; Klein H.E.: Qualitätssicherung durch Patientenbefragung, ZaeFQ 91/1997: 761-765
Strübing, Jörg: Just do it? Zum Konzept der Herstellung und Sicherung der Qualität in grounded theory-basierten Forschungsarbeiten. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Jg. 54, Heft 2, 2002: 318-342
Ullrich, Karsten, G.: Deutungsmusteranalyse und diskursives Interview, Zeitschrift für Soziologie 6 (1999): 429-447
Viethen, G.; Dombert, T.; Klinger, M.; Lachmann, S.; Bürk, C.: Ein Trendinstrument zur Erhebung von Patientenzufriedenheit: Die Lübecker Fragebogen-Doppelkarte, Gesundh.Ökon. Qual.manag. 2/1997: 50-53
Voß, Werner: Praktische Statistik mit SPSS, München, Wien 1997
Widmer, Jean: Goffman und die Ethnomethodologie, in Hettlage, Robert/Lenz, Karl (Hrsg.): Erving Goffman - ein soziologischer Klassiker der zweiten Generation, Bern-Stuttgart 1991: 211-242
Willems, Herbert: Goffmans qualitative Sozialforschung, Zeitschrift für Soziologie 6 (1996): 438-455
Wittekind, Christian/ Tannenapfel: Ätiologie, Pathogenese und Pathologie des Rektum-Karzinoms, Der Onkologe 1 (1995): 4-9
Witzel, Andreas: Das problemzentrierte Interview
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Textes "Qualitätsmanagement in der empirischen Sozialforschung - Qualitative vs. quantitative Sozialforschung – Rudolf Kutz"?
Der Text befasst sich mit der Relativierung empirischer Paradigmen in Bezug auf die Diskussion der 'besseren Methodik' in der Sozialforschung, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Er untersucht die Zielorientierung empirischer Forschung, die Unterscheidung zwischen theorieorientierter und angewandter Forschung und die Qualität von Forschungen im Rahmen von Konzeptionen, Kategorien, Auswertungsstrategien und Veröffentlichung.
Welche Kritik wird an quantitativen Forschungsansätzen geübt?
Es wird kritisiert, dass quantitative Studien oft nur oberflächliche Konzeptionen liefern, der Forschungsprozess selten kontrolliert wird und zwischen ex-post und ex-ante Konzeptionen nicht mehr differenziert werden kann. Die Hämoccult-Studie wird als Beispiel angeführt, in dem es Probleme mit der Datenselektion und -interpretation gab, was möglicherweise zu falschen Entscheidungsgrundlagen für die Einführung des Tests in die Regelversorgung führte. Es wird auch darauf hingewiesen, dass Therapiestudien oft von der Pharmaindustrie kontrolliert werden, was die Objektivität der Ergebnisse in Frage stellt.
Welche Probleme werden in Bezug auf qualitative Sozialforschung angesprochen?
Es wird bemängelt, dass qualitative Forschung sich aufgrund des Prinzips der 'Offenheit' oft jeder Qualitätskontrolle entzieht. Die 'objektive Hermeneutik' wird als Beispiel genannt, deren prognostizierte Ergebnisse bisher nicht vorliegen. Der Ansatz des 'diskursiven Interviews' wird kritisiert, weil er dem Prinzip der Offenheit widerspricht und Manipulationsvariationen durch den Interviewer nicht thematisiert werden.
Welche Herausforderungen ergeben sich bei der Durchführung narrativer Interviews?
Es werden verschiedene Herausforderungen bei narrativen Interviews angesprochen, darunter die Anpassung an die Alltagssprache der Interviewpartner, die Problematisierung der Tonbandaufnahme, geschlechtsspezifische Unterschiede in der Erzählweise und die Berücksichtigung der Verbalisierungsfähigkeit der Gesprächspartner. Es wird betont, dass der Interviewer eine Vertrauensbasis schaffen und eine kongruente Sprachebene vermitteln muss, um eine wahrhaftige Kommunikation zu ermöglichen.
Was ist die "Rationalität der Beschränkung" und welche Bedeutung hat sie in der empirischen Forschung?
Die "Rationalität der Beschränkung" ist ein Prinzip, das in der quantitativen Forschung oft zu restriktiv und in der qualitativen Forschung sehr selten berücksichtigt wird. Es bezieht sich auf die Notwendigkeit, das Erkenntnisinteresse und die pragmatischen Möglichkeiten bei der Wahl der Methodik zu berücksichtigen und das Forschungsdesign entsprechend zu beschränken.
Welche Schlussfolgerungen werden aus der Studie zur Patientenzufriedenheit gezogen?
Die Studie zeigt, dass die Patientenzufriedenheit durch fünf Faktoren bestimmt werden kann, die zwei Drittel der Varianz erklären. Es wird festgestellt, dass der Zufriedenheitsgrad mit dem Grad der Verallgemeinerung von Fragen ansteigt, d.h. je allgemeiner die Kategorien, desto höher der Zufriedenheitsgrad und je detaillierter und problembezogener die Fragen, desto differenzierter der Zufriedenheitsgrad. Es wird kritisiert, dass Patientenzufriedenheitsstudien oft die Kundenbedürfnisse vernachlässigen und eher die Bedürfnisse der Professionen nach Bestätigung eines guten Qualitätsniveaus der Versorgung widerspiegeln.
Welche Empfehlungen werden zur Verbesserung der empirischen Forschung gegeben?
Es wird empfohlen, dass quantitative Studien stärker von neutralen Organisationen kontrolliert werden und Qualitätsstandards für Konzeption, Implementation, Auswertung und Ergebnispräsentation formuliert werden. Studienergebnisse sollten kritisch geprüft werden, insbesondere wenn sie als Entscheidungsgrundlage dienen sollen. Qualitative Forschungsansätze sollten Ergebnisse vorweisen, die theoretische oder pragmatische Relevanz besitzen. Es wird betont, dass die Forschung ziel- bzw. erkenntnisorientiert sein und sich dem Primat der Qualität und Qualitätskontrolle unterordnen muss.
- Citar trabajo
- Rudolf Kutz, Dr. (Autor), 2002, Qualitätsmanagement in der empirischen Sozialforschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/108269