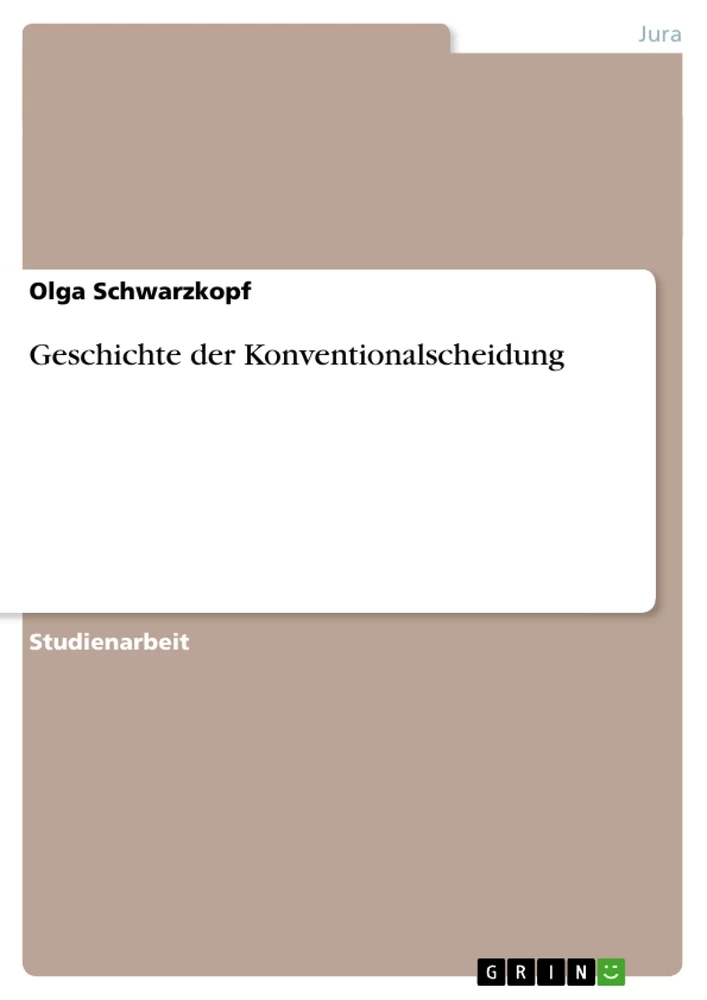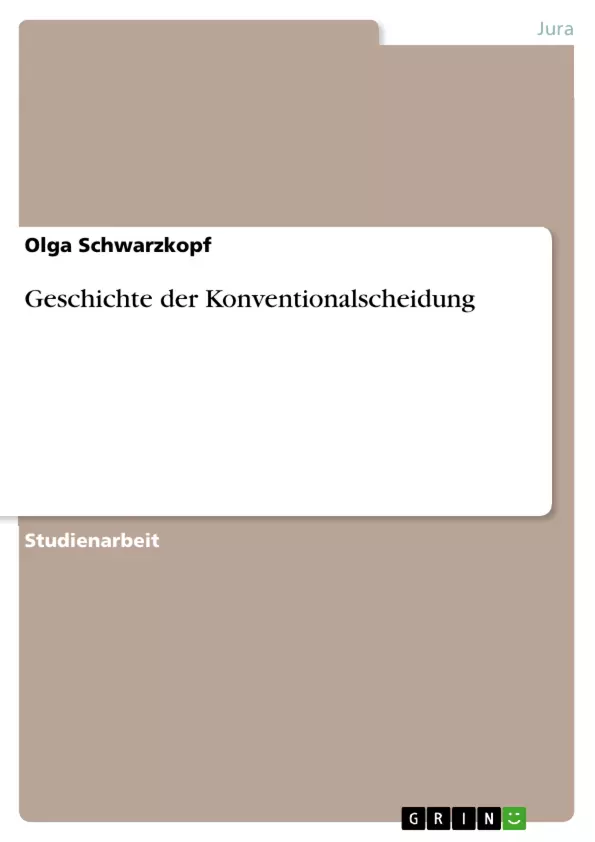Die Geschichte des Scheidungsrechts war in der Vergangenheit zahlreichen Veränderungen unterworfen. Nach deutschem Recht ist heute die Scheidung der Ehe in den §§ 1564 – 1588 BGB1 geregelt. Unter einer Ehescheidung versteht unser Recht die Auflösung der Ehe durch gerichtliches Urteil mit der Wirkung für die Zukunft aufgrund bestimmter Scheidungsgründe. Das Gesetz kennt nur noch einen Scheidungsgrund, die Zerrüttung der Ehe. Die Konventionalscheidung, oder einverständliche Scheidung, die als unwiderlegliche Vermutung für die Zerrüttung einer Ehe dient, ist zum gesetzlichen Institut geworden2. Jedoch ist die nach § 1565 I anerkannte Form der einverständlichen Scheidung sehr kompliziert und scheint auf eine praktische Erschwerung hinauszulaufen. Der beiderseitige Scheidungswille der Ehegatten begründet nur unter bestimmten Voraussetzungen und Erfordernissen, wie z.B. die Erfordernis, dass die Ehegatten 1 Jahr getrennt leben oder die zusätzlichen Voraussetzungen des § 630 ZPO, die unwiderlegliche Vermutung für das Scheitern der Ehe. Während die Freiheit eine Ehe einzugehen ein anerkannter Grundsatz der Rechtsprechung ist3, scheint die Scheidung der Ehe allein aufgrund des übereinstimmenden Willens der Ehegatten keineswegs solch ein unabdingbares Prinzip zu sein. Da die Ehe nach §§ 1564 S.1, 1565 I nur durch Urteil und bei Vorliegen eines Scheidungsgrundes, der Zerrüttung der Ehe, geschieden werden kann, sind die Möglichkeiten zur privatautonomen Beendigung der ehelichen Rechtsbeziehungen beschränkt4. Hier steht das Interesse des Staates, die Ehe als Grundlage der Familie aufrechtzuerhalten und das christliche Eheideal mit dem Grundsatz der lebenslangen Bindung5 im Spannungsfeld zur dem im bürgerlichen Recht geprägten Grundsatz der Privatautonomie der Rechtssubjekte6.
Gegenstand der Arbeit ist die rechtsgeschichtliche Entwicklung der Konventionalscheidung. Hierzu ist zunächst der Begriff der Konventionalscheidung zu erläutern und abzugrenzen. Es soll vor allem dargestellt werden wie schon Ursprünge der unterschiedlichen Grundeinstellungen zu der Scheidung auf die rechtliche Gestaltung der Konventionalscheidung und die gegenwärtige Argumentation eingewirkt haben. Hierbei soll die Frage nach dem Einfluss individueller und staatlicher Interessen auf die gesetzgeberische Entscheidung für oder gegen eine Konventionalscheidung erläutert werden. Schließlich sollen die Argumente für und gegen die Konventionalscheidung gegenübergestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Konventionalscheidung nach heutigem Recht
- I. Begriff und Abgrenzung
- II. Verfahren der einverständlichen Scheidung
- III. Zusammenfassung
- C. Geschichte der Scheidung und die Einführung der Konventionalscheidung
- I. Einführung der Konventionalscheidung im 18. Jhd.
- II. Gründe für die Einführung
- 1. Naturrechtsschule
- 2. Gründe für die Beschränkung der Konventionalscheidung
- III. Zusammenfassung
- D. Abschaffung der Konventionalscheidung im 19. Jhd.
- I. Rechtslage
- II. Gründe für die Abschaffung
- 1. Einfluss der Religion
- 2. Ehe als Institution
- 3. Staatliche Interessen
- III. Zusammenfassung
- E. Neuere Reformen und Fortwirkung der Theoriengeschichte
- I. Das 1. EheRG und Zerrüttungstatbestand
- II. Gründe und Hintergrund der Reform
- F. Kontroverse um die Konventionalscheidung
- I. Argumente gegen die Konventionalscheidung
- 1. Religion/Form der Ehe
- 2. Gefahr von unfreiwilligen Einverständnissen
- 3. Scheidungsstatistik
- 4. Überschreitung der Privatautonomie
- II. Argumente für die Konventionalscheidung
- 1. Schutz der Privatsphäre
- 2. Aussicht auf Versöhnung
- 3. Einheit zwischen Religion und Realität
- III. Ergebnis
- I. Argumente gegen die Konventionalscheidung
- G. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte der Konventionalscheidung im deutschen Recht. Sie analysiert die Einführung, Abschaffung und Wiederaufnahme dieses Rechtsinstituts und untersucht die zugrundeliegenden rechtlichen, gesellschaftlichen und religiösen Motive.
- Die historische Entwicklung der Konventionalscheidung im deutschen Recht
- Die rechtlichen und gesellschaftlichen Gründe für die Einführung und Abschaffung der Konventionalscheidung
- Der Einfluss der Religion auf die Entwicklung des Scheidungsrechts
- Die Rolle der Ehe als Institution und ihre Bedeutung für die Gesellschaft
- Die Kontroverse um die Konventionalscheidung in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema und die Vorgehensweise der Arbeit.
- Kapitel B beschreibt die Konventionalscheidung nach heutigem Recht und erläutert die rechtlichen Grundlagen und das Verfahren.
- Kapitel C beleuchtet die Einführung der Konventionalscheidung im 18. Jahrhundert und untersucht die Gründe für diese Entwicklung. Hierbei werden insbesondere die Rolle der Naturrechtsschule und die Einschränkungen der Konventionalscheidung im Detail betrachtet.
- Kapitel D analysiert die Abschaffung der Konventionalscheidung im 19. Jahrhundert und identifiziert die maßgeblichen Faktoren, wie den Einfluss der Religion, die Bedeutung der Ehe als Institution und die staatlichen Interessen.
- Kapitel E behandelt neuere Reformen und die Fortwirkung der Theoriengeschichte, wobei das 1. EheRG und der Zerrüttungstatbestand im Vordergrund stehen. Auch die Gründe und Hintergründe dieser Reform werden beleuchtet.
- Kapitel F stellt die Kontroverse um die Konventionalscheidung dar und beleuchtet die Argumente für und gegen dieses Rechtsinstitut.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Begriffe, die in dieser Arbeit behandelt werden, sind: Konventionalscheidung, Scheidungsrecht, Ehe, Familie, Religion, Staat, Naturrecht, Privatautonomie, Zerrüttungstatbestand, Rechtsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Konventionalscheidung?
Die Konventionalscheidung bezeichnet die einverständliche Scheidung der Ehegatten, die heute im deutschen Recht als unwiderlegliche Vermutung für die Zerrüttung einer Ehe dient.
Wann wurde die Konventionalscheidung erstmals eingeführt?
Die Konventionalscheidung wurde bereits im 18. Jahrhundert eingeführt, maßgeblich beeinflusst durch die Lehren der Naturrechtsschule.
Warum wurde die einverständliche Scheidung im 19. Jahrhundert abgeschafft?
Gründe für die Abschaffung waren vor allem der starke Einfluss der Religion, das Verständnis der Ehe als unauflösliche Institution und staatliche Interessen an der Stabilität der Familie.
Welche Voraussetzungen gelten heute nach § 1565 BGB für eine einverständliche Scheidung?
Voraussetzung ist in der Regel, dass die Ehegatten seit mindestens einem Jahr getrennt leben und beide den Willen zur Scheidung bekunden, was die Zerrüttung der Ehe vermuten lässt.
Was sind die Hauptargumente gegen die Konventionalscheidung?
Kritiker führen religiöse Bedenken an, warnen vor der Gefahr unfreiwilliger Einverständnisse und befürchten eine Entwertung der Ehe durch zu einfache Auflösungsmöglichkeiten.
Welche Vorteile bietet die Konventionalscheidung den Ehegatten?
Sie schützt die Privatsphäre der Beteiligten, vermeidet belastende Schuldzuweisungen im Prozess und lässt Raum für eine friedliche Einigung.
- Citar trabajo
- Olga Schwarzkopf (Autor), 2002, Geschichte der Konventionalscheidung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11006