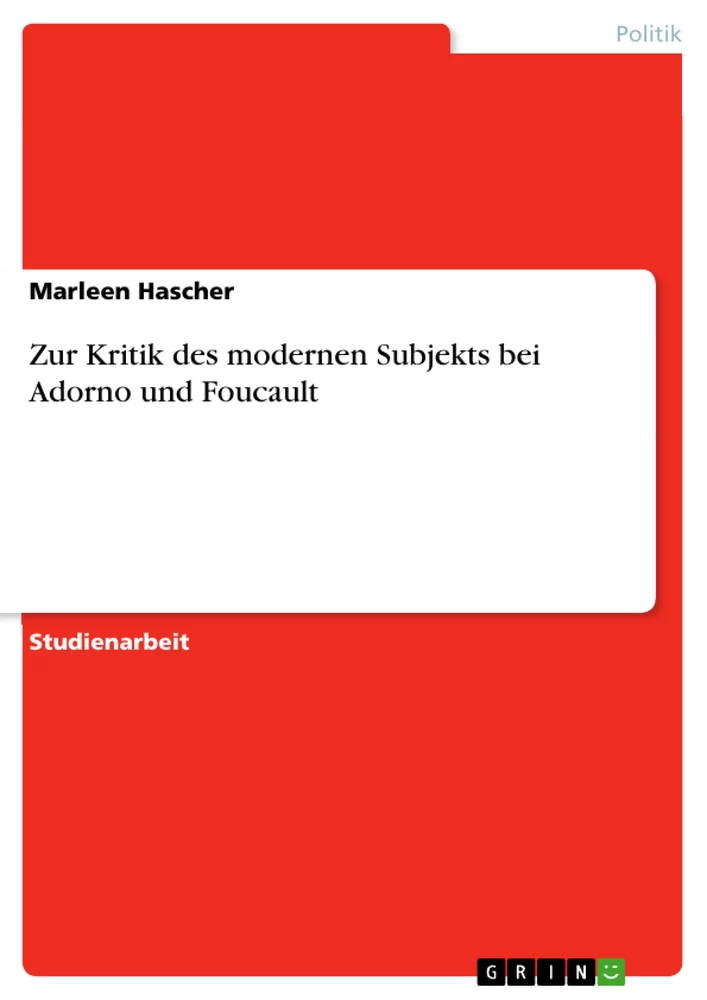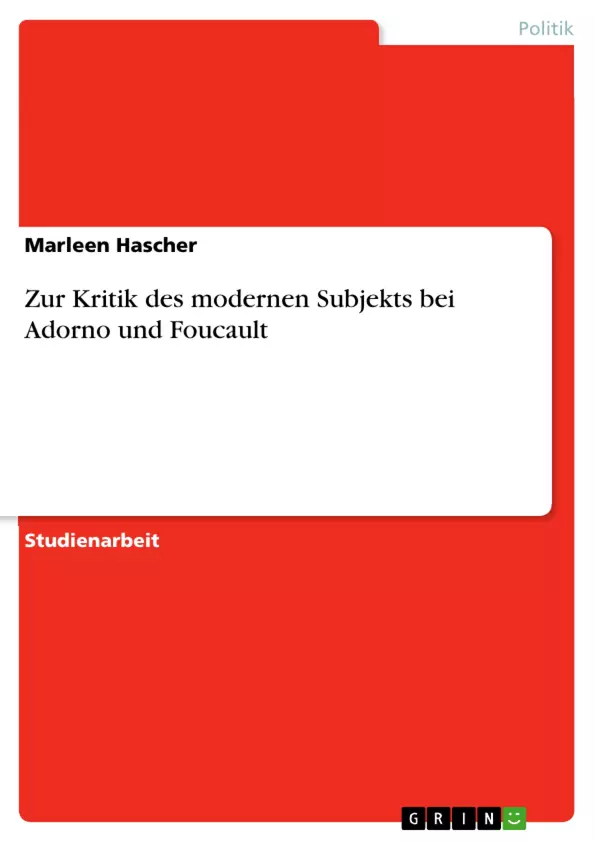In dieser Arbeit soll zuerst der Begriff des modernen Subjekts von Descartes über Kant zu Adorno und Foucault umfänglich erläutert werden, während im Anschluss Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Kritik von Adorno und Foucault herausgearbeitet werden. Aus den Subjektkritiken beider Autoren werden anschließend die Antworten auf die zentrale Frage der Möglichkeit von
emanzipatorischem Handeln in der Postmoderne bzw. im Spätkapitalismus abgeleitet. Zum Schluss dieser Arbeit wird darauf Position bezogen, ob Adornos oder Foucaults kritischer Ansatz bezüglich des Subjekts an die heutige Zeit und deren Handlungsmöglichkeiten anschlussfähiger ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Gegenstand des modernen Subjekts
- Zur Kritik des modernen Subjekts
- Adornos Kritik des modernen Subjekts
- Foucaults Kritik des modernen Subjekts
- Gegenüberstellung der Kritiken Adornos und Foucaults am modernen Subjekt und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Kritik des modernen Subjekts bei Adorno und Foucault. Ziel ist es, die Kritik beider Autoren an dem modernen Subjekt aufzuzeigen und anhand dieser die Frage zu beantworten, ob und inwiefern emanzipatorisches Handeln in der Praxis noch möglich ist.
- Entwicklung und Problematik des modernen Subjektbegriffs
- Adornos Kritik des modernen Subjekts im Kontext des Spätkapitalismus
- Foucaults Kritik des modernen Subjekts im Diskurs der Macht und Disziplin
- Gegenüberstellung der Kritiken Adornos und Foucaults
- Die Möglichkeit von emanzipatorischem Handeln im Spätkapitalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über das Thema der Arbeit und stellt die zentrale Fragestellung nach der Möglichkeit von emanzipatorischem Handeln im Kontext der Subjektkritik von Adorno und Foucault dar. Kapitel 1 behandelt den Begriff des modernen Subjekts und erläutert dessen Entstehung und Entwicklung von der griechischen Antike bis hin zur Moderne. Hierbei werden die erkenntnistheoretischen Ansätze von Descartes, Kant und anderen relevanten Denkern aufgezeigt und die Problematik des modernen Subjekts im Kontext des Spätkapitalismus und der Postmoderne herausgestellt. Kapitel 2 fokussiert auf die Kritik des modernen Subjekts bei Adorno und Foucault. Adornos Kritik wird im Kontext des Spätkapitalismus und seiner Strukturen der Unterdrückung und Entfremdung behandelt, während Foucaults Kritik sich auf die Machtverhältnisse und Disziplinierungsprozesse im Spätkapitalismus konzentriert. Die Gegenüberstellung der beiden Kritiken im Kapitel 3 beleuchtet die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze und versucht, Schlussfolgerungen für die Frage nach der Möglichkeit von emanzipatorischem Handeln zu ziehen.
Schlüsselwörter
Modernes Subjekt, Spätkapitalismus, Postmoderne, Kritik, Adorno, Foucault, Emanzipation, Autonomie, Macht, Disziplin, Individuation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "moderne Subjekt" laut dieser Arbeit?
Das moderne Subjekt wird als ein autonomes, vernunftbegabtes Individuum definiert, dessen Fundamente bei Descartes und Kant liegen.
Wie kritisiert Adorno das moderne Subjekt?
Adorno sieht das Subjekt im Spätkapitalismus als entfremdet und unterdrückt an, gefangen in Strukturen der instrumentellen Vernunft.
Worauf fokussiert sich Foucaults Subjektkritik?
Foucault analysiert das Subjekt als Produkt von Machtverhältnissen und Disziplinierungsprozessen, die das Individuum erst "herstellen".
Ist emanzipatorisches Handeln laut Adorno noch möglich?
Adorno ist eher pessimistisch und sieht die Autonomie des Einzelnen durch die Kulturindustrie und den totalen Verblendungszusammenhang stark gefährdet.
Welcher Ansatz ist für die heutige Zeit anschlussfähiger?
Die Arbeit diskutiert, ob Adornos Fokus auf Kapitalismuskritik oder Foucaults Analyse diffuser Machtstrukturen besser geeignet ist, heutige Handlungsmöglichkeiten zu verstehen.
- Quote paper
- Marleen Hascher (Author), 2021, Zur Kritik des modernen Subjekts bei Adorno und Foucault, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1106052