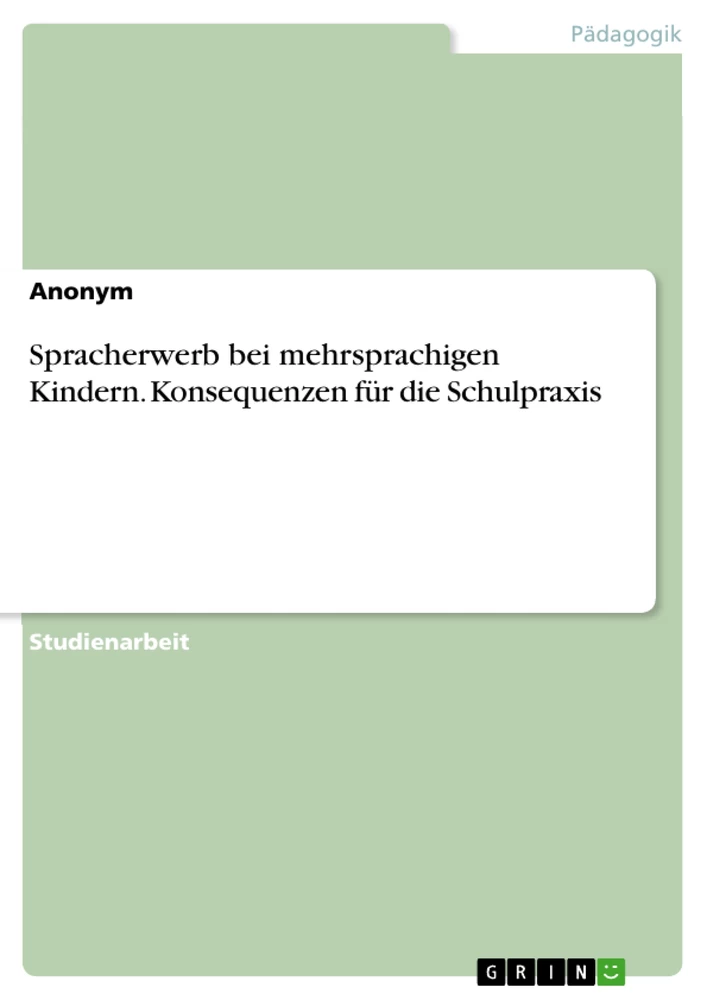In der Arbeit werde ich mich mit dem Thema Mehrsprachigkeit bei Kindern und deren Konsequenzen für die Schulpraxis auseinandersetzen. Hierzu kläre ich zunächst die für diesen Gegenstandsbereich zentralen Begriffe.
In Kapitel drei werde ich mich daraufhin mit dem kindlichen Spracherwerb im Allgemeinen und dem Zweitspracherwerb im Speziellen beschäftigen. Außerdem werde ich auf die unterschiedlichen Faktoren eingehen, die den Zweitspracherwerb beeinflussen. Abschließend werde ich einen Blick auf die Schulpraxis werfen und wie dort mit dem Thema Mehrsprachigkeit umgegangen wird.
Bei der Bundesrepublik Deutschland handelt es sich schon Jahrzehnte lang um ein durch Migration geprägtes Einwanderungsland, weshalb das Thema Mehrsprachigkeit in den letzten Jahren zunehmend präsenter und relevanter wurde. Auch in den Schulen gibt es durch Zuwanderung eine große und ständig wachsende Zahl von Kindern, die mit Deutsch als Zweitsprache aufwachsen. Hier wird die vorhandene Mehrsprachigkeit jedoch meist ignoriert oder allenfalls toleriert. Nur in wenigen Ausnahmefällen wird sie ausreichend gestützt und gefördert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeiten
- Mehrsprachigkeit
- Erstsprache
- Zweitsprache
- Spracherwerb
- Kindlicher Spracherwerb
- Zweitspracherwerbstheorien
- Die Kontrastivitästshypothese
- Die Identitätshypothese
- Die Interlanguagehypothese
- Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb
- Motivation
- Fähigkeit
- Gelegenheit
- Konsequenzen für die Schulpraxis
- Die Lehrkraft als Sprachvorbild
- Mehrsprachigkeit als Chance
- Unterrichtsmodelle im Umgang mit Mehrsprachigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Phänomen der Mehrsprachigkeit bei Kindern und dessen Bedeutung für die schulische Praxis. Das Hauptziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen, die mit Mehrsprachigkeit in schulischen Kontexten verbunden sind, zu gewinnen. Die Arbeit befasst sich mit der Definition von Mehrsprachigkeit, den verschiedenen Theorien des Spracherwerbs, den Faktoren, die den Zweitspracherwerb beeinflussen, und den Konsequenzen, die sich daraus für die Schulpraxis ergeben.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Mehrsprachigkeit"
- Theorien zum kindlichen Spracherwerb und zum Zweitspracherwerb
- Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb
- Konsequenzen der Mehrsprachigkeit für die Schulpraxis
- Unterrichtsmodelle im Umgang mit Mehrsprachigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung liefert einen Überblick über die Relevanz des Themas Mehrsprachigkeit in der heutigen Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf die deutsche Schulpraxis. Kapitel zwei beleuchtet die Definition und Abgrenzung des Begriffs "Mehrsprachigkeit" und diskutiert die verschiedenen Perspektiven auf die Verwendung des Begriffs.
Kapitel drei konzentriert sich auf den kindlichen Spracherwerb im Allgemeinen und den Zweitspracherwerb im Speziellen. Es werden die wichtigsten Theorien des Zweitspracherwerbs vorgestellt und die Faktoren, die den Zweitspracherwerb beeinflussen, analysiert.
Schlüsselwörter
Mehrsprachigkeit, Zweitspracherwerb, Spracherwerbstheorien, Einflussfaktoren, Schulpraxis, Unterrichtsmodelle, Sprachvorbild, Migration, Einwanderungsland, Kompetenz, Bilingualismus, Multilingualismus
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Erstsprache und Zweitsprache?
Die Erstsprache ist die in der frühen Kindheit zuerst erworbene Sprache (Muttersprache), während die Zweitsprache eine weitere Sprache ist, die für das Leben in der Gesellschaft (z.B. Deutsch in Deutschland) notwendig ist.
Welche Faktoren beeinflussen den Zweitspracherwerb?
Zentrale Einflussfaktoren sind die Motivation des Kindes, die individuelle Sprachlernfähigkeit sowie die Gelegenheit, die Sprache im Alltag und in der Schule aktiv anzuwenden.
Was besagt die „Identitätshypothese“ im Spracherwerb?
Sie geht davon aus, dass der Erwerb einer Zweitsprache nach den gleichen psycholinguistischen Mechanismen abläuft wie der Erwerb der Erstsprache.
Wie sollte die Schulpraxis mit Mehrsprachigkeit umgehen?
Anstatt Mehrsprachigkeit zu ignorieren, sollte sie als Chance begriffen werden. Lehrer fungieren dabei als Sprachvorbilder und sollten die Herkunftssprachen wertschätzen.
Was ist die „Interlanguagehypothese“?
Sie beschreibt ein eigenständiges Sprachsystem (Lernersprache), das Elemente der Erstsprache und der Zielsprache mischt und eine notwendige Zwischenstufe im Lernprozess darstellt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2021, Spracherwerb bei mehrsprachigen Kindern. Konsequenzen für die Schulpraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1119700