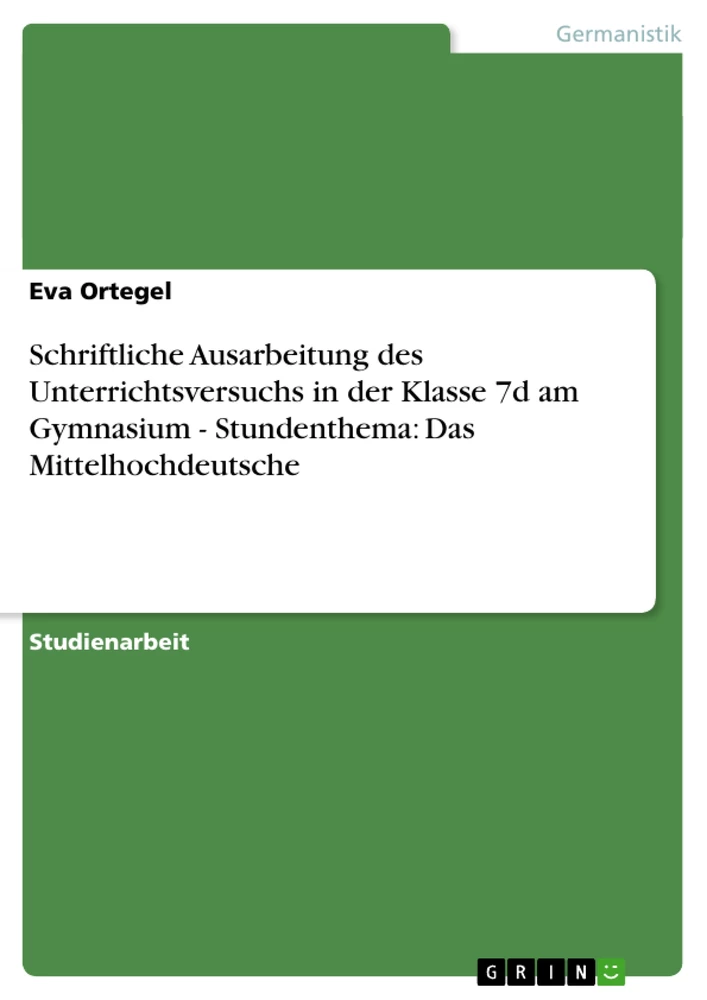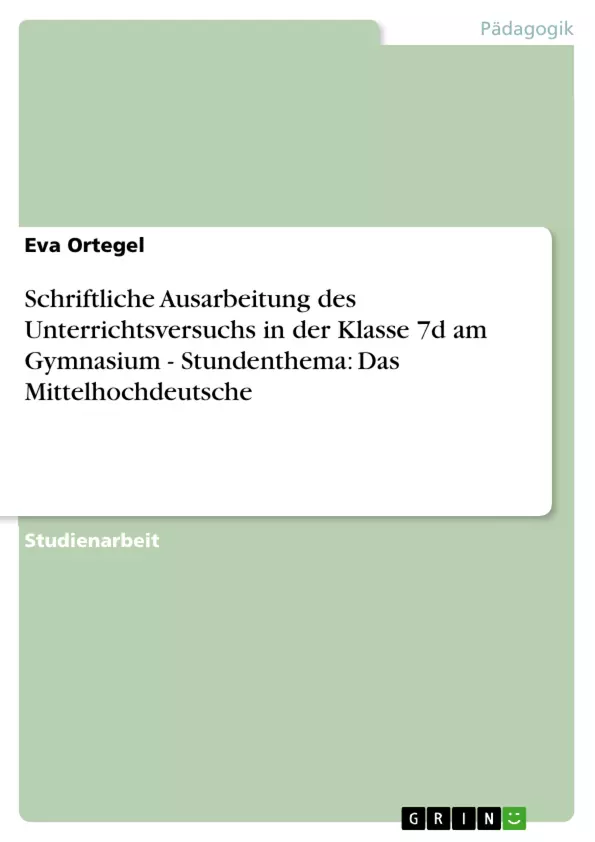Hier liegt ein Unterrichtsentwurf für das Fach Deutsch, Klasse 7 Gymnasium, mit dem Thema "Das Mittelhochdeutsche" vor.
Inhaltsverzeichnis
1. Bemerkungen zur Klasse
2. Unterrichtsgegenstand und –ziele
3. Methodisches Vorgehen
4. Ergänzende Anmerkungen zur Durchführung der Unterrichtsstunde
5. Verlaufsskizze
6. Anhang: Materialien
- Tafelbild: Die Sprachstufen des Deutschen
- Overhead- Folie: Wie spricht man Mittelhochdeutsch richtig aus?
- Overhead- Folie: Beispiele für den Sprachwandel vom Mittel- zum Neuhochdeutschen
- Arbeitsblatt: Mittelhochdeutsch (1050 – 1350)
- Arbeitsblatt: Der von Kürenberg „Ich stuont mir nehtint spâte“
Inhaltsverzeichnis
- Bemerkungen zur Klasse
- Unterrichtsgegenstand und —ziele
- Methodisches Vorgehen
- Ergänzende Anmerkungen zur Durchführung der Unterrichtsstunde
- Anhang: Materialien
- Tafelbild: Die Sprachstufen des Deutschen
- Overhead- Folie _ Wie spricht man Mittelhochdeutsch richtig aus? _
- Overhead- Folie _ Beispiele nir den Sprachwandel vom Mittel- zum Neuhochdeutschen.
- Arbeitsblatt: Mittelhochdeutsch (1050 — 1350)
- Arbeitsblatt: Der von Kürenberg „Ich stuont mir nehtint späte"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die schriftliche Ausarbeitung des Unterrichtsversuchs in der Klasse 7d am Gymnasium zielt darauf ab, die praktische Umsetzung eines Unterrichtskonzepts zum Thema Mittelhochdeutsch zu dokumentieren und zu reflektieren. Der Fokus liegt auf der Vermittlung von Grundkenntnissen über das Mittelhochdeutsche und die Förderung des aktiven Umgangs mit dieser alten deutschen Sprachstufe.
- Einführung in die Sprachstufen des Deutschen
- Vermittlung von Aussprache- und Sprachwandelphänomenen
- Praktische Anwendung des erworbenen Wissens in Form von Übungs- und Lese-Aufgaben
- Verdeutlichung der Entwicklung des Neuhochdeutschen aus dem Mittelhochdeutschen
- Steigerung der Lesekompetenz und -bereitschaft der Schüler durch die Begegnung mit mittelalterlichen Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Klasse 7d setzt sich aus 30 Schülerinnen und Schülern zusammen, wobei das Geschlechterverhältnis mit 16 Jungen zu 14 Mädchen nahezu ausgeglichen erscheint. Ein Großteil der Schüler stammt aus bildungsfernen Schichten, was durch das Einzugsgebiet der Schule in der Nürnberger Südstadt zu begründen ist. Elf der Schülerinnen und Schüler stammen aus Familien mit Migrationshintergrund.
Im neuen G-8 Lehrplan kann man dem Punkt D 7_4 entnehmen, dass die Beschäftigung mit Literatur verschiedener Zeiten und Kulturkreise die Lesekompetenz und —bereitschaft der Schüler festigen kann. Dementsprechend sollten die Schüler mit Stoffen des Mittelalters vertraut gemacht werden, indem sie ausgewählte Texte lesen und verstehen lernen.
Als Einstieg in die Stunde wurde an der Tafel eine Frage aufgeworfen, nämlich: Was ist Mittelhochdeutsch? Dies sollte dazu dienen, das aufgrund der vorherigen Auseinandersetzung bereits vorhandene Vorwissen zu aktivieren und abzurufen. Nach einigen, zunächst noch zögerlichen Angaben kam eine Schülerin recht schnell darauf, dass es sich hierbei um eine Sprachstufe des Deutschen handelt, die bereits einige Zeit zurückliegen muss.
Im Anschluss daran wurde das erste Arbeitsblatt (Mittelhochdeutsch (1050 1350)) ausgeteilt und der Inhalt des Kastens von einem Schüler nochmals zur Wiederholung des bereits Erarbeiteten vorgetragen. Der letzte Satz soll dabei zur praktischen Auseinandersetzung mit dem Mittelhochdeutschen überleiten. Deshalb werden wir die Veränderungen einmal näher unter die Lupe nehmen. Gesagt — getan. Zuerst soll nun die Lautung einer näheren Untersuchung unterzogen werden. Dazu habe ich eine Folie projiziert, die den Schülern veranschaulichen und dabei helfen soll, wie man Mittelhochdeutsch richtig ausspricht.
Nun wurde dieselbe Prozedur für den Sprachwandel wiederholt: Die Folie wurde projiziert und von mir laut vorgetragen, inklusive Lautwandelgesetz und Beispielen, die bereits aus dem später folgenden Frauenlied von Der von Kürenberg entnommen wurden. Weitere Veränderungen, wie die Großschreibung von Substantiven im Neuhochdeutschen und diverse Besonderheiten in Lautung und Schreibung wurden mit auf die Folie gesetzt und ebenfalls vorgetragen.
Um die Schüler abschließend nochmals zu motivieren, lobte ich sie dafür, dass es ihnen so gut gelungen war, die Wörter auszusprechen und auch ihre neuhochdeutschen Entsprechungen herauszufinden. Doch die Übersetzung von einzelnen Wörtern ist natürlich um vieles einfacher, als die Transkription eines zusammenhangenden Textes. Deshalb sollten wir uns abschließend mit einem solchen mittelhochdeutschen Text, nämlich dem Gedicht Ich stuont mir nehtmt späte von Der von Kurenberg beschäftigen, welches die Schüler ausgeteilt bekamen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Mittelhochdeutsche als Sprachstufe des Deutschen, die Sprachstufen des Deutschen, Aussprache- und Sprachwandelphänomene, das Frauenlied von Der von Kürenberg, mittelalterliche Texte und Lesekompetenz.
- Citar trabajo
- Eva Ortegel (Autor), 2007, Schriftliche Ausarbeitung des Unterrichtsversuchs in der Klasse 7d am Gymnasium - Stundenthema: Das Mittelhochdeutsche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/112039