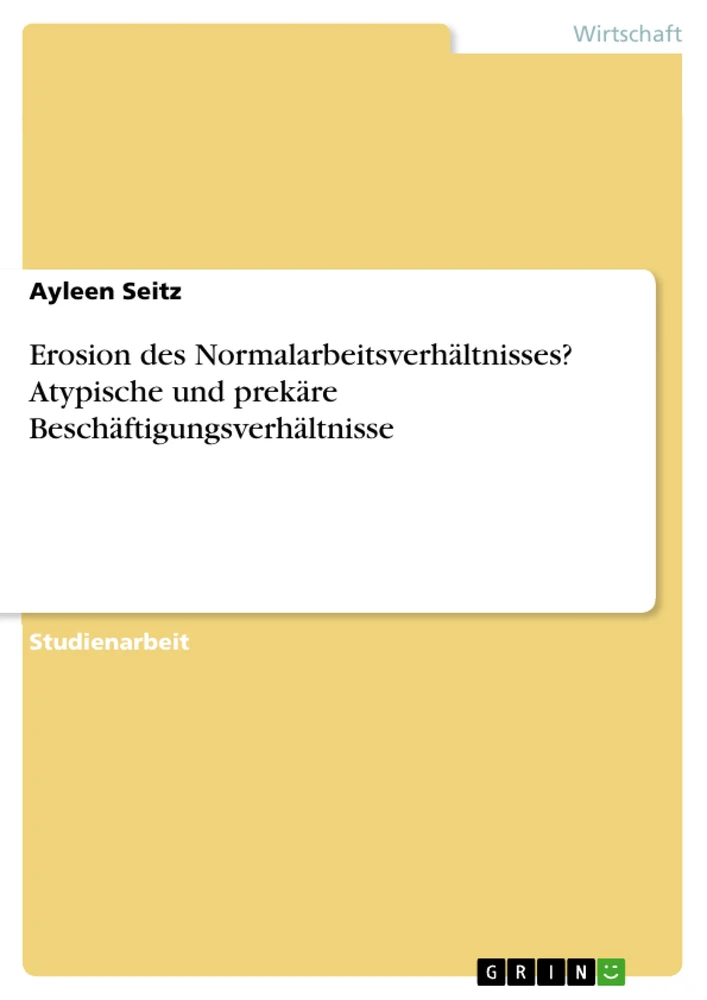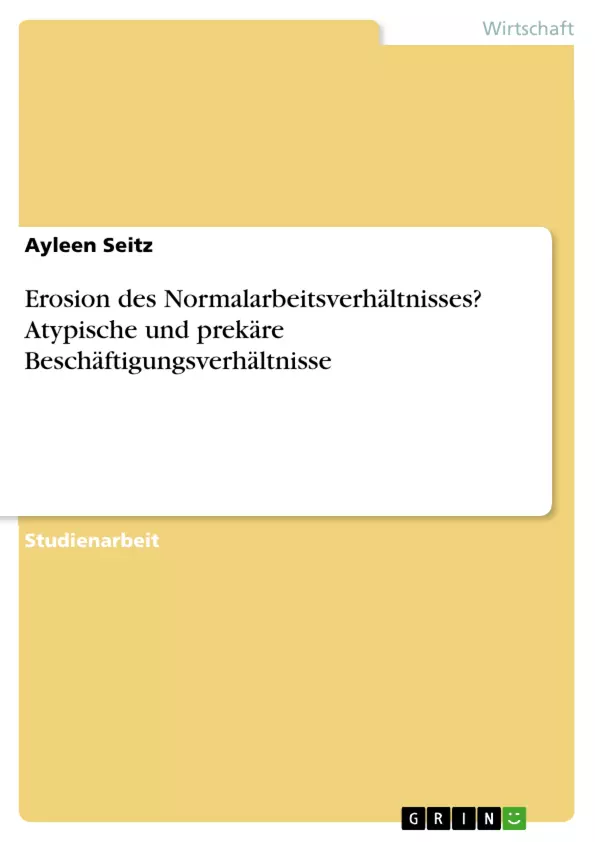Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist Teil eines fortschreitenden Strukturwandels. Seit Mitte der 1970er Jahre steht dieser unter stetigem Anpassungsdruck, sodass die Forderungen nach neuen Rahmenbedingungen für veränderte Arbeitsverhältnisse wiederkehrend in beschäftigungspolitischen Debatten gefordert werden. Als Antwort sowie Deregulierungsmaßnahme folgte Mitte der 1980er Jahre das Beschäftigungsförderungsgesetz, welches eine Erleichterung der befristeten Beschäftigung vorsah. Der Diskussion um die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes folgend,
wurden im Jahr 2001 die Teilzeit- und Befristungsgesetze und im Jahr 2003 die sogenannten Hartz-Gesetze erlassen. Die dadurch entstandene Ausweitung der Teilzeitarbeit und die rechtliche Lockerung für unterschiedliche Beschäftigungsformen, ließ den Anteil von atypischen und prekären Beschäftigungen ansteigen. Besonders durch die Expansion dieser Form von Beschäftigungsverhältnissen wird der Arbeitsmarkt mit neuen Problemen konfrontiert. Als
Hauptleidtragende wird dabei der Standard und damit das Normalarbeitsverhältnis (NAV) angesehen. Durch die Anpassungen des Erwerbslebens tritt das NAV zunehmend in den Hintergrund und lässt den Normalitätsgehalt von Beschäftigungsverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt schwinden.
Ziel dieser Ausarbeitung ist demnach die Klärung der Frage, ob das NAV durch die Ausweitung atypischer und prekärer Beschäftigungsverhältnisse erodiert und ob weitere Faktoren zur Erklärung des arbeitsmarktpolitischen Strukturwandels herangezogen werden können. Um die inhaltlich relevanten Begrifflichkeiten voneinander abgrenzen zu können, werden zunächst das NAV und die atypische sowie prekäre Beschäftigung definiert. Dabei werden die Ergebnisse des Mikrozensus herangezogen, um den Diskussionsgehalt mit statistischen Daten stützen zu können.
Im Anschluss wird der Fokus auf die Verschiebung des Arbeitsmarktes gelegt, indem zunächst die Entwicklung und das Ausmaß atypischer Beschäftigungen skizziert wird. Darauffolgend widmet sich die Arbeit der Hauptthese der Erosion des NAVs und führt verschiedene Erklärungsansätze an. Die Zusammenführung zuvor gewonnener Erkenntnisse
und ein Ausblick im Kontext der Vereinbarkeit von Flexibilität und sozialer Sicherung schließen die Ausarbeitung ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmungen
- Das Normalarbeitsverhältnis
- Atypische und prekäre Beschäftigung
- Die strukturelle Verschiebung des Arbeitsmarktes
- Entwicklung und Ausmaß atypischer Beschäftigung
- Die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Frage, ob das Normalarbeitsverhältnis (NAV) durch die Zunahme atypischer und prekärer Beschäftigungsverhältnisse erodiert. Die Analyse untersucht die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Deutschland und die Faktoren, die zur Verschiebung hin zu flexiblen Arbeitsformen beitragen.
- Definition und Abgrenzung des Normalarbeitsverhältnisses
- Charakterisierung atypischer und prekärer Beschäftigung
- Entwicklung und Ausmaß atypischer Beschäftigungsformen in Deutschland
- Analyse der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses
- Diskussion der Vereinbarkeit von Flexibilität und sozialer Sicherung im Kontext der Arbeitsmarktentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses ein und skizziert die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Das zweite Kapitel widmet sich der Definition des Normalarbeitsverhältnisses und der Abgrenzung zu atypischen und prekären Beschäftigungsformen. Es werden wichtige Merkmale und Definitionen dieser Erwerbsformen vorgestellt, wobei der Fokus auf die rechtliche und soziale Absicherung sowie die Existenzsicherung liegt.
Das dritte Kapitel analysiert die strukturelle Verschiebung des Arbeitsmarktes. Hier werden die Entwicklung und das Ausmaß atypischer Beschäftigungsformen beleuchtet. Es wird die Erosion des Normalarbeitsverhältnisses im Kontext des Strukturwandels diskutiert, wobei verschiedene Erklärungsansätze vorgestellt werden.
Schlüsselwörter
Normalarbeitsverhältnis, Atypische Beschäftigung, Prekäre Beschäftigung, Arbeitsmarkt, Strukturwandel, Flexibilisierung, Sozialer Schutz, Existenzsicherung, Arbeitsbedingungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Normalarbeitsverhältnis (NAV)?
Ein NAV ist ein unbefristetes, sozialversicherungspflichtiges Vollzeitbeschäftigungsverhältnis, das eine Existenzsicherung garantiert und in die sozialen Sicherungssysteme integriert ist.
Was versteht man unter atypischer Beschäftigung?
Dazu zählen Arbeitsverhältnisse, die vom Standard abweichen, wie Teilzeit, Befristungen, Leiharbeit oder Minijobs.
Wann gilt eine Beschäftigung als prekär?
Prekär ist eine Beschäftigung dann, wenn sie kein existenzsicherndes Einkommen bietet, mit geringem sozialen Schutz einhergeht oder die berufliche Integration dauerhaft erschwert.
Erodiert das Normalarbeitsverhältnis in Deutschland?
Die Arbeit untersucht, ob das NAV durch die massive Ausweitung atypischer Jobs zunehmend an Bedeutung verliert und welche strukturellen Faktoren diesen Wandel treiben.
Welchen Einfluss hatten die Hartz-Gesetze auf den Arbeitsmarkt?
Die Gesetze führten zu einer Deregulierung und Flexibilisierung, die den Anteil atypischer und geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse deutlich ansteigen ließ.
- Arbeit zitieren
- Ayleen Seitz (Autor:in), 2019, Erosion des Normalarbeitsverhältnisses? Atypische und prekäre Beschäftigungsverhältnisse, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1127735