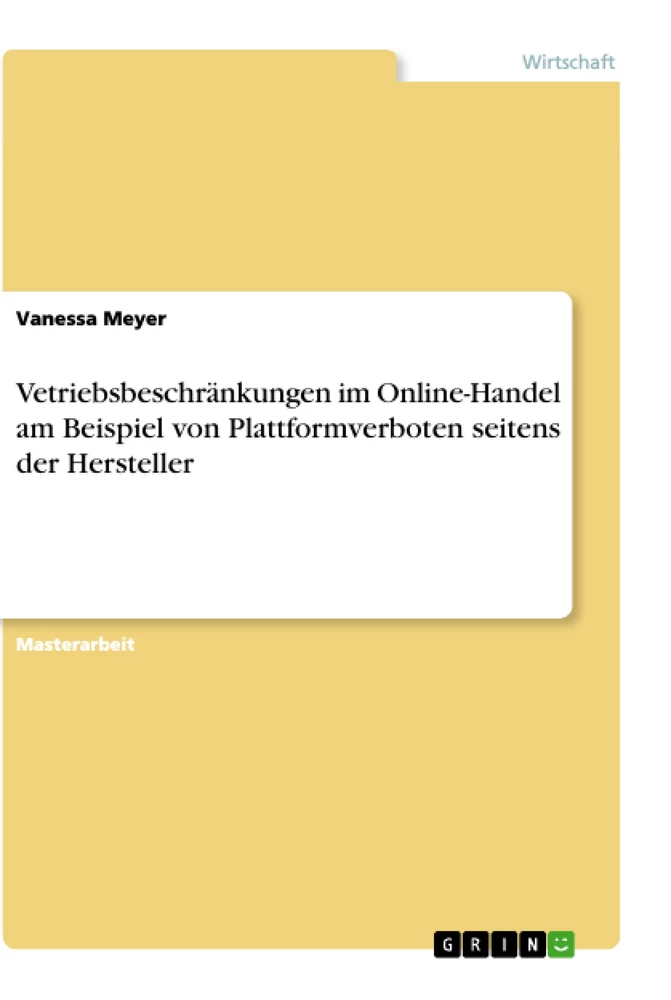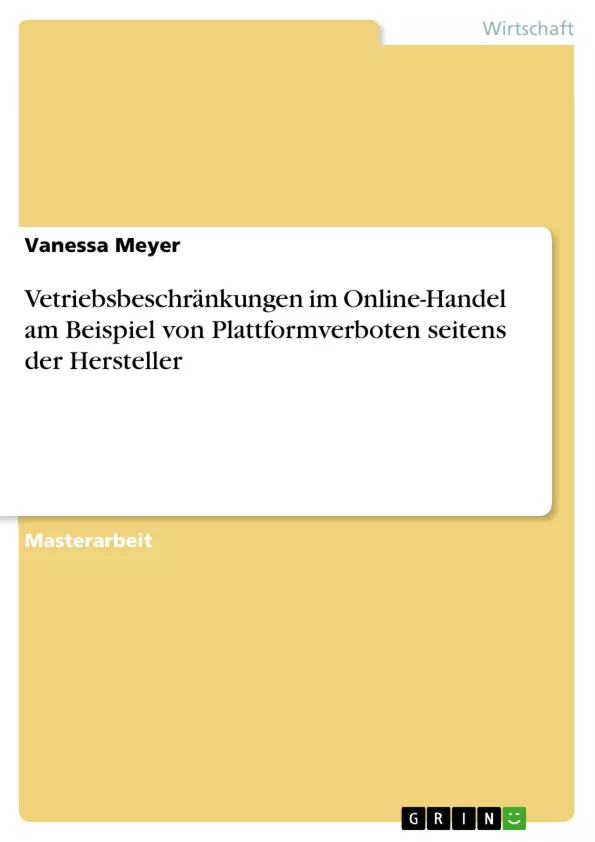Die Ausarbeitung wird sich der Fragestellung widmen, inwieweit der Vertrieb über Internetplattformen seitens der Hersteller beschränkt beziehungsweise verboten werden darf. Können Hersteller kartellrechtskonform den Vertrieb über Internetplattformen beschränken beziehungsweise gänzlich verbieten?
Der Gang der Untersuchung wird mit einer Einführung in die Thematik sowie der Darstellung des ökonomischen und technischen Hintergrundes eingeleitet. Hierbei werden die Grundlagen des Internetvertriebs, wie beispielsweise die Funktion der Drittplattformen und Preissuchmaschinen sowie die Chancen und Risiken des Internetvertriebs anhand unterschiedlicher Perspektiven näher erläutert. Daraufhin folgt eine Abgrenzung zwischen horizontalen und vertikalen Vertriebsbeschränkungen, welche durch Beispielklauseln anschaulich dargestellt werden. Anschließend werden die Unterschiede zwischen einem qualitativen und einem quantitativen Selektivvertrieb sowie einem Nicht-Selektivvertrieb betrachtet.
In Kapitel C folgt ein theoretischer Überblick über die rechtlichen Grundlagen. Im Fokus werden das unionsrechtliche Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV (Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union) und § 1 GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) sowie die dazugehörigen Freistellungsmöglichkeiten, vorwiegend auf Basis der Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen und der Legalausnahme dargestellt. Daraufhin folgt eine rechtliche Einordnung der Vertriebssysteme sowie unter Kapitel D eine detaillierte und kritische Analyse der wichtigsten und bekanntesten gerichtlichen Urteile und Entscheidungen der bisher geltenden Rechtsprechung. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die Rechtsprechung und Literatur bis einschließlich Juli 2018 berücksichtigt. Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse sowie die Beantwortung der eingangs gestellten Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- A. Wachsende Problematiken durch die Veränderungen der Handelsbranchen
- B. Ökonomischer und Technischer Hintergrund
- I. Die Entwicklung des Online-Handels
- II. Grundlagen des Internetvertriebs
- III. Vertriebsbeschränkungen
- 1. Problemaufriss
- 2. Art der Vertriebsbeschränkung
- 3. Abgrenzung zwischen horizontalen und vertikalen Vertriebsbeschränkungen
- IV. Vertriebsorganisationen
- 1. Selektivvertrieb
- 2. Unterscheidung qualitativer und quantitativer Selektivvertrieb
- 3. Nicht-selektiver Vertrieb
- C. Rechtliche Grundlagen
- I. Motive der Rechtsprechung
- II. Nationales und europäisches Recht
- D. Konkretisierung durch die Rechtsprechung
- I. Rechtslage bis 2011
- II. Rechtsunsicherheit ab 2011 anhand verschiedener gerichtlicher Entscheidungen
- E. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Vertriebsbeschränkungen im Online-Handel, insbesondere Plattformverbote seitens der Hersteller. Ziel ist es, die rechtliche Zulässigkeit solcher Verbote zu analysieren und die daraus resultierende Rechtsunsicherheit zu beleuchten.
- Entwicklung des Online-Handels und seine Auswirkungen auf traditionelle Vertriebswege
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Vertriebsbeschränkungen im E-Commerce (nationales und europäisches Recht)
- Analyse von Gerichtsurteilen zu Plattformverboten und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb
- Konflikt zwischen den Interessen von Herstellern und Händlern im Online-Handel
- Chancen und Risiken des Internetvertriebs für verschiedene Akteure
Zusammenfassung der Kapitel
A. Wachsende Problematiken durch die Veränderungen der Handelsbranchen: Dieses Kapitel beschreibt die tiefgreifenden Veränderungen im Handel durch die Digitalisierung. Es zeigt den Boom des Online-Handels, den Rückgang des stationären Handels und den daraus resultierenden Interessenkonflikt zwischen Herstellern, die den stationären Handel bevorzugen, und Online-Händlern, die die Möglichkeiten des Internets nutzen wollen. Der zunehmende Einsatz von Vertriebsvorgaben durch Hersteller, insbesondere Plattformverbote, wird als zentrale Problematik herausgestellt, die zu Wettbewerbsbeschränkungen führen kann.
B. Ökonomischer und Technischer Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den ökonomischen und technischen Kontext des Online-Handels. Es erklärt die Funktionsweise von Online-Plattformen wie Amazon und eBay sowie von Preissuchmaschinen. Darüber hinaus werden die Chancen und Risiken des Online-Handels aus verschiedenen Perspektiven (Endverbraucher, Händler, Kartellbehörden, Hersteller) analysiert. Der Fokus liegt auf Vertriebsbeschränkungen, ihrer Problematik, verschiedenen Arten und der Unterscheidung zwischen horizontalen und vertikalen Beschränkungen. Die verschiedenen Vertriebsorganisationen (Selektivvertrieb, qualitativer und quantitativer Selektivvertrieb, nicht-selektiver Vertrieb) werden ebenfalls differenziert dargestellt.
C. Rechtliche Grundlagen: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen für Vertriebsbeschränkungen im Online-Handel. Es behandelt das unionsrechtliche Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB sowie die dazugehörigen Freistellungsmöglichkeiten, insbesondere die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen und die Legalausnahme. Die Motive der Rechtsprechung und die relevanten Tatbestandsmerkmale werden erläutert.
Schlüsselwörter
Online-Handel, Vertriebsbeschränkungen, Plattformverbote, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Selektivvertrieb, Amazon, eBay, Preisvergleichsportale, Art. 101 AEUV, § 1 GWB, Gruppenfreistellungsverordnung, Rechtsprechung.
FAQ: Vertriebsbeschränkungen im Online-Handel
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die rechtliche Zulässigkeit von Vertriebsbeschränkungen im Online-Handel, insbesondere Plattformverbote seitens der Hersteller. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der daraus resultierenden Rechtsunsicherheit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Online-Handels und seine Auswirkungen auf traditionelle Vertriebswege, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Vertriebsbeschränkungen im E-Commerce (nationales und europäisches Recht), die Analyse von Gerichtsurteilen zu Plattformverboten und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb, den Konflikt zwischen den Interessen von Herstellern und Händlern im Online-Handel sowie die Chancen und Risiken des Internetvertriebs für verschiedene Akteure.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel A. Wachsende Problematiken durch die Veränderungen der Handelsbranchen, B. Ökonomischer und Technischer Hintergrund, C. Rechtliche Grundlagen, D. Konkretisierung durch die Rechtsprechung und E. Zusammenfassung. Kapitel B detailliert den ökonomischen und technischen Hintergrund des Online-Handels inklusive verschiedener Vertriebsorganisationen (Selektivvertrieb etc.). Kapitel C beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, Kapitel D analysiert die Rechtsprechung zu Plattformverboten.
Welche Arten von Vertriebsbeschränkungen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert insbesondere Plattformverbote durch Hersteller, aber auch allgemeinere Vertriebsbeschränkungen. Es wird zwischen horizontalen und vertikalen Vertriebsbeschränkungen unterschieden und verschiedene Vertriebsorganisationen wie Selektivvertrieb (qualitativ und quantitativ) und nicht-selektiver Vertrieb betrachtet.
Welche rechtlichen Grundlagen werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf das unionsrechtliche Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV und § 1 GWB sowie die dazugehörigen Freistellungsmöglichkeiten, insbesondere die Gruppenfreistellungsverordnung für vertikale Wettbewerbsbeschränkungen und die Legalausnahme.
Wie wird die Rechtsprechung behandelt?
Die Arbeit analysiert die Rechtsprechung zu Plattformverboten, insbesondere die Rechtslage bis 2011 und die Rechtsunsicherheit ab 2011 anhand verschiedener gerichtlicher Entscheidungen. Die Motive der Rechtsprechung werden erläutert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Online-Handel, Vertriebsbeschränkungen, Plattformverbote, Wettbewerbsrecht, Kartellrecht, Selektivvertrieb, Amazon, eBay, Preisvergleichsportale, Art. 101 AEUV, § 1 GWB, Gruppenfreistellungsverordnung und Rechtsprechung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der rechtlichen Zulässigkeit von Plattformverboten im Online-Handel und die Beleuchtung der daraus resultierenden Rechtsunsicherheit.
Welche Problematik wird im Fokus der Arbeit behandelt?
Die zunehmende Problematik von Vertriebsvorgaben durch Hersteller, insbesondere Plattformverbote, die zu Wettbewerbsbeschränkungen führen können, steht im Mittelpunkt der Arbeit.
- Citation du texte
- Vanessa Meyer (Auteur), 2018, Vetriebsbeschränkungen im Online-Handel am Beispiel von Plattformverboten seitens der Hersteller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1129154