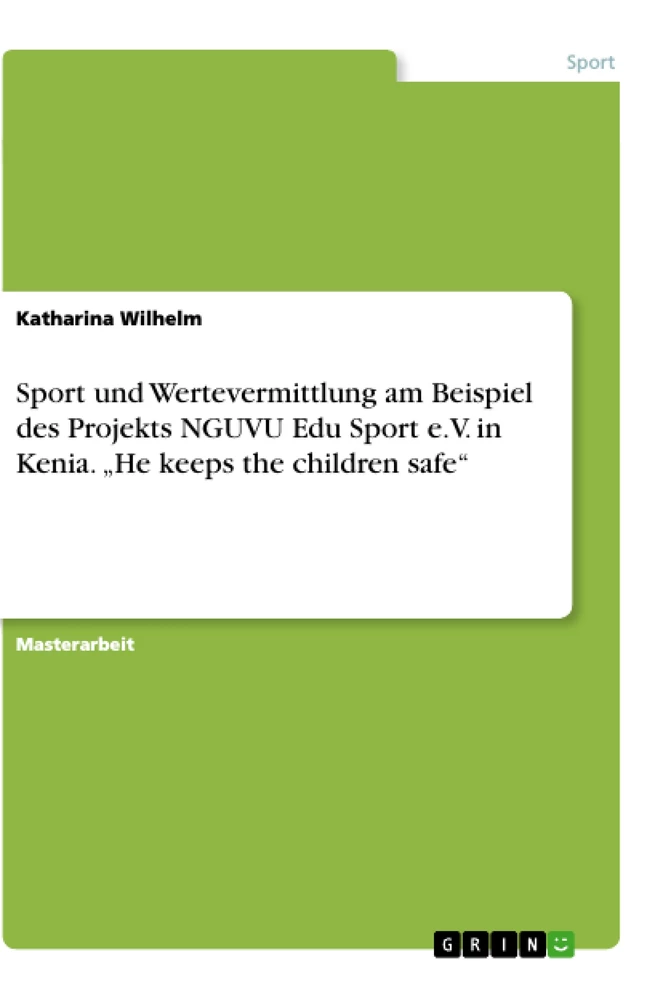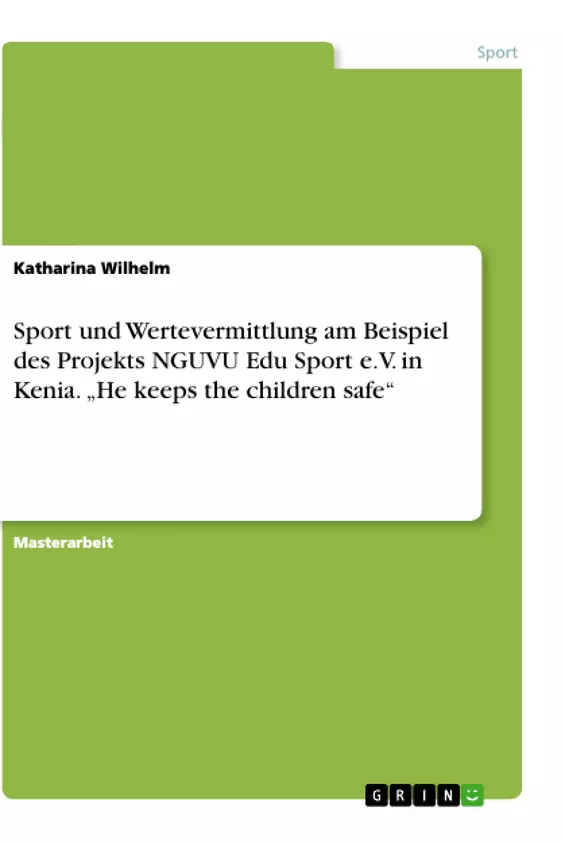Diese Masterarbeit leistet einen Beitrag zur Analyse der Konzepte, die durch Sport erzieherisch vermittelt werden sollen. Sie nimmt dabei die Standpunkte der verschiedenen Akteure, die in einem Entwicklungszusammenarbeitskontext aufeinander treffen, in den Blick. Im spezifischen Umfeld eines kleinstädtischen kenianischen Raums mit multiethnischen Akteuren habe ich hierfür eine exemplarische Forschung bei der deutschen Organisation „NGUVU Edu Sport e.V.“ durchgeführt. Diese macht es sich zur Aufgabe, sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen mithilfe einer Lernmethode in Verbindung mit Sport selbst definierte Werte wie Respekt, Toleranz und Selbstbewusstsein zu vermitteln.
Dabei stellten sich als Forschungsfragen, welche Elemente der Organisationsarbeit entscheidend auf die Wertebildung der Teilnehmer wirken, mit welchen anderen Werten der Teilnehmer die zu vermittelnden Konzepte eventuell im Konflikt stehen und inwiefern sich die Wertideen der Organisation tatsächlich in der sozialen Realität der Teilnehmer abbilden. Es zeigte sich, dass die Bereitstellung von Sicherheit und Grundversorgung durch das Projekt eine entscheidende Rolle für die Kinder und ihre Familien spielt. Werte und Lebenskompetenzen werden in der Vermittlung von den Teilnehmern implizit durch ihre risikobehafteten Lebensumstände bedingt beschleunigt aufgenommen, da sie durch den Zugang zu Grundversorgung und sicheren Räumen verstärkt motiviert sind, zu lernen und umzusetzen, was ihnen beigebracht werden soll - und zwar bis zu einem gewissen Grad unabhängig davon, ob dies über Sport oder andere Wege geschieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer Rahmen
- 2.1. Sport und Fußball aus ethnologischen Perspektiven
- 2.2. „Sport evangelism“? Sport und Sporterziehung in Ethnologie und Entwicklungszusammenarbeit
- 2.3. Zentrale Werte und ihre (sport-)erzieherische Vermittlung im kenianischen und deutschen Kontext
- 2.4. Aufwachsen in Kenia: Kindheit, Familie und Ethnizität
- 3. Projekt- und Standortbeschreibung
- 4. Forschungsverlauf und Methodenreflexion
- 5. „He keeps the children safe“: Analyse der Motive von Kindern und Familien für die Teilnahme am Projekt
- 6. Das NGUVU Edu Sport e. V. - Selection Team: Das Erschaffen einer Mannschaft im lokalen Kontext
- 6.1. „We are in Africa“ - Konstruktionen europäischer und afrikanischer Identitäten auf dem Fußballplatz und außerhalb
- 6.2. Albert Schweitzer oder „Sucher“? Bewegen und Handeln des Projektgründers in Juja
- 6.3. Rezeption des Projektes im Ort Juja
- 7. Exemplarische Analyse der Wertevermittlung durch Sport im Rahmen des Projekts NGUVU Edu Sport e.V.
- 7.1. Der „NGUVU-Wertekatalog“: Perspektiven von Teilnehmern, Projektmitarbeitern, Erziehungsberechtigten und Lehrern
- 7.2. Umsetzung: Beobachtungen auf dem Fußballplatz und außerhalb
- 8. Zusammenfassung, Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht ein Sportprojekt in Kenia, das Kindern und Jugendlichen Werte wie Respekt, Toleranz und Selbstbewusstsein durch Sport und insbesondere Fußball vermitteln möchte. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob diese von Projektseite ins Spiel gebrachten Werte tatsächlich von den Teilnehmern, insbesondere Kindern und Jugendlichen, angenommen werden. Zudem wird analysiert, welche Rolle diese Werte in der Lebensrealität der Teilnehmer spielen und welche Motivationen hinter der Teilnahme an dem Projekt stehen.
- Die Rolle von Sportprojekten in der Entwicklungszusammenarbeit
- Die Vermittlung von Werten durch Sport
- Die Motivation der Teilnehmer an dem Projekt
- Die Rezeption des Projekts im lokalen Umfeld
- Die Bedeutung von Sicherheit und Grundversorgung im Kontext der Projektarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Kontext von Sportprojekten in der Entwicklungszusammenarbeit beleuchtet. Es werden verschiedene Perspektiven auf die Rolle von Sport in der Entwicklung vorgestellt und die Relevanz der ethnologischen Betrachtungsweise für dieses Themenfeld betont. Anschließend wird der theoretische Rahmen der Arbeit vorgestellt, in dem verschiedene Konzepte wie „Sport evangelism“, Wertevermittlung, Kindheit und Ethnizität im kenianischen Kontext behandelt werden. Kapitel 3 beschreibt das Projekt NGUVU Edu Sport e. V. und seinen Standort in Juja, Kenia. In Kapitel 4 werden die Forschungsmethoden und der Forschungsverlauf der Feldforschung in Juja erläutert. Kapitel 5 analysiert die Motive von Kindern und Familien für die Teilnahme am Projekt NGUVU. Kapitel 6 befasst sich mit der Auswahl des „NGUVU Edu Sport e. V. Selection Teams“, der Konstruktion von Identitäten im lokalen Kontext und der Rezeption des Projekts in Juja. In Kapitel 7 werden exemplarische Beispiele für die Wertevermittlung durch Sport innerhalb des Projekts vorgestellt. Diese Zusammenfassung berücksichtigt die wichtigsten Themen und Argumente der Arbeit, ohne jedoch wesentliche Ergebnisse oder Schlussfolgerungen zu verraten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Masterarbeit umfassen die Themenfelder Sport und Entwicklungszusammenarbeit, Wertevermittlung, Motivation der Teilnehmer, Rezeption des Projekts im lokalen Umfeld, Kindheit und Ethnizität, Sicherheit und Grundversorgung, Konstruktion von Identitäten und Sport als integrativer Faktor.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Projekts NGUVU Edu Sport e.V. in Kenia?
Das Projekt nutzt Sport (vor allem Fußball), um sozial benachteiligten Kindern Werte wie Respekt, Toleranz und Selbstbewusstsein zu vermitteln und ihnen einen sicheren Raum zu bieten.
Warum nehmen Kinder und Familien an dem Projekt teil?
Neben dem Sport sind die Bereitstellung von Sicherheit und die Grundversorgung (z.B. Mahlzeiten) entscheidende Motive, da die Lebensumstände der Teilnehmer oft risikobehaftet sind.
Können Werte durch Sport tatsächlich vermittelt werden?
Ja, aber die Forschung zeigt, dass die Vermittlung oft implizit geschieht. Die Kinder sind motivierter zu lernen, weil das Projekt ihnen existenzielle Sicherheit und Schutz bietet („He keeps the children safe“).
Welche Rolle spielt Fußball in der Entwicklungszusammenarbeit?
Fußball dient als integrativer Faktor, der Kinder verschiedener ethnischer Gruppen zusammenbringt und als Plattform für Bildungsangebote und soziale Unterstützung fungiert.
Gibt es kulturelle Konflikte bei der Wertevermittlung?
Herausforderungen entstehen oft durch unterschiedliche Vorstellungen von Identität und Erziehung zwischen europäischen Projektorganisatoren und der lokalen kenianischen Realität.
- Quote paper
- Katharina Wilhelm (Author), 2018, Sport und Wertevermittlung am Beispiel des Projekts NGUVU Edu Sport e.V. in Kenia. „He keeps the children safe“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1130193