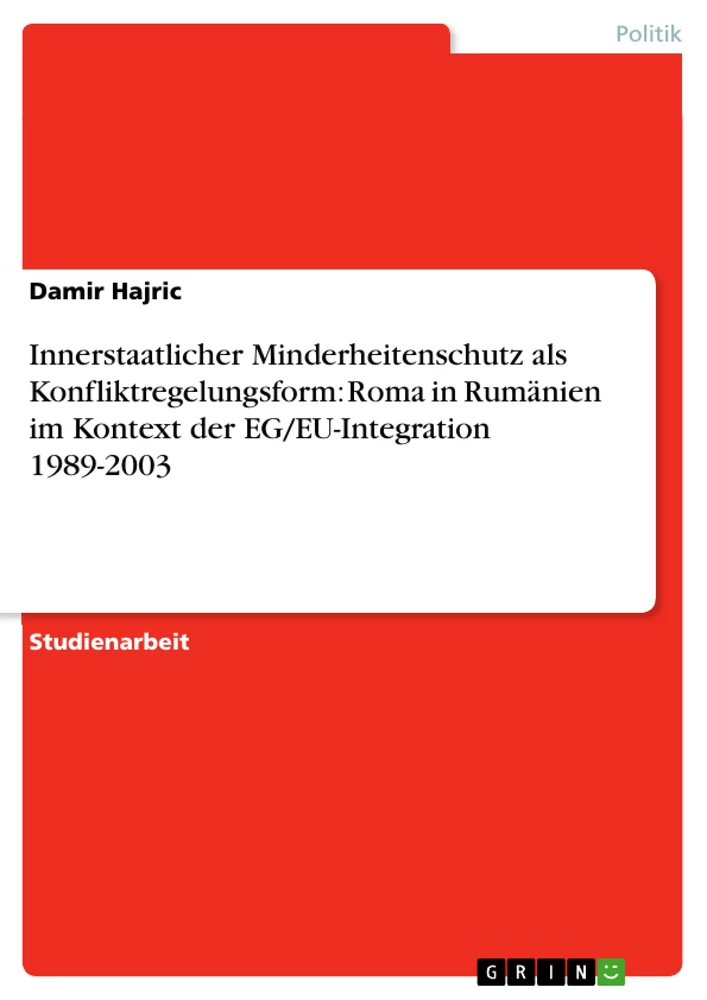Am 1. Januar 2007 trat Rumänien im Rahmen der umstrittenen Südosterweiterung der Europäischen Union bei. Damit ging für diesen südosteuropäischen Staat ein langer und schwieriger Verhandlungsmarathon zu Ende, begleitet von einem steinigen Transformationsprozess in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft – ein Prozess, der immer noch anhält. Die rumänische Gesellschaft und ihre Institutionen befinden sich nach wie vor in einem langwierigen Transformationsprozess, dass seinen Anfang in der Revolution von 1989 gefunden hat.
Die osteuropäische Wende von 1989/90 und vor allem die sich auf dem europäischen Kontinent ereigneten kriegerischen Auseinandersetzungen im Kontext des Staatszerfalls Jugoslawiens von 1991/1995, gaben dem Europarat den Anlass dazu, sich der Minderheitenfrage besonders intensiv zuzuwenden. Den ersten Versuch stellte der Entwurf der Venedig-Kommission für eine besondere Europäische Minderheitenschutzkonvention (EMRK) von 8. Februar 1991 dar. Darauf folgten einige Entwürfe von denen der österreichische Entwurf eines EMRK-Zusatzprotokolls vom 26. November 1991 und der Bozener Entwurf der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen für ein EMRK-Zusatzprotokoll von 28. Mai 1992 besonders hervorzuheben sind.
Mit dem Ziel den Minderheitenschutz wirksamer zu machen, konzipierte die Parlamentarische Versammlung des Europarats am 1. Februar 1993 mit der Empfehlung Nr. 1201 einen entsprechenden Entwurf „betreffend Personen, die zu nationalen Minderheiten gehören“. Dieser ist dem Ministerkomitee zur Verabschiedung überwiesen worden, leider ohne Erfolg. Die Idee wurde mit der „Wiener Erklärung“ der Staats- und Regierungschefs am 9. Oktober 1993 zunichte gemacht. Auf dem Wiener Gipfel vom 9. Oktober 1993 wurde das Ministerkomitee nur beauftragt, „mit dem Entwurf eines Protokolls zu beginnen, das die Europäische Menschenrechtskonvention im kulturellen Bereich durch Bestimmungen ergänzt, die insbesondere für Angehörige nationaler Minderheiten individuelle Rechte garantieren“. Dieser Auftrag wurde dann vom Ministerkomitee weiter unkonkretisiert, so dass am 1. Februar 1995 nur ein „Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten“ zur Unterzeichnung aufgelegt wurde, das am 1. Februar 1998 für die ersten 13 Mitgliedstaaten des Europarats in Kraft treten konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Rumänien am Wendepunkt
- Die Enttäuschung: Die Situation der Roma nach der Ära Ceausescu
- Die Aufnahme Rumäniens in den Europarat: Transformation durch Integration statt Isolation
- Innerstaatlicher Minderheitenschutz
- Theoretische Einordnung der Minderheitensituation der Roma in Rumänien
- Umfassender Minderheitenschutz: Garantie der Gleichstellungsrechte, Kulturelle Rechte und Repräsentations- und Selbstverwaltungsrechte
- Von der Stagnation zur allmählichen Verbesserung: Minderheitenpolitik Rumäniens von 1989 bis 2003
- Der langwierige Prozess
- Strategie der rumänischen Regierung zur Verbesserung der Situation der Roma
- Die Verfassungsreform vom 2003
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den innerstaatlichen Minderheitenschutz für Roma in Rumänien im Kontext der EG/EU-Integration von 1989 bis 2003. Ziel ist es, die Entwicklung der Minderheitenpolitik Rumäniens zu analysieren und die Herausforderungen und Erfolge bei der Integration der Roma in die rumänische Gesellschaft zu beleuchten.
- Die Situation der Roma in Rumänien nach dem Sturz des Ceausescu-Regimes
- Der Einfluss der EU-Integration auf die Minderheitenpolitik Rumäniens
- Theoretische Konzepte des innerstaatlichen Minderheitenschutzes
- Die Rolle des Europarates bei der Förderung des Minderheitenschutzes
- Herausforderungen und Erfolge der rumänischen Minderheitenpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Rumänien am Wendepunkt: Dieses Kapitel beschreibt die Situation der Roma in Rumänien nach dem Ende der Ceausescu-Diktatur. Es analysiert die anhaltende Diskriminierung und die Enttäuschung der Roma angesichts der versprochenen Veränderungen. Die Aufnahme Rumäniens in den Europarat wird als ein wichtiger Schritt zur Transformation durch Integration statt Isolation dargestellt, jedoch werden auch die Schwierigkeiten und der langsame Fortschritt im Umgang mit der Minderheitenfrage beleuchtet. Der Übergang von einem repressiven System zu einer demokratischen Gesellschaft wirft komplexe Herausforderungen für die Roma auf, die tiefgreifende strukturelle und gesellschaftliche Probleme mit sich bringt. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere Analyse der Minderheitenpolitik und ihrer Entwicklung.
Innerstaatlicher Minderheitenschutz: Dieses Kapitel präsentiert den theoretischen Rahmen für den innerstaatlichen Minderheitenschutz, indem es das Konzept der strukturorientierten konstruktiven Konfliktregulierung nach Ulrich Schneckener verwendet. Es wird erläutert, wie verfassungspolitische Maßnahmen die innergesellschaftlichen Strukturen beeinflussen und modifizieren können, um die Rechte von Minderheiten zu gewährleisten. Der Fokus liegt auf der Bedeutung von Gleichstellungsrechten, kulturellen Rechten sowie Repräsentations- und Selbstverwaltungsrechten für einen umfassenden Minderheitenschutz. Die theoretischen Überlegungen bilden den analytischen Rahmen für die Bewertung der rumänischen Minderheitenpolitik im folgenden Kapitel.
Von der Stagnation zur allmählichen Verbesserung: Minderheitenpolitik Rumäniens von 1989 bis 2003: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der rumänischen Minderheitenpolitik zwischen 1989 und 2003. Es beschreibt den langsamen und oft schwierigen Prozess der Umsetzung von Minderheitenrechten, geprägt von Stagnation und Rückschritten neben allmählichen Verbesserungen. Die Strategien der rumänischen Regierung zur Verbesserung der Situation der Roma werden detailliert untersucht, inklusive der Herausforderungen bei der Umsetzung und den Kompromissen, die geschlossen wurden. Die Bedeutung der Verfassungsreform von 2003 wird hervorgehoben und im Kontext der laufenden Bemühungen um einen effektiven Minderheitenschutz eingeordnet. Das Kapitel beleuchtet die Ambivalenz zwischen dem Druck der internationalen Gemeinschaft und dem innerstaatlichen Widerstand gegen tiefgreifende Reformen.
Schlüsselwörter
Roma, Rumänien, Minderheitenschutz, EU-Integration, Europarat, Diskriminierung, Minderheitenpolitik, Konfliktregulierung, Verfassungsreform, Transformationsprozess.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Rumänien am Wendepunkt: Innerstaatlicher Minderheitenschutz für Roma im Kontext der EU-Integration (1989-2003)"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den innerstaatlichen Minderheitenschutz für Roma in Rumänien zwischen 1989 und 2003 im Kontext der EU-Integration. Der Fokus liegt auf der Entwicklung der Minderheitenpolitik, den Herausforderungen und Erfolgen bei der Integration der Roma in die rumänische Gesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Situation der Roma nach dem Sturz Ceausescus, den Einfluss der EU-Integration auf die Minderheitenpolitik, theoretische Konzepte des Minderheitenschutzes, die Rolle des Europarates, und die Herausforderungen und Erfolge der rumänischen Minderheitenpolitik. Sie untersucht die Umsetzung von Minderheitenrechten, einschließlich Gleichstellungs-, Kultur-, Repräsentations- und Selbstverwaltungsrechten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu Rumänien am Wendepunkt (Situation der Roma nach Ceausescu und die Rolle des Europarates), innerstaatlichem Minderheitenschutz (theoretischer Rahmen), der Entwicklung der Minderheitenpolitik von 1989 bis 2003 (mit Fokus auf Regierungsstrategien und der Verfassungsreform von 2003) und einer Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter sind ebenfalls enthalten.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen analytischen Ansatz, der theoretische Konzepte des Minderheitenschutzes (z.B. strukturorientierte konstruktive Konfliktregulierung nach Ulrich Schneckener) mit der empirischen Analyse der rumänischen Minderheitenpolitik verbindet. Sie untersucht politische Strategien, verfassungsrechtliche Entwicklungen und die Herausforderungen bei der Umsetzung von Minderheitenrechten.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit beschreibt den langsamen und oft schwierigen Prozess der Umsetzung von Minderheitenrechten in Rumänien, geprägt von Stagnation und Rückschritten neben allmählichen Verbesserungen. Sie analysiert die Strategien der rumänischen Regierung, die Herausforderungen bei deren Umsetzung und die Bedeutung der Verfassungsreform von 2003. Die Ambivalenz zwischen internationalem Druck und innerstaatlichem Widerstand wird beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Roma, Rumänien, Minderheitenschutz, EU-Integration, Europarat, Diskriminierung, Minderheitenpolitik, Konfliktregulierung, Verfassungsreform, Transformationsprozess.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende und alle, die sich für Minderheitenpolitik, EU-Integration, die Situation der Roma in Rumänien und den Prozess der Demokratisierung nach autoritären Systemen interessieren.
- Citar trabajo
- Bachelor Damir Hajric (Autor), 2008, Innerstaatlicher Minderheitenschutz als Konfliktregelungsform: Roma in Rumänien im Kontext der EG/EU-Integration 1989-2003, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113021