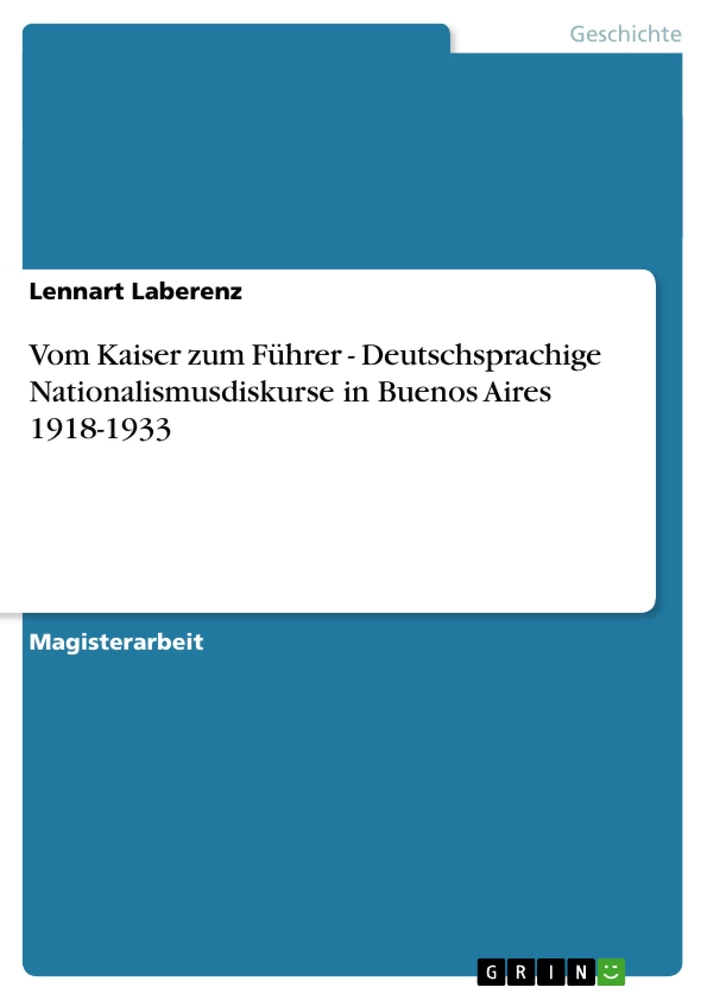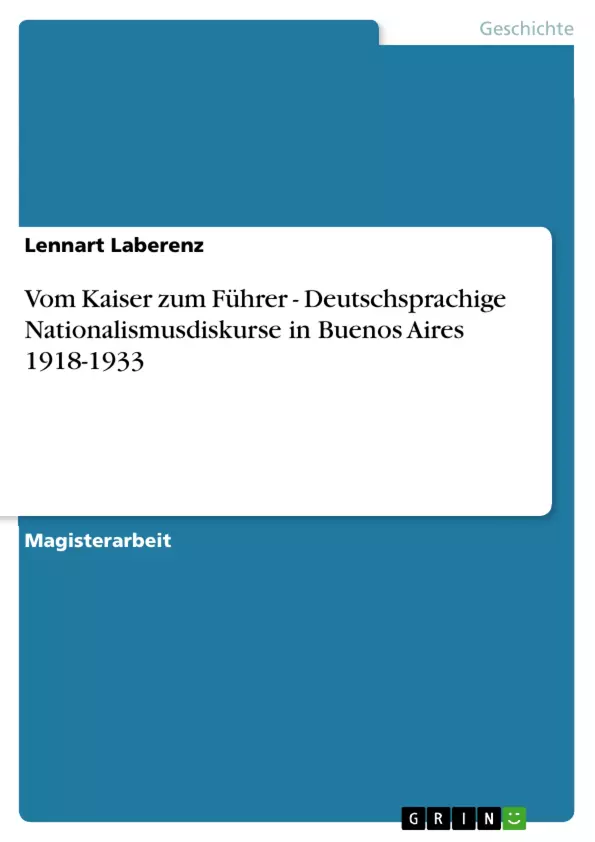Die Frage nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus bis zum 30. Januar 1933 ist
noch immer Gegenstand von ergiebigen Forschungsdiskussionen. Neben
Darstellungen, mit denen zuletzt etwa Hans-Ulrich Wehler auf den „charismatischen Führertypus“ und die enge, medial konstruierte Bindung Hitlers zur Mehrheit der Deutschen abhob, stehen Erkenntnisse über die Annäherungsprozesse des konservativen Bürgertums zur NSDAP und deren Führungspersonal.1 Insbesondere diese, nur lose mit den ökonomischen Krisen der Weimarer Republik verkoppelten politischen Annäherungen, die Peter Fritsche herausgearbeitet hat, zeichnen das Verhältnis eines konservativen und zum Teil noch ständisch geprägten Bürgertums als komplexes Ineinandergreifen von politischer Kultur, Machtansprüchen und ökonomischen Entwicklungen.2 Diese Forschungsdiskussionen beziehen sich dabei auf die Vorgänge in Deutschland und Europa. Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist dagegen die politische Kultur der Deutschsprachigen – ausgewanderte und sesshaft gewordene Deutsche, Österreicher, Schweizer – in Buenos Aires während der Weimarer Republik. Die „deutsche Kolonie“ oder „deutsche Gemeinschaft“ wies nach dem Ersten Weltkrieg in Buenos Aires sehr eng geschlossene Reihen einer im wesentlichen durch die Sprache organisierten Gemeinschaft auf.3 Zumindest bis 1933 galten das deutsche Idiom, sowie die Abstammung von Deutschsprechenden als Voraussetzung für den Einbezug in diesen Gemeinschaftsbegriff, der erst mit dem Nationalsozialismus und der Markierung der Differenz in der Gegengestalt des Juden sein Ende fand. Der Titel „vom Kaiser zum Führer“ bedeutet dabei nicht mehr als den Versuch Kontinuitätslinien und Zäsuren innerhalb eines Prozesses nachzuvollziehen, der sich durch die ausgesprochene Antihaltung gegen Republik und Parlament und für eine starke, autoritäre Führung artikulierte.
Ausgangspunkt der Überlegungen dieser Arbeit war eben dieser Punkt: die auf spezifischen Ideologien beruhenden, strukturellen Umformierungen einer sich kulturell verstehenden Gruppierung. Dabei will die Arbeit über die bloße Feststellung, dass die Deutschsprachigen in Buenos Aires die Nationalsozialisten mit weit geöffneten Armen und großer Einmütigkeit empfangen hätten4, hinausgehen bzw. versucht, diesen Prozess genauer zu ergründen. Damit rücken die Bedingungen der Möglichkeiten des Nationalsozialismus in einem spezifischen Kontext, nämlich weit entfernt von Deutschland, in den Blick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Deutsche Immigration nach Argentinien
- Einwanderung und Bevölkerungsentwicklung
- Deutsche Einwanderung
- Einwanderungszahlen
- Etappen jüdischer Einwanderung
- Rechtskonservative Gemeinschaftsbildung der Deutschsprachigen in Buenos Aires
- Aspekte sozioökonomischer Transformation der deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires bis zum Ende des ersten Weltkrieges
- Sozioökonomische Transformation der deutschsprachigen Gemeinschaft vor dem ersten Weltkrieg
- Aspekte der sozialen Entwicklung ab 1914
- Antiliberales Denken und (rechts-)konservative Gemeinschaftsbildung in Buenos Aires
- Antiliberales und antidemokratisches Denken in Deutschland und Argentinien
- Die positive Integration des völkischen Diskurses
- Struktur des völkischen Integrationsdiskurses
- Brückenbegriff im ideologischen Kampf um Gemeinschaft: Der Heimatdiskurs
- Richtungsstreit und politische Polarisierung zu Beginn der Weimarer Republik
- Die Wahrnehmung von Kriegsende und Versailles bei den Deutschsprachigen in Buenos Aires
- Politische Polarisierung: Die Auseinandersetzungen der Deutschsprachigen in Buenos Aires nach dem Ende des Ersten Weltkrieges
- Der Beginn der Weimarer Republik: Keiper vs. Alemann, der Streit zwischen „Reichsdeutschen“ und „Volkdeutschen“
- Deutsche Farben, deutsche Flaggen: Die konservative deutschsprachige Kolonie in Buenos Aires und ihre politische Symbolik
- Politische Symbolik als Auseinandersetzungsfeld zu Beginn der Weimarer Republik
- Identifikationsprobleme und offene Ablehnung: die politische Symbolik der Weimarer Republik und die deutschsprachige Gemeinschaft in Buenos Aires
- Antirepublikanische Propaganda und nationale Feiertage in Buenos Aires
- Zwischen politischer Parteinahme und Vermittlung: Die Rolle der Deutschen Gesandtschaft in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre
- Zusammenfassung: Die klaglose Neuorganisation politischer Symbolik - der Übergang zur Regierung Hitler
- Aspekte sozioökonomischer Transformation der deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires bis zum Ende des ersten Weltkrieges
- Das Organ der deutschnationalistischen Mehrheit: Die Deutsche La Plata Zeitung (DLPZ)
- Aufbau und Rolle der DLPZ
- Die DLPZ als Propagandaorgan in Argentinien
- Aspekte der politischen Ökonomie der DLPZ während der Weimarer Republik
- Etappen der Annäherung: Der zentrale Begriff der „nationalen Einheit“ in der DLPZ
- Die Feinde: Gegenspieler des völkischen Diskurses
- Frankreich
- Sozialdemokraten
- Sozialismus/Kommunismus
- Weltkrise, Wirtschaftskrise
- Hinwendung zur völkischen Bewegung: Schicksal und Geschichte
- Aspekte eines völkischen Integrationsdiskurses in der DLPZ
- 1930: Zustimmung zur autoritären Regierung, Entdeckung der nationalsozialistischen Bewegung
- Das antirationale Lebensgefühl: Die schicksalsschwere Zeit
- Reichsgründungsfeiern 1930-1932: Geschichte kulturelle Überlegenheit
- DLPZ und der Nationalsozialismus
- Heroismus
- DLPZ und Rassismus/Antisemitismus
- Die DLPZ als NS-Propagandaorgan: Emil Tjarks und „die Judenbehandlung im neuen Deutschland“
- Zusammenfassung: Die Politik der DLPZ
- Ausblick: Gemeinsamkeit und Differenz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung deutschsprachiger Nationalismusdiskurse in Buenos Aires zwischen 1918 und 1933. Ziel ist es, die politischen Haltungen und deren Ausdrucksformen innerhalb der deutschsprachigen Gemeinschaft in Argentinien während der Weimarer Republik zu analysieren und den Prozess der Annäherung an den Nationalsozialismus zu untersuchen. Der Fokus liegt auf den Bedingungen und Möglichkeiten des Aufstiegs des Nationalsozialismus in einem Kontext außerhalb Deutschlands.
- Deutschsprachige Immigration nach Argentinien und deren sozioökonomische Entwicklung.
- Rechtskonservative Gemeinschaftsbildung und politische Polarisierung innerhalb der deutschsprachigen Gemeinschaft.
- Die Rolle der Deutschen La Plata Zeitung (DLPZ) als Propagandainstrument.
- Analyse der politischen Symbolik und der Auseinandersetzungen um nationale Feiertage und Beflaggung.
- Entwicklung der politischen Haltung der Deutschsprachigen in Buenos Aires gegenüber der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Forschungsstand zum Aufstieg des Nationalsozialismus und die Lücke, die diese Arbeit durch die Untersuchung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires schließen möchte. Sie formuliert die Forschungsfrage und die Methode der Arbeit.
Deutsche Immigration nach Argentinien: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die deutsche Einwanderung nach Argentinien, die demografische Entwicklung und die verschiedenen Etappen der jüdischen Einwanderung. Es liefert den sozioökonomischen Kontext für das Verständnis der deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires.
Rechtskonservative Gemeinschaftsbildung der Deutschsprachigen in Buenos Aires: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung der deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Beginn der 1930er Jahre. Es beleuchtet die sozioökonomischen Veränderungen, das antiliberale und antidemokratische Denken, den Einfluss des völkischen Diskurses und die politischen Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinschaft, insbesondere den Richtungsstreit und die politische Polarisierung zu Beginn der Weimarer Republik. Es untersucht auch die Bedeutung der politischen Symbolik (Farben, Flaggen) und die Rolle der Deutschen Gesandtschaft.
Das Organ der deutschnationalistischen Mehrheit: Die Deutsche La Plata Zeitung (DLPZ): Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der DLPZ als zentrales Organ der deutschnationalistischen Mehrheit in Buenos Aires. Es untersucht den Aufbau und die Rolle der Zeitung, ihre Funktion als Propagandaorgan, die Aspekte der politischen Ökonomie, die Darstellung der „nationalen Einheit“, die Gegenspieler des völkischen Diskurses (Frankreich, Sozialdemokraten, Sozialismus/Kommunismus, Weltwirtschaftskrise), die Hinwendung zur völkischen Bewegung und schließlich die Darstellung von Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus.
Schlüsselwörter
Deutschsprachige Gemeinschaft, Buenos Aires, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Nationalismusdiskurse, Völkischer Integrationsdiskurs, Deutsche La Plata Zeitung (DLPZ), Politische Symbolik, Immigration, Sozioökonomische Entwicklung, Antisemitismus.
Häufig gestellte Fragen zur deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires (1918-1933)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Entwicklung deutschsprachiger Nationalismusdiskurse in Buenos Aires zwischen 1918 und 1933. Der Fokus liegt auf den politischen Haltungen und deren Ausdrucksformen innerhalb der deutschsprachigen Gemeinschaft während der Weimarer Republik und dem Prozess der Annäherung an den Nationalsozialismus in einem Kontext außerhalb Deutschlands.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die deutschsprachige Immigration nach Argentinien und deren sozioökonomische Entwicklung, die rechtskonservative Gemeinschaftsbildung und politische Polarisierung, die Rolle der Deutschen La Plata Zeitung (DLPZ) als Propagandainstrument, die politische Symbolik (Farben, Flaggen) und Auseinandersetzungen um nationale Feiertage, sowie die Entwicklung der politischen Haltung der Deutschsprachigen gegenüber der Weimarer Republik und dem Nationalsozialismus.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Einleitung, deutscher Immigration nach Argentinien, rechtskonservativer Gemeinschaftsbildung in Buenos Aires, der Deutschen La Plata Zeitung (DLPZ) als Propagandainstrument und einen Ausblick. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Unterpunkte, die die oben genannten Themen vertiefen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die Arbeit untersucht, wie sich die politischen Haltungen und Ausdrucksformen innerhalb der deutschsprachigen Gemeinschaft in Argentinien während der Weimarer Republik entwickelten und wie der Prozess der Annäherung an den Nationalsozialismus verlief. Sie analysiert die Bedingungen und Möglichkeiten des Aufstiegs des Nationalsozialismus außerhalb Deutschlands.
Welche Rolle spielte die Deutsche La Plata Zeitung (DLPZ)?
Die DLPZ wird als zentrales Organ der deutschnationalistischen Mehrheit analysiert. Die Arbeit untersucht ihren Aufbau, ihre Funktion als Propagandaorgan, ihre politische Ökonomie, die Darstellung von "nationaler Einheit", ihre Gegenspieler (Frankreich, Sozialdemokraten, Sozialismus/Kommunismus, Weltwirtschaftskrise), ihre Hinwendung zur völkischen Bewegung und schließlich ihre Darstellung von Nationalsozialismus, Rassismus und Antisemitismus.
Wie wird die sozioökonomische Entwicklung der deutschsprachigen Gemeinschaft dargestellt?
Die Arbeit beleuchtet die sozioökonomischen Veränderungen der deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires vom Ende des Ersten Weltkriegs bis in die 1930er Jahre. Dies liefert den Kontext für das Verständnis der politischen Entwicklungen und Haltungen.
Welche Bedeutung hatte die politische Symbolik?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von politischer Symbolik wie Farben und Flaggen und analysiert die Auseinandersetzungen darum zu Beginn der Weimarer Republik. Sie beleuchtet die Identifikationsprobleme der deutschsprachigen Gemeinschaft mit der Weimarer Republik und die antirepublikanische Propaganda.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Deutschsprachige Gemeinschaft, Buenos Aires, Weimarer Republik, Nationalsozialismus, Nationalismusdiskurse, Völkischer Integrationsdiskurs, Deutsche La Plata Zeitung (DLPZ), Politische Symbolik, Immigration, Sozioökonomische Entwicklung, Antisemitismus.
Welche Methode wird verwendet?
Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und die verwendete Methode der Arbeit (die im gegebenen Auszug nicht explizit genannt wird). Die Analyse basiert auf der Auswertung von Quellen wie der Deutschen La Plata Zeitung und weiteren relevanten Dokumenten zur deutschsprachigen Gemeinschaft in Buenos Aires.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit dem Nationalsozialismus, der deutschsprachigen Diaspora, der Geschichte Argentiniens und der politischen Propaganda in der Weimarer Republik befassen. Sie trägt zum Verständnis des Aufstiegs des Nationalsozialismus in einem internationalen Kontext bei.
- Citation du texte
- Lennart Laberenz (Auteur), 2006, Vom Kaiser zum Führer - Deutschsprachige Nationalismusdiskurse in Buenos Aires 1918-1933, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113038