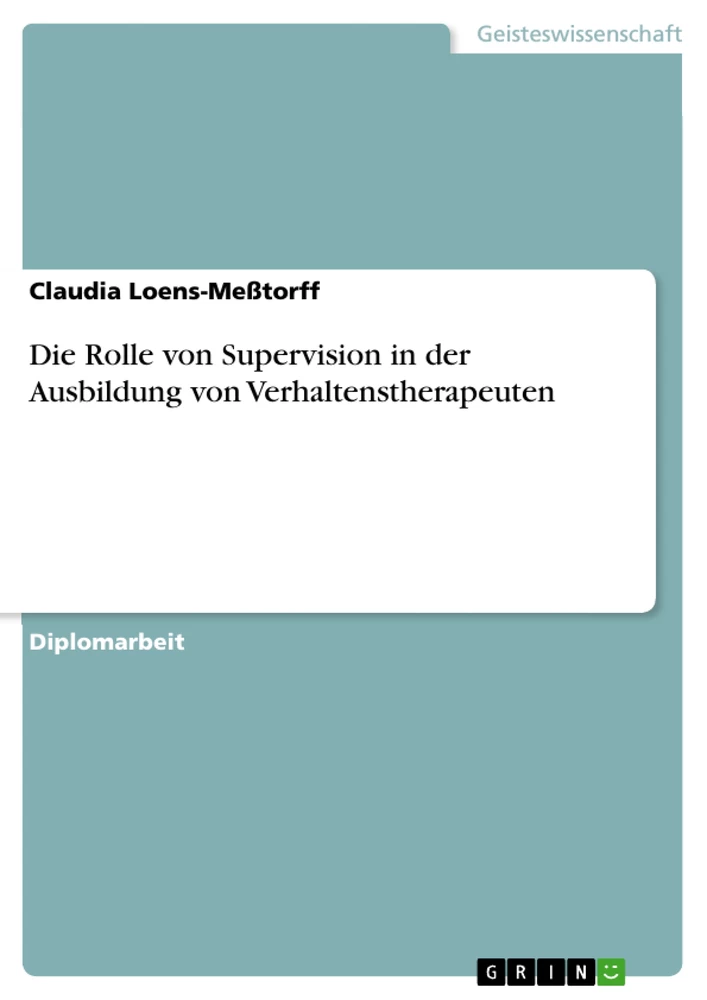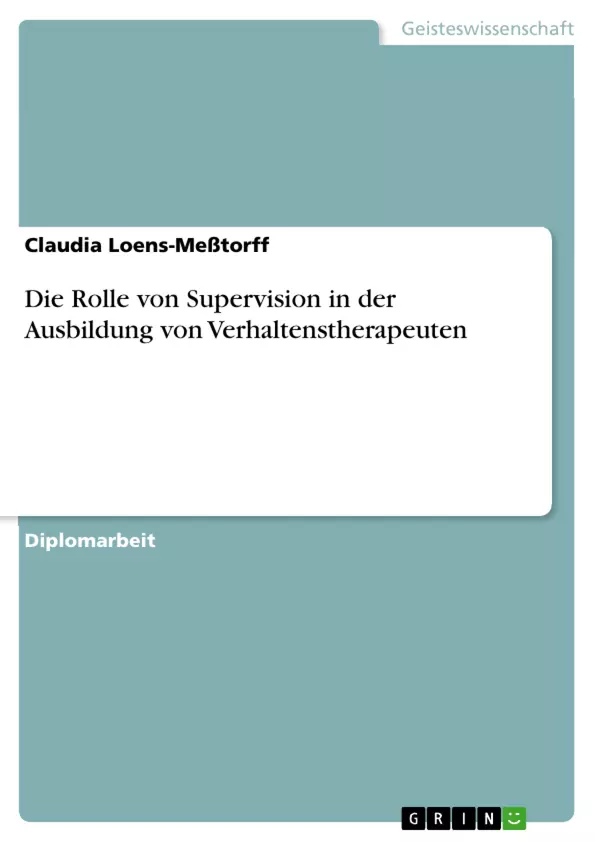Um die Rolle der Supervision in der Ausbildung von Verhaltenstherapeuten näher bestimmen zu können, sind zwei Untersuchungsschritte geplant:
Die Rolle der Supervision wird von zahlreichen Erwartungen des Umfeldes, in dem sie stattfindet, geprägt. Die Therapieschule, die für das Menschenbild und die therapeutische Haltung bestimmend ist, hat hierauf maßgeblichen Einfluss. Daher besteht der erste Untersuchungsschritt darin, das Profil der Erwartungen an die Supervision zu erheben: Neben der gesellschaftlich geteilten Erwartung an das Ergebnis der Psychotherapieausbildung (nämlich kompetente Therapeuten hervorzubringen) und der in diesem Rahmen stattfindenden Ausbildungssupervisionen, gibt es weitere Erwartungen an die Supervision. Sie soll befähigen, die Berufsrolle entsprechend der gesetzlichen Rahmenbestimmungen, der Berufsordnung, der Kammern, des Sozialgesetzes und des kassenärztlichen Vertragsrechtes wahrzunehmen. Hinzu kommen die Erwartungen der Ausbildungsinstitute als Arbeitgeber der Supervisoren und Erwartungen seitens der Patienten. Sie alle erwarten, dass die Ausbildungssupervisoren die Therapieprozesse der Ausbildungskandidaten mit einer hohen Mitverantwortung begleiten, so dass die Therapieprozesse während der Ausbildung erfolgreich sind. Darüber hinaus wird gemäß des Anspruchs, die eigene Qualität zu sichern und zu verbessern, auch erwartet, dass eine Evaluation der Supervisionsprozesse erfolgt. Nicht zuletzt sind die vielfältigen Ansprüche der Supervisanden zu nennen, die Zeit und erhebliche finanzielle Mittel in die Ausbildungssupervision investieren und Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme erwarten.
Der zweite Untersuchungsschwerpunkt beschäftigt sich damit, wie die Rolle der verhaltenstherapeutischen Supervision in der Praxis wahrgenommen wird: Drei Konzepte werden untersucht.
Der Sicherung von Lernprozessen soll dabei besondere Aufmerksamkeit bei der Auswertung gelten, weil hierdurch der Erfolg der Supervision bestimmt wird.
Ferner werden die Grenzen und Fehlerquellen der Ausbildungssupervision kritisch beleuchtet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Historische Wurzeln der Supervision und Ausbildungssupervision
- 1.2. Aktuelle Verortung der Ausbildungssupervision in der VT-Ausbildung
- 1.3. Lernen in der Supervision
- 1.4. Beschreibung der Untersuchung
- 2. Einflüsse auf die Ausbildungssupervision
- 2.1. Was ist Verhaltenstherapie
- 2.1.1. Lernen in der Verhaltenstherapie
- 2.1.2. Therapiekonzept in der Verhaltenstherapie
- 2.1.3. Methoden
- 2.1.4. Bedeutung für die Supervision
- 2.2. Die Patient-Therapeut-Beziehung
- 2.2.1. Das Therapeutenverhalten
- 2.2.2. Bedeutung für die Supervision
- 2.3. Die Gesetzlichen Rahmenbedingungen
- 2.3.1. Das Psychotherapeutengesetz
- 2.3.2. Qualitätsmanagement
- 2.3.3. Der Kassenantrag
- 2.3.4. Bedeutung für die Supervision
- 2.4. Das Ausbildungsinstitut
- 2.4.1. Rahmenbedingungen der Ausbildung
- 2.4.2. Bedeutung für die Supervision
- 2.5. Erwartungen der Supervisanden
- 2.5.1. Ausbildungszertifikat
- 2.5.2. Fachliche Anliegen
- 2.5.3. Persönliche Anliegen
- 2.5.3.1. Die berufliche Identität
- 2.5.3.2. Arbeitsspezifische Belastungen
- 2.5.4. Bedeutung für die Supervision
- 2.6. Erwartungen der Patienten
- 2.7. Die Supervisoren
- 2.8. Zusammenfassung
- 2.1. Was ist Verhaltenstherapie
- 3. Anwendungskonzepte der Supervision
- 3.1. Konzept nach Lieb
- 3.2. Programm nach Lohmann
- 3.3. Konzept nach Schmelzer
- 3.4. Auswertung
- 3.4.1. Das Verständnis von Supervision
- 3.4.2. Die Supervisoren
- 3.4.3. Supervisoren - Supervisandenbeziehung
- 3.4.4. Leitgedanken
- 3.4.5. Lernen in der Supervision
- 3.4.6. Programmstruktur
- 3.4.7. Messung des Sitzungserfolges und Transfer
- 4. Diskussion
- 4.1. Auseinandersetzung der Programme mit den Erwartungen
- 4.2. Grenzen und Misserfolgsquellen
- 4.2.1. Therapeutenkompetenz und Selbsteinschätzung
- 4.2.2. Programmstruktur
- 4.2.3. Kontrollfunktion des Supervisors
- 4.2.4. Lernatmosphäre in der Supervisionsgruppe
- 4.2.5. Weitere Misserfolgsquellen
- 4.3. Grenzen der Supervisionskonzepte
- 4.3.1. Setting
- 4.3.2. Selbstfürsorge
- 4.3.3. Ebenen der Reflexion
- 4.4. Erfolgsmessung
- 5. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Supervision in der Ausbildung von Verhaltenstherapeuten. Ziel ist es, die Einflüsse verschiedener Faktoren auf die Ausbildungssupervision zu analysieren und verschiedene Supervisionskonzepte zu vergleichen.
- Die Bedeutung von Supervision für die Ausbildung von Verhaltenstherapeuten
- Einflussfaktoren auf die Ausbildungssupervision (Gesetzgebung, Ausbildungsinstitut, Erwartungen)
- Vergleich verschiedener Supervisionskonzepte
- Erfolgsmessung und Grenzen der Supervision
- Lernen und Reflexion in der Supervision
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Arbeit basiert auf den persönlichen Erfahrungen der Autorin als Verhaltenstherapeutin mit Supervision in Ausbildung und Praxis. Sie untersucht den verhaltenstherapeutischen Ansatz von Supervision, beleuchtet historische Wurzeln und die aktuelle Bedeutung in der Ausbildung.
2. Einflüsse auf die Ausbildungssupervision: Dieses Kapitel analysiert diverse Einflussfaktoren auf die Ausbildungssupervision, darunter die Grundlagen der Verhaltenstherapie (Lernen, Therapiekonzepte, Methoden), die Therapeut-Patient-Beziehung, gesetzliche Rahmenbedingungen (Psychotherapeutengesetz, Qualitätsmanagement), die Rolle des Ausbildungsinstituts und die Erwartungen von Supervisanden und Patienten. Es beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen diesen Faktoren und deren Bedeutung für die Gestaltung und den Erfolg der Supervision.
3. Anwendungskonzepte der Supervision: Der Fokus liegt auf der detaillierten Darstellung und Auswertung verschiedener Supervisionskonzepte (Lieb, Lohmann, Schmelzer). Der Vergleich dieser Konzepte umfasst Aspekte wie das Verständnis von Supervision, die Rolle des Supervisors, die Beziehung zwischen Supervisor und Supervisand, Leitgedanken, Lernprozesse, Programmstruktur und die Messung des Sitzungserfolges und des Transfers in die Praxis.
Schlüsselwörter
Supervision, Verhaltenstherapie, Ausbildungssupervision, Psychotherapie, Qualitätsmanagement, Therapeut-Patient-Beziehung, Supervisionskonzepte, Lernen, Reflexion, gesetzliche Rahmenbedingungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ausbildungssupervision in der Verhaltenstherapie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Supervision in der Ausbildung von Verhaltenstherapeuten. Sie analysiert die Einflüsse verschiedener Faktoren auf die Ausbildungssupervision und vergleicht verschiedene Supervisionskonzepte.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung von Supervision für die Ausbildung von Verhaltenstherapeuten, die Einflussfaktoren auf die Ausbildungssupervision (Gesetzgebung, Ausbildungsinstitut, Erwartungen von Supervisanden und Patienten), den Vergleich verschiedener Supervisionskonzepte, die Erfolgsmessung und Grenzen der Supervision sowie das Lernen und die Reflexion in der Supervision.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Einflüsse auf die Ausbildungssupervision, Anwendungskonzepte der Supervision, Diskussion und Zusammenfassung/Schlussfolgerung. Die Einleitung erläutert den verhaltenstherapeutischen Ansatz der Supervision und deren historische Wurzeln. Kapitel 2 analysiert diverse Einflussfaktoren, Kapitel 3 stellt und vergleicht verschiedene Supervisionskonzepte (Lieb, Lohmann, Schmelzer) detailliert dar. Kapitel 4 diskutiert die Ergebnisse und Grenzen der Konzepte, und Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Faktoren beeinflussen die Ausbildungssupervision laut der Arbeit?
Die Arbeit identifiziert verschiedene Einflussfaktoren, darunter die Grundlagen der Verhaltenstherapie (Lernen, Therapiekonzepte, Methoden), die Therapeut-Patient-Beziehung, gesetzliche Rahmenbedingungen (Psychotherapeutengesetz, Qualitätsmanagement), die Rolle des Ausbildungsinstituts und die Erwartungen von Supervisanden und Patienten.
Welche Supervisionskonzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Konzepte von Lieb, Lohmann und Schmelzer. Der Vergleich umfasst Aspekte wie das Verständnis von Supervision, die Rolle des Supervisors, die Beziehung zwischen Supervisor und Supervisand, Leitgedanken, Lernprozesse, Programmstruktur und die Messung des Sitzungserfolges und des Transfers in die Praxis.
Wie werden die Supervisionskonzepte ausgewertet?
Die Auswertung der Supervisionskonzepte umfasst die Analyse des Verständnisses von Supervision, der Rolle der Supervisoren, der Supervisoren-Supervisanden-Beziehung, der Leitgedanken, der Lernprozesse in der Supervision, der Programmstruktur und der Erfolgsmessung und des Transfers der erlernten Inhalte in die Praxis.
Welche Grenzen und Misserfolgsquellen der Supervision werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert Grenzen und Misserfolgsquellen wie die Therapeutenkompetenz und Selbsteinschätzung, die Programmstruktur, die Kontrollfunktion des Supervisors, die Lernatmosphäre in der Supervisionsgruppe und weitere Faktoren wie Setting, Selbstfürsorge und Ebenen der Reflexion.
Wie wird der Erfolg der Supervision gemessen?
Die Arbeit thematisiert die Erfolgsmessung der Supervision, geht aber nicht auf konkrete Messmethoden im Detail ein. Die Auswertung der Konzepte beinhaltet die Messung des Sitzungserfolges und des Transfers.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Supervision, Verhaltenstherapie, Ausbildungssupervision, Psychotherapie, Qualitätsmanagement, Therapeut-Patient-Beziehung, Supervisionskonzepte, Lernen, Reflexion und gesetzliche Rahmenbedingungen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Verhaltenstherapeuten in Ausbildung, Ausbilder, Supervisoren und alle, die sich für die Ausbildung und Supervision in der Verhaltenstherapie interessieren.
- Citar trabajo
- Dr. med. Claudia Loens-Meßtorff (Autor), 2008, Die Rolle von Supervision in der Ausbildung von Verhaltenstherapeuten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113128