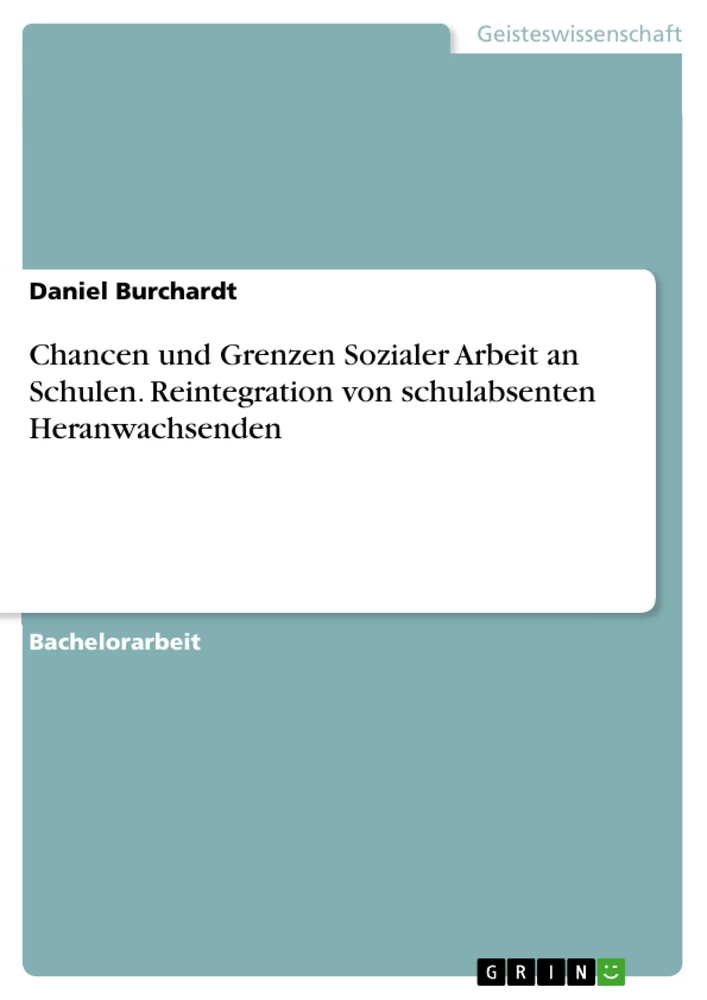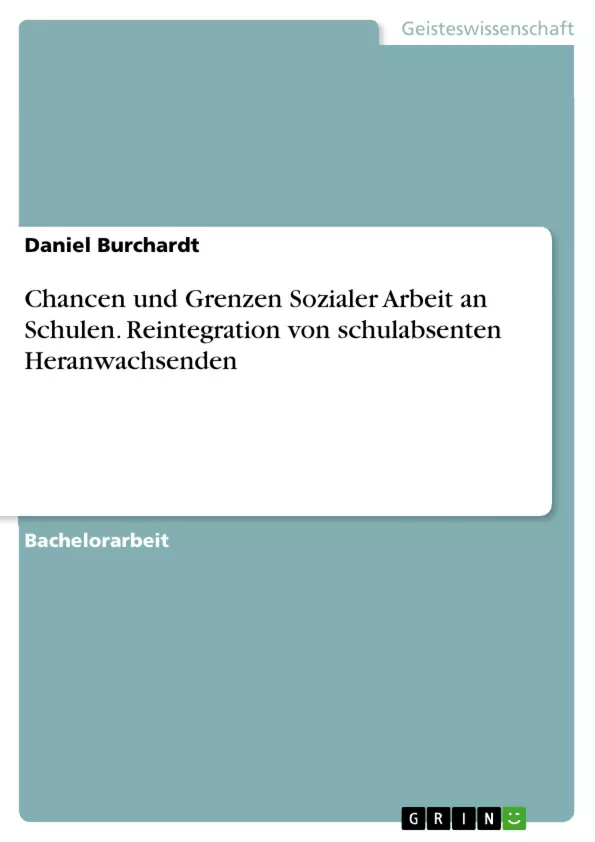Die folgende Arbeit setzt sich mit der Reintegration von Schülerinnen und Schülern bei Schulabsentismus auseinander.
Das Phänomen „Schulabsentismus“ ist in seinen unterschiedlichen Ausprägungen gegenwärtiges Thema an Schulen und stellt die Lehrkräfte, Eltern als auch Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter vor enorme Herausforderungen.
Zu den komplexen Aufgaben der pädagogischen Fachkräfte zählt die Aktivierung und Reintegration von schulvermeidenden Heranwachsenden.
Hier sind es die schulsozialpädagogischen Fachkräfte, welche oftmals feste Bezugspersonen sind und bei der Entwicklung sozialer Kompetenzen unterstützen.
Gelingende soziale Arbeit an Schulen ist jedoch von Faktoren abhängig, die sich in verschiedenen Disziplinen verorten lassen.
Die vorliegende Arbeit ist dazu multiperspektivisch ausgerichtet und gewährt Einblicke auf politischer, institutioneller, fachlicher und individueller Ebene
Thematisiert werden unter anderen:
- Erklärung und Einordnung von Begriffen des Schulabsentismus;
- Ursachen, Faktoren familiäre und individuelle Ausstattung von Heranwachsenden, welche Schulabsentismus fördern können;
- politische und rechtliche Rahmenbedingungen, welche die Handlungen von sozialpädagogischen Fachkräften beeinflussen;
- Unterscheidung von Schulsozialarbeit nach verschiedenen Institutionen;
- Notwendigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit;
- Qualifikation von Lehrkräften und Schulausstattung;
- Einstellung zur Schule, Bildungsgrad, und Erziehungskompetenz der Eltern;
- Einfluss von Peergroups und Subkulturen
Daraus ergibt sich die zentrale Fragestellung:
Welche Chancen und Grenzen bestehen für die Soziale Arbeit an Schulen bei der Reintegrationschulabsenter Heranwachsender?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulabsentismus
- Erscheinungsformen von Schulabsentismus
- Entstehungskontexte des Fernbleibens
- Einflussfaktoren für schulabsentes Verhalten
- Biologische Faktoren
- Familie
- Peers
- Schule
- Folgen
- Soziale Arbeit an Schulen
- Merkmale und Aufträge von Schulsozialarbeit
- Aufgaben und Ziele sozialpädagogischer Fachkräfte
- Differierende Trägermodelle
- Rahmenbedingungen
- Chancen und Grenzen sozialer Arbeit an Schulen
- Organisatorische Kooperation
- Vermittlung zwischen Institutionen
- Vernetzung mit kommunalen Vereinen
- Operative Kooperation
- Handlungsplanung mit Lehrkräften
- Beratung und Begleitung von Heranwachsenden
- Einzelfallarbeit mit Heranwachsenden
- Eltern als Ressource
- Gruppenangebote für Peers
- Organisatorische Kooperation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Arbeit an Schulen bei der Reintegration von schulabsenten Heranwachsenden. Sie analysiert die Erscheinungsformen und Entstehungskontexte von Schulabsentismus, die Einflussfaktoren und Folgen dieses Phänomens. Die Arbeit beleuchtet zudem die Aufgaben und Ziele der Sozialen Arbeit an Schulen, die Bedeutung von Kooperation und die Herausforderungen, die sich im Rahmen der Reintegration stellen.
- Schulabsentismus: Erscheinungsformen, Entstehungskontexte, Einflussfaktoren und Folgen
- Soziale Arbeit an Schulen: Merkmale, Aufträge, Aufgaben und Ziele
- Kooperation in der Schulsozialarbeit: Organisatorische und operative Ansätze
- Chancen und Grenzen der Sozialen Arbeit an Schulen bei der Reintegration
- Praktische Handlungsmöglichkeiten für sozialpädagogische Fachkräfte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert den Begriff des Schulabsentismus und beleuchtet seine verschiedenen Erscheinungsformen. Es werden Entstehungskontexte des Fernbleibens von der Schule sowie Einflussfaktoren auf das schulabsente Verhalten analysiert. Der Fokus liegt dabei auf biologischen, familiären, peer-bezogenen und schulischen Faktoren. Das Kapitel schließt mit einer Darstellung möglicher Folgen von Schulabsentismus auf individueller, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ebene.
Im zweiten Kapitel wird die Soziale Arbeit an Schulen als Arbeitsfeld vorgestellt. Es werden die Merkmale und Aufträge von Schulsozialarbeit erläutert, sowie die Aufgaben und Ziele sozialpädagogischer Fachkräfte im Schulkontext dargestellt. Das Kapitel beleuchtet zudem verschiedene Trägermodelle und Rahmenbedingungen der Schulsozialarbeit, wobei auch die Auswirkungen bestehender Differenzen betrachtet werden.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Inhalten von Kooperationen in der Schulsozialarbeit. Es werden sowohl organisatorische als auch operative Kooperationen hinsichtlich ihres Nutzens für Kinder und Jugendliche untersucht. Das Kapitel beleuchtet die Chancen und Grenzen der Sozialen Arbeit an Schulen und zeigt praktische Handlungsmöglichkeiten für sozialpädagogische Fachkräfte auf.
Schlüsselwörter
Schulabsentismus, Schulsozialarbeit, Reintegration, Kooperation, Handlungsmöglichkeiten, sozialpädagogische Fachkräfte, Einflussfaktoren, Folgen, Entstehungskontexte, Rahmenbedingungen.
- Quote paper
- Daniel Burchardt (Author), 2021, Chancen und Grenzen Sozialer Arbeit an Schulen. Reintegration von schulabsenten Heranwachsenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1131858