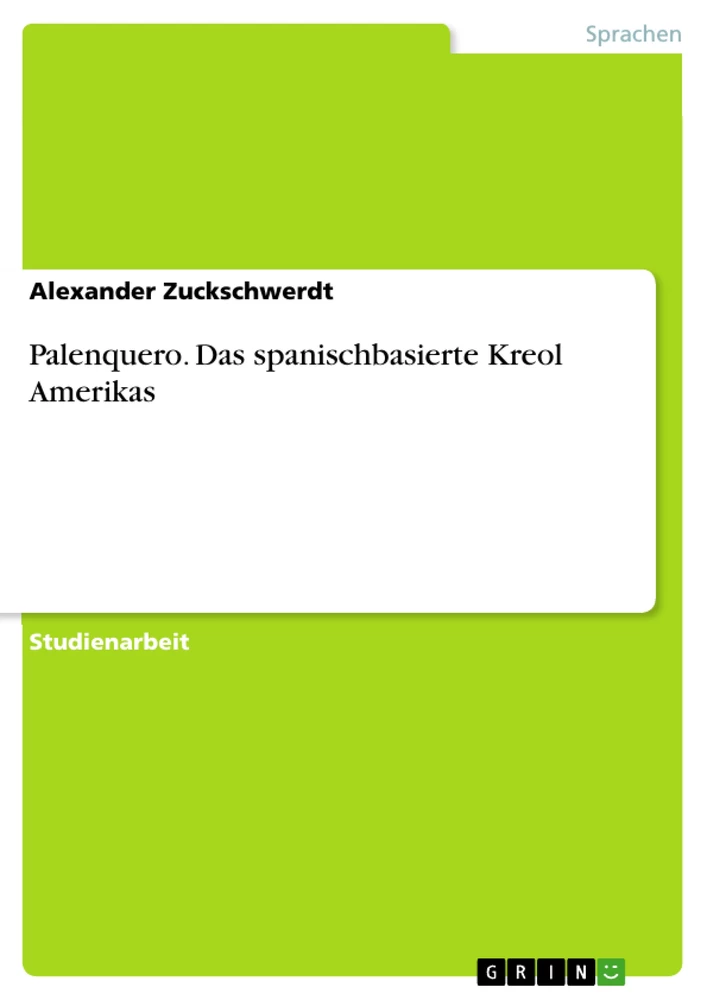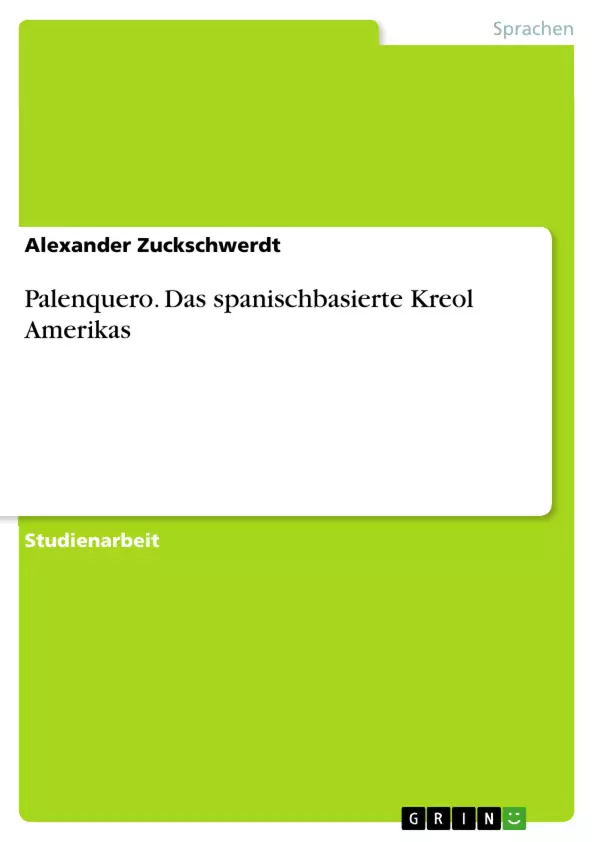Sowohl aus ethnologischer als auch soziologischer und sprachwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, stellen vor allem diejenigen Bevölkerungsgruppen der Erde einen ebenso reizvollen wie akuten Forschungsgegenstand dar, die sich als ethnische Minoritäten im Zuge der allgemeinen Globalisierungsbestrebungen vonseiten der „Massenkulturen“ und der damit einhergehenden kulturellen Nivellierung einer ständigen Bedrohung ihres Fortbestehens ausgesetzt sehen, da v. a. in sprachhistorischer Hinsicht das darwinistische Prinzip mehrfach beobachtet worden ist, nach dem der Schwächere (Substrat) dem Stärkeren (Superstrat) kurz- oder mittelfristig unterliegen und aussterben wird. Besonders in Hinblick auf die weltweite Sprachlandschaft lässt sich diese Tendenz hin zu einer linguistischen Ökonomisierung und Uniformierung insbesondere seit dem 20. Jahrhundert ersehen. Als Beispiel soll hier kurz die Dominanz des englischen Idioms erwähnt sein, das sich rapide in Klassenzimmern auf der gesamten Welt etabliert hat, sei es als Erst- oder als Zweitsprache. Englisch ist ein in beinah allen Teilen der Erde gebräuchliches Kommunikationsmedium, und insbesondere bei Aufeinandertreffen von verschiedensprachigen Sprechern (unabhängig, welche ihre jeweilige Muttersprache ist) ist es meist die intuitive erste Wahl zur Lösung des Verständigungsproblems.
Die Opfer solcher Cluster, die sich um wenige Weltsprachen herum bilden und einen klaren Gegenpol zu der Mannigfaltigkeit der derzeit rund 6000 noch aktiven Idiomen darstellen, sind in erster Linie Sprachen mit (sehr) geringen Sprecherzahlen. Sprachtod ist heute mehr denn je ein alltägliches Phänomen, sei es durch das Versterben sämtlicher ihr angehörender Sprecher oder aber aufgrund partieller bzw. totaler Marginalisierung der Substratkultur vonseiten der vorherrschenden Prestigekultur auf der Basis von Stigmatisierung und Diskriminierung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historische Hintergründe
- Linguistik
- Phonetik / Phonologie
- Morphosyntax
- Zusammenfassung
- LITERATUR
- Anhang: Karte Palenques siglo XVIII aus S. de Friedemann/Patiño Rosselli (1983)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Palenquero, einer spanischbasierten Kreolsprache, die in der Gemeinde San Basilio de Palenque in Kolumbien gesprochen wird. Ziel ist es, einen Überblick über die Strukturen des Palenquero zu geben, indem die Geschichte des Dorfes, die Phonetik/Phonologie und die Morphosyntax des Kreols beleuchtet werden.
- Die Entstehung und Entwicklung des Palenquero als Kreolsprache
- Die historischen Hintergründe der Gründung von San Basilio de Palenque
- Die phonetischen und phonologischen Besonderheiten des Palenquero
- Die morphosyntaktischen Strukturen des Palenquero
- Der Einfluss von Portugiesisch und Bantusprachen auf das Palenquero
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Palenquero als Beispiel für eine spanischbasierte Kreolsprache in der heutigen globalisierten Welt dar. Sie beleuchtet die Bedrohung, der ethnische Minderheiten durch die kulturelle Nivellierung ausgesetzt sind, und die Bedeutung des Erhalts von Sprachvielfalt.
Das Kapitel "Historische Hintergründe" zeichnet die Geschichte von San Basilio de Palenque nach, beginnend mit der Flucht afrikanischer Sklaven vor ihren Peinigern in Cartagena de Indias. Es beschreibt die Entstehung des Palenquero als Mischsprache aus Portugiesisch, Bantusprachen und Kastilisch und die Herausbildung einer autonomen Kreolsprache.
Das Kapitel "Linguistik" befasst sich mit den sprachlichen Besonderheiten des Palenquero. Es werden die phonetischen und phonologischen Merkmale des Kreols im Vergleich zum Spanischen vorgestellt, sowie die morphosyntaktischen Strukturen, die sich deutlich von der Superstratsprache unterscheiden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Palenquero, eine spanischbasierte Kreolsprache, die Geschichte von San Basilio de Palenque, die Entstehung von Kreolsprachen, die Phonetik und Phonologie des Palenquero, die Morphosyntax des Palenquero, der Einfluss von Portugiesisch und Bantusprachen auf das Palenquero, die kulturelle Identität und die Bedrohung durch kulturelle Nivellierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Palenquero?
Palenquero ist eine spanischbasierte Kreolsprache, die in San Basilio de Palenque in Kolumbien gesprochen wird. Sie entstand aus dem Kontakt zwischen afrikanischen Bantusprachen, Portugiesisch und Kastilisch.
Wie entstand das Dorf San Basilio de Palenque?
Es wurde von geflohenen afrikanischen Sklaven (Cimarrones) gegründet, die sich im Hinterland von Cartagena de Indias versteckten und dort eine autonome Gemeinschaft bildeten.
Welche Sprachen beeinflussten das Palenquero am stärksten?
Neben dem Spanischen (Superstrat) haben vor allem afrikanische Bantusprachen (Substrat) und das Portugiesische die Grammatik und den Wortschatz geprägt.
Warum ist Palenquero heute bedroht?
Wie viele Minderheitensprachen ist Palenquero durch die Globalisierung und die Dominanz von Weltsprachen wie Spanisch oder Englisch sowie durch soziale Stigmatisierung vom Aussterben bedroht.
Unterscheidet sich die Grammatik stark vom Spanischen?
Ja, die Morphosyntax des Palenquero weist typische Merkmale von Kreolsprachen auf, die sich deutlich von der spanischen Standardgrammatik unterscheiden, insbesondere in der Zeitformbildung und Satzstruktur.
- Citar trabajo
- Alexander Zuckschwerdt (Autor), 2008, Palenquero. Das spanischbasierte Kreol Amerikas, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113393