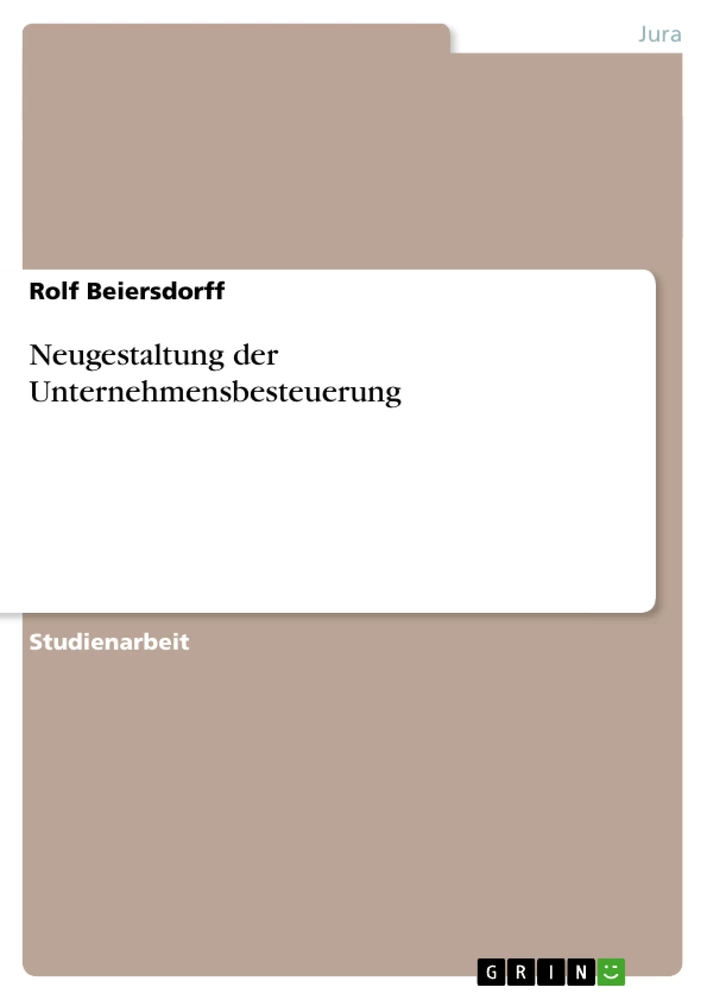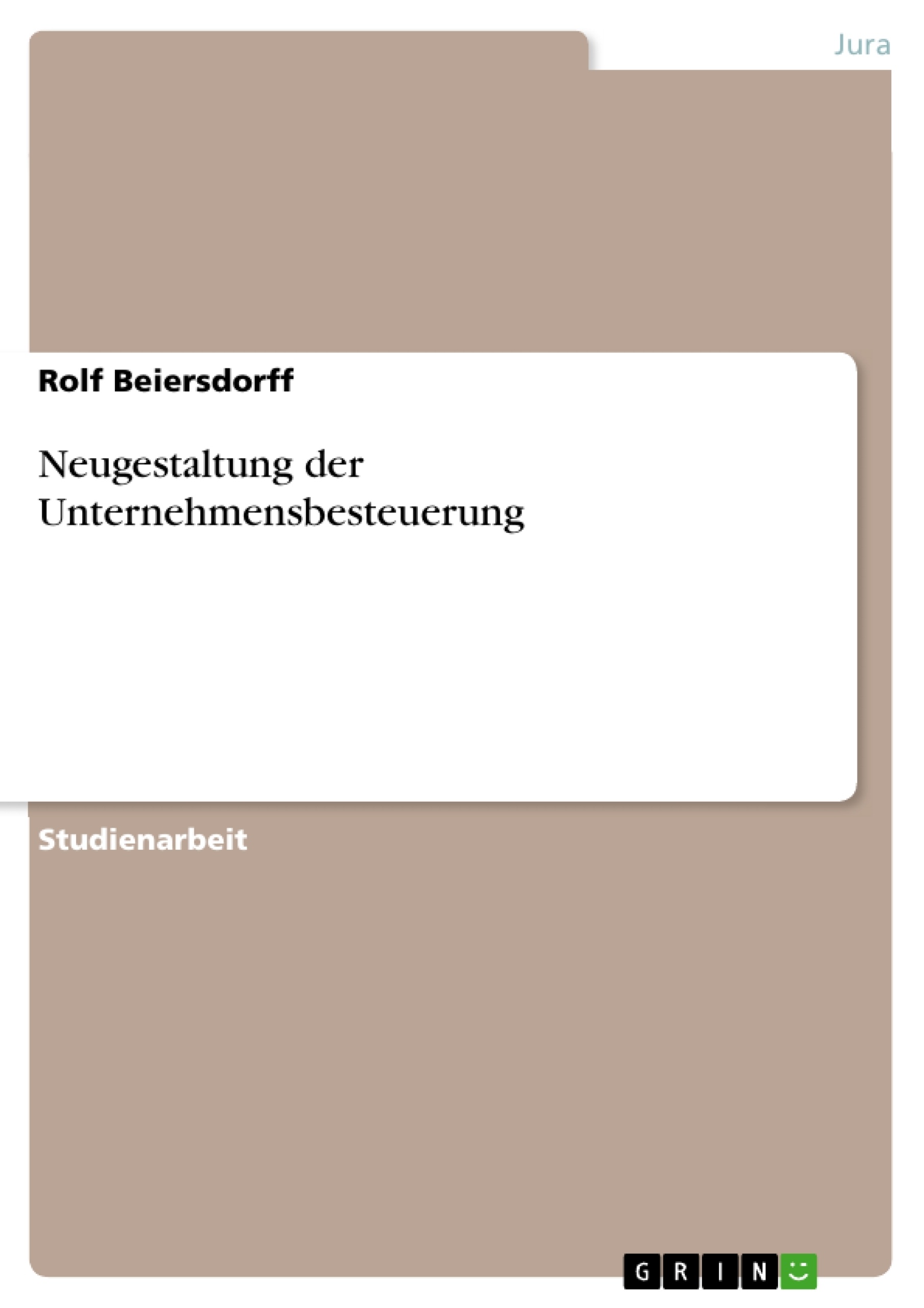Im Kampf um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands im europäischen und internationalen Vergleich liegt ein Hauptaugenmerk auf der Unternehmensbesteuerung. Dabei spielt bei Standortentscheidungen für große internationale Unternehmen der Faktor Steuerbelastung eine erhebliche Rolle. Wirtschaftliche Probleme ergeben sich vor allem aufgrund der Investitions- und Standortverlagerungen ins steuerlich günstigere Ausland. Während Standortkriterien wie Verkehrsanbindung und Infrastruktur sowie Fach- und Führungskräfte nur sehr langfristig verbessert werden können, ist dies für steuerliche Rahmenbedingungen eines Unternehmens nicht der Fall. Abgesehen von großen Unternehmen und Konzernen gilt es in der Bundesrepublik vor allem kleine und mittlere Unternehmen zu fördern, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und die herrschende Massenarbeitslosigkeit weiter einzudämmen.
Besonders auffällig scheinen die im internationalen Vergleich besonders hohen nominellen Steuersätze für Unternehmen in Deutschland. Allerdings muss hierbei die effektive, also tatsächliche Steuerbelastung berücksichtigt werden. Dabei ist insbesondere auf eine vorherrschende Gewinnverlagerung ins steuerlich günstigere Ausland zu achten, die das tatsächliche Steueraufkommen beträchtlich mindert.
Die erheblichen Mängel des deutschen Steuerrechts insgesamt führen zu derben Negativschlagzeilen. Nach einer Untersuchung des World Economic Forum im Jahre 2003, bei der die Effizienz von 102 Steuersystemen überprüft wurde, landete Deutschland auf dem letzten Platz. Die erhöhte Komplexität und Verkomplizierung des Steuerrechts setzen sich auch in der Unternehmensbesteuerung fort.
Diese Gründe geben dringlichen Anlass, über eine Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung nachzudenken und bekannte Fehler zu beseitigen. Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist zum einen die Darstellung von zwei großen Reformmodellen für eine Verbesserung der Unternehmensbesteuerung und deren kritische sowie vergleichende Betrachtung. Zum anderen wird die bereits verabschiedete Unternehmenssteuerreform 2008 vorgestellt, ausgewählte Bereiche anhand ihrer Zielsetzungen beurteilt und aufgezeigt, ob die erarbeiteten Reformmodelle Berücksichtigung fanden. Abschließend werden die Erkenntnisse thesenartig zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Die deutsche Unternehmensbesteuerung im Wettbewerb
- 1.2. Schwerpunkt der Arbeit
- 2. Begriffsklärung
- 2.1. Rechtsformneutralität
- 2.2. Finanzierungsneutralität
- 2.3. Leistungsfähigkeitsprinzip
- 3. Zwei Reformmodelle für die Unternehmensbesteuerung
- 3.1. Stiftung Marktwirtschaft: „Allgemeine Unternehmenssteuer“
- 3.1.1. „Allgemeine Unternehmenssteuer“ - Rechtsformneutralität bei der Besteuerung
- 3.1.2. neue Gemeindefinanzierung
- 3.1.2.1. Grundsteuer und Bürgersteuer
- 3.1.2.2. kommunale Unternehmenssteuer und Beteiligung am Lohnsteueraufkommen
- 3.1.3. Vom Halbeinkünfteverfahren zum Teileinnahmeverfahren
- 3.1.4. Anwendungseinschränkung für kleine Unternehmen und Anteilseigener
- 3.1.4.1. transparente Entnahmebesteuerung
- 3.1.4.2. Kleinunternehmerregelung
- 3.1.5. Vor- und Nachteile des Reformvorschlags
- 3.2. „Duale Einkommensteuer“ vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
- 3.2.1. duale statt synthetische Einkommensteuer
- 3.2.1.1. Einkünfte des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs (Kategorie 1)
- 3.2.1.2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Kategorie 2)
- 3.2.1.3. Einkünfte aus Kapitalvermögen (Kategorie 3)
- 3.2.1.4. Abgeleitete Einkünfte (Kategorie 4)
- 3.2.2. Gewinnspaltung und Berechnung der Eigenkapitalverzinsung
- 3.2.3. Einkünfteverteilung
- 3.2.4. getrennte Steuertarife
- 3.2.5. Besteuerung von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften
- 3.2.6. Behandlung der Gewerbesteuer
- 3.2.7. Vor- und Nachteile der Dualen Einkommensteuer
- 3.3. Vergleich der Konzepte
- 4. Die Unternehmenssteuerreform 2008
- 4.1. Ziele der Großen Koalition
- 4.2. Entwicklungsgeschichte der Reform
- 4.3. Überblick über die Eckwerte der Reform
- 4.4. Betrachtung der Änderungen im Einzelnen
- 4.4.1. Kapitalgesellschaften
- 4.4.2. Gewerbesteueränderungen
- 4.4.3. Besteuerung von Personenunternehmen
- 4.4.4. Verbesserung der Ansparabschreibungen
- 4.4.5. Einführung der Abgeltungssteuer
- 4.4.5.1 Erträge aus privaten Kapitalanlagen
- 4.4.5.2 Erträge aus betrieblichen Kapitalanlagen
- 4.4.5.3 Bemessungsgrundlage
- 4.4.5.4. Steuerabzug
- 4.4.5.5. Verluste
- 4.4.6 Gegenfinanzierungsmaßnahmen
- 4.4.6.1 Wegfall des Betriebsausgabenabzuges der Gewerbesteuer
- 4.4.6.2. Abschaffung der degressiven Afa nach § 7 II EStG
- 4.4.6.3. Einschränkung des Sofortabzugs für geringwertige Wirtschaftsgüter
- 4.4.6.4. Einschränkung von Gestaltungen durch Wertpapierleihe
- 4.4.6.5. Verschärfungen beim Mantelkauf (§ 8 IV KStG)
- 4.4.6.6. Besteuerung von Funktionsverlagerungen
- 4.4.6.7 Einschränkung des Abzugs von Finanzierungskosten und -anteilen
- 4.4.6.7.1. Modifizierung der Hinzurechnung bei der Gewerbesteuer
- 4.4.6.7.2. Modifizierte Zinsschranke statt § 8 a KStG
- 4.4.8 Steuertarife im Wettbewerb
- 4.4.9. Berücksichtigung der Reformkonzepte
- 5. Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Rechtsformneutralität und Finanzierungsneutralität
- Leistungsfähigkeitsprinzip
- Reformmodelle für die Unternehmensbesteuerung
- Unternehmenssteuerreform 2008
- Steuertarife im internationalen Wettbewerb
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit befasst sich mit der Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland. Sie analysiert die aktuelle Situation der deutschen Unternehmensbesteuerung im internationalen Wettbewerb und untersucht zwei Reformmodelle, die eine Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung anstreben: die „Allgemeine Unternehmenssteuer“ der Stiftung Marktwirtschaft und die „Duale Einkommensteuer“ des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Arbeit beleuchtet die Vor- und Nachteile der beiden Reformmodelle und setzt sie in Bezug zur Unternehmenssteuerreform 2008.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die deutsche Unternehmensbesteuerung im internationalen Wettbewerb dar und benennt den Schwerpunkt der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die zentralen Begriffe der Rechtsformneutralität, Finanzierungsneutralität und des Leistungsfähigkeitsprinzips erläutert. Das dritte Kapitel analysiert zwei Reformmodelle für die Unternehmensbesteuerung: die „Allgemeine Unternehmenssteuer“ der Stiftung Marktwirtschaft und die „Duale Einkommensteuer“ des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die „Allgemeine Unternehmenssteuer“ strebt eine Rechtsformneutralität bei der Besteuerung an und beinhaltet eine neue Gemeindefinanzierung sowie eine Anpassung des Halbeinkünfteverfahrens. Die „Duale Einkommensteuer“ hingegen verfolgt eine duale statt synthetische Einkommensteuer und beinhaltet eine Gewinnspaltung, eine getrennte Besteuerung von Einkünften aus Kapitalvermögen und eine getrennte Besteuerung von Personenunternehmen und Kapitalgesellschaften. Das vierte Kapitel befasst sich mit der Unternehmenssteuerreform 2008, die von der Großen Koalition beschlossen wurde. Die Reform beinhaltet eine Reihe von Änderungen, darunter die Einführung der Abgeltungssteuer, die Verbesserung der Ansparabschreibungen und die Anpassung der Gewerbesteuer. Die Arbeit analysiert die einzelnen Änderungen der Reform und setzt sie in Bezug zu den beiden zuvor analysierten Reformmodellen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Unternehmensbesteuerung, Rechtsformneutralität, Finanzierungsneutralität, Leistungsfähigkeitsprinzip, Reformmodelle, „Allgemeine Unternehmenssteuer“, „Duale Einkommensteuer“, Unternehmenssteuerreform 2008, Abgeltungssteuer, Gewerbesteuer, Steuertarife und internationaler Wettbewerb. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Reformmodelle und setzt sie in Bezug zur aktuellen Situation der deutschen Unternehmensbesteuerung im internationalen Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung in Deutschland wichtig?
Die Neugestaltung ist entscheidend für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Hohe Steuersätze führen oft zu Investitions- und Standortverlagerungen ins steuerlich günstigere Ausland.
Was sind die zentralen Begriffe der deutschen Unternehmensbesteuerung?
Wichtige Begriffe sind die Rechtsformneutralität (gleiche Besteuerung unabhängig von der Rechtsform), die Finanzierungsneutralität und das Leistungsfähigkeitsprinzip.
Welche Reformmodelle werden in der Arbeit analysiert?
Analysiert werden die „Allgemeine Unternehmenssteuer“ der Stiftung Marktwirtschaft und die „Duale Einkommensteuer“ des Sachverständigenrates.
Was ist das Ziel der „Allgemeinen Unternehmenssteuer“?
Dieses Modell strebt Rechtsformneutralität bei der Besteuerung an und beinhaltet Vorschläge für eine neue Gemeindefinanzierung sowie die Anpassung des Halbeinkünfteverfahrens.
Was zeichnet die „Duale Einkommensteuer“ aus?
Sie sieht eine getrennte Besteuerung von Arbeitseinkommen und Kapitaleinkünften vor, um die Kapitalflucht zu verhindern und Investitionen zu fördern.
Welche Änderungen brachte die Unternehmenssteuerreform 2008?
Die Reform umfasste unter anderem die Einführung der Abgeltungssteuer, Anpassungen bei der Gewerbesteuer und Verbesserungen bei den Ansparabschreibungen.
- Citation du texte
- Rolf Beiersdorff (Auteur), 2007, Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113547