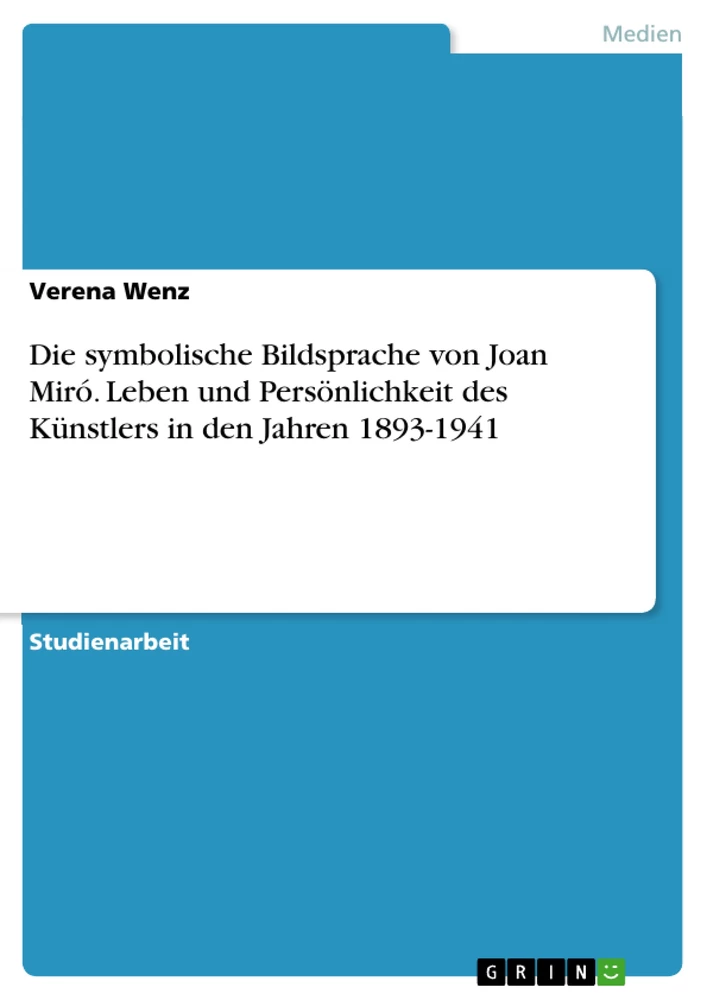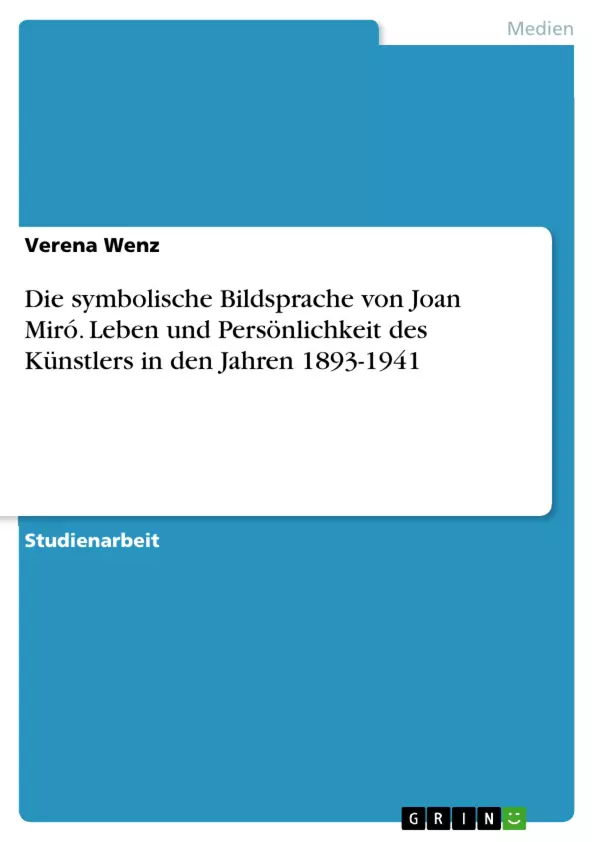Grazile Sterne, plakative Farben, skurrile Phantasiewesen – die Bildwelt Joan Mirós ist selbst für den kunstinteressierten Laien unverwechselbar. Zählt der Katalane zu den beliebtesten Künstlern des 20. Jhs., ist dies mit
Sicherheit in erster Linie der für seine Werke scheinbar so typischen leichten und optimistischen Ausstrahlung zu verdanken – einer heiteren „Naivität“, die seine Kunst nur allzu oft als Plädoyer für pure Lebenslust, grenzenlose
Ausgelassenheit und Spontaneität erscheinen lässt. Und doch – wenn dies auch die wohl bekannteste Seite des Schaffens Mirós ist, so sind die oft mit „Kinderbildern“ verglichenen unbeschwerten Spielereien, zumal meist dem Spätwerk zuzurechnen, nur ein Aspekt eines vielfältigen Œuvres, das zu verstehen weit mehr erfordert als den Rückgriff auf ein scheinbar untrübbares Gemüt: „(....) ich bin ein Pessimist. Immer denke ich, dass alles ganz schlimm ausgehen wird. Die humoristischen Elemente, die man vielleicht in meiner Malerei
findet, habe ich nicht gewollt. Wahrscheinlich kommt dieser Humor daher, dass ich versuche, meiner tragischen Veranlagung entgegenzuwirken: ist also Reaktion, nicht Absicht“1, bekennt Miró einmal selbst, und tatsächlich gilt der Maler unter Freunden als eher introvertiert, einzelgängerisch und zurückgezogen. Beschäftigt man sich genauer mit seinem Werk, erkennt man bald, dass es oft geradezu das Finstere, Schreckenerregende, bisweilen sogar ästhetisch Abstoßende ist, das den insgesamt doch rätselhaften Künstler zutiefst bewegt und seine Bilder anregt – ebenso wie die Gesamtheit seiner Arbeiten von einer tief empfundenen naturphilosophischen Weltsicht durchzogen ist, die Mensch und Schöpfung einer allgegenwärtigen, Werden und Vergehen
bestimmenden erotischen Energie unterworfen weiß.
Mehr als dem Spätwerk möchte sich diese Arbeit den frühen Schaffensperioden des Künstlers widmen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den 20er und 30er Jahren liegen soll, eine Zeit, zu der Miró, wenn auch nie wirklich eindeutig dem Surrealismus zugehörig, doch in ständigem Kontakt mit der sich in Paris um André
Breton formierten Künstlergruppe lebte, sich mit ihren Errungenschaften und Vorstellungen auseinandersetzte, sich an ihnen inspirierte und so allmählich immer mehr zu seinem eigenen, auf einer ganz persönlichen Symbolik gründenden Stil fand...
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Erste Schritte in Katalonien: Identitätssuche zwischen Tradition und Moderne
- Die 20er Jahre: Entwicklung einer symbolischen Bildsprache
- Mystik, Okkultismus, Astrologie – Mirós „magischer Surrealismus“
- Inspiration Literatur: die Werkgruppe der „Traummalereien“
- Zwischen Sehnsucht und Angst: „Paysages imaginaires“ und „Intérieurs hollandais“
- Das Material als Impulsgeber: Objektkunst und Anti-Ästhetik der 30er Jahre
- Miró im politischen Spannungsfeld: „Peinture sauvage“ und „Constellations“
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den frühen Schaffensperioden Joan Mirós, insbesondere den 1920er und 1930er Jahren. Ziel ist es, die Entwicklung seiner einzigartigen symbolischen Bildsprache zu ergründen und die verschiedenen Inspirationsquellen aufzuzeigen. Die Analyse konzentriert sich auf die repräsentativsten Werke dieser Zeit.
- Mirós Entwicklung von einer gegenständlichen zu einer abstrakten, symbolischen Malweise
- Der Einfluss von Mystik, Astrologie und okkulten Lehren auf Mirós Kunst
- Die Bedeutung surrealistischer Literatur als Inspirationsquelle
- Die Rolle des Materials als Impulsgeber für Mirós Kunst
- Mirós Reaktion auf die politischen Ereignisse der Zeit in seinem Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Diese Einleitung stellt Joan Miró und sein vielschichtiges Werk vor. Sie hebt die scheinbare Leichtigkeit und den Optimismus seiner Bilder hervor, kontrastiert dies aber mit Mirós eigenem Bekenntnis als Pessimist und weist auf die tiefere, oft düstere Thematik seiner Kunst hin, die von einer naturphilosophischen Weltsicht geprägt ist. Die Arbeit konzentriert sich auf die frühen Schaffensperioden, insbesondere die 20er und 30er Jahre, und untersucht die Entwicklung seiner Bildsprache und deren Inspirationsquellen.
Erste Schritte in Katalonien: Identitätssuche zwischen Tradition und Moderne: Dieses Kapitel beschreibt Mirós Anfänge in Katalonien. Es beleuchtet den Konflikt zwischen seinen bürgerlichen Eltern und seiner künstlerischen Neigung, sowie seine Auseinandersetzung mit der europäischen Avantgarde und dem traditionellen katalanischen Kunstverständnis. Mirós erste Ausstellungen ernteten heftige Kritik, was ihn zu einem Stilwandel führte: einer detaillierten, realistischeren Malweise, die jedoch weiterhin von der Modernität beeinflusst war. Seine Reise nach Paris 1919 markiert einen wichtigen Schritt in Richtung künstlerischer Unabhängigkeit.
Die 20er Jahre: Entwicklung einer symbolischen Bildsprache: Dieses Kapitel behandelt den wichtigen Wandel in Mirós Kunst in den 1920er Jahren, die Hinwendung zur abstrakten, symbolischen Malweise, für die er heute bekannt ist. Es wird die allmähliche Abkehr vom Gegenständlichen und die Entwicklung seiner eigenen, auf Chiffren basierenden Bildsprache analysiert.
Mystik, Okkultismus, Astrologie – Mirós „magischer Surrealismus“: Dieses Kapitel analysiert Mirós „magischen Surrealismus“ in der ersten Hälfte der 1920er Jahre. Es untersucht den Einfluss christlicher Mystik, insbesondere der Schriften Jakob Böhmes, auf seine Werke wie „Terre labourée“ und „Paysage catalan“. Der Fokus liegt auf der Deutung der komplexen Symbolik und der Bedeutung erotischer Energie als universelle Schöpfungskraft.
Inspiration Literatur: Die Werkgruppe der „Traummalereien“: Dieses Kapitel befasst sich mit den „Traummalereien“ Mirós (1925-1927), die stark von surrealistischer Literatur beeinflusst sind. Es analysiert Werke wie „L´addition“, das auf Alfred Jarrys „Le Surmâle“ Bezug nimmt, und „Le corps de ma brune“, das Textfragmente in die Bildsprache integriert. Obwohl diese Werke oft als Produkte des „psychischen Automatismus“ interpretiert werden, zeigt die Analyse von Skizzen, dass Mirós Arbeitsweise doch eine genaue Planung beinhaltet.
Zwischen Sehnsucht und Angst: „Paysages imaginaires“ und „Intérieurs hollandais“: Dieses Kapitel untersucht die Serien „Paysages imaginaires“ und „Intérieurs hollandais“, die durch das kontrastive Nebeneinander von Farbflächen und eine neue emotionale Tiefe gekennzeichnet sind. Der Fokus liegt auf der Ambivalenz zwischen Sehnsucht nach Vereinigung mit der Natur und existenziellen Ängsten, dargestellt in Werken wie „Chien aboyant à la lune“ und „Intérieur hollandais II“.
Das Material als Impulsgeber: Objektkunst und Anti-Ästhetik der 30er Jahre: Dieses Kapitel analysiert Mirós Hinwendung zur Objektkunst und Anti-Ästhetik in den 1930er Jahren. Es beleuchtet seine Verwendung von „wertlosen“, groben Materialien und die Bedeutung des Materials als eigenständigen Impulsgeber. Die Werke sind Ausdruck von Aggression gegen die Konventionen der Malerei und der Konsumorientierung des Kunstbetriebs. Mirós sinnlicher Umgang mit dem Material und die Verbindung zu archaischen, magisch-rituellen Aspekten werden diskutiert.
Miró im politischen Spannungsfeld: „Peinture sauvage“ und „Constellations“: Dieses Kapitel behandelt Mirós Reaktion auf den Spanischen Bürgerkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Es analysiert die „Peinture sauvage“ mit ihren grausam entstellten Figuren und grellen Farben als Ausdruck von Gewalt und Unterdrückung. Der Flucht nach Varengeville-sur-Mer und die Entstehung der „Constellations“ werden im Kontext des politischen Umfelds und des Künstlers Wunsch nach innerer Zuflucht betrachtet. Die Serie wird als ein optimistisches Bekenntnis zu einer besseren Zukunft interpretiert.
Schlüsselwörter
Joan Miró, Surrealismus, Symbolismus, Mystik, Astrologie, Okkultismus, Katalonien, Paris, Abstraktion, Objektkunst, Anti-Ästhetik, Erotik, Lebenskraft, Spanischer Bürgerkrieg, Zweiter Weltkrieg, „Traummalereien“, „Constellations“, Materialität, psychischer Automatismus, Bildsprache, Symboldeutung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Joan Miró - Entwicklung einer symbolischen Bildsprache
Was ist der Fokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die frühen Schaffensperioden Joan Mirós (1920er und 1930er Jahre), konzentriert sich auf die Entwicklung seiner einzigartigen symbolischen Bildsprache und untersucht die verschiedenen Inspirationsquellen. Die Analyse umfasst repräsentative Werke dieser Zeit.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Mirós Entwicklung von einer gegenständlichen zu einer abstrakten, symbolischen Malweise; den Einfluss von Mystik, Astrologie und okkulten Lehren; die Bedeutung surrealistischer Literatur als Inspirationsquelle; die Rolle des Materials als Impulsgeber; und Mirós Reaktion auf die politischen Ereignisse der Zeit (Spanischer Bürgerkrieg, Zweiter Weltkrieg) in seinem Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: Einführung; Mirós Anfänge in Katalonien und die Identitätssuche; die Entwicklung der symbolischen Bildsprache in den 1920er Jahren (inkl. "magischer Surrealismus", Einfluss surrealistischer Literatur und die Serien "Paysages imaginaires" und "Intérieurs hollandais"); Objektkunst und Anti-Ästhetik der 1930er Jahre; Mirós Reaktion auf den Spanischen Bürgerkrieg und den Zweiten Weltkrieg ("Peinture sauvage" und "Constellations"); und eine Schlussbemerkung.
Wie wird Mirós "magischer Surrealismus" beschrieben?
Mirós "magischer Surrealismus" wird als beeinflusst von christlicher Mystik (Jakob Böhme) beschrieben. Die Analyse fokussiert auf die Deutung der komplexen Symbolik und die Bedeutung erotischer Energie als universelle Schöpfungskraft in Werken wie „Terre labourée“ und „Paysage catalan“.
Welche Rolle spielt die Literatur?
Surrealistische Literatur spielt eine wichtige Rolle als Inspirationsquelle, besonders für die "Traummalereien" (1925-1927). Werke wie „L´addition“ (Bezug auf Alfred Jarrys „Le Surmâle“) und „Le corps de ma brune“ (Integration von Textfragmenten) werden analysiert. Die Analyse widerlegt dabei die reine Interpretation als "psychischer Automatismus" durch die Betrachtung von Skizzen.
Wie wird Mirós Umgang mit Materialien beschrieben?
In den 1930er Jahren wendet sich Miró der Objektkunst und Anti-Ästhetik zu. Die Verwendung von "wertlosen", groben Materialien und deren Bedeutung als eigenständiger Impulsgeber werden untersucht. Sein sinnlicher Umgang mit dem Material und die Verbindung zu archaischen, magisch-rituellen Aspekten werden hervorgehoben.
Wie reagiert Miró auf die politischen Ereignisse?
Mirós Reaktion auf den Spanischen Bürgerkrieg und den Zweiten Weltkrieg wird in den "Peinture sauvage" (grausam entstellte Figuren, grelle Farben als Ausdruck von Gewalt und Unterdrückung) und den "Constellations" (als optimistisches Bekenntnis zu einer besseren Zukunft im Kontext der Flucht und des Wunsches nach innerer Zuflucht) analysiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Joan Miró, Surrealismus, Symbolismus, Mystik, Astrologie, Okkultismus, Katalonien, Paris, Abstraktion, Objektkunst, Anti-Ästhetik, Erotik, Lebenskraft, Spanischer Bürgerkrieg, Zweiter Weltkrieg, „Traummalereien“, „Constellations“, Materialität, psychischer Automatismus, Bildsprache, Symboldeutung.
- Citar trabajo
- Magistra Artium Verena Wenz (Autor), 2006, Die symbolische Bildsprache von Joan Miró. Leben und Persönlichkeit des Künstlers in den Jahren 1893-1941, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113796