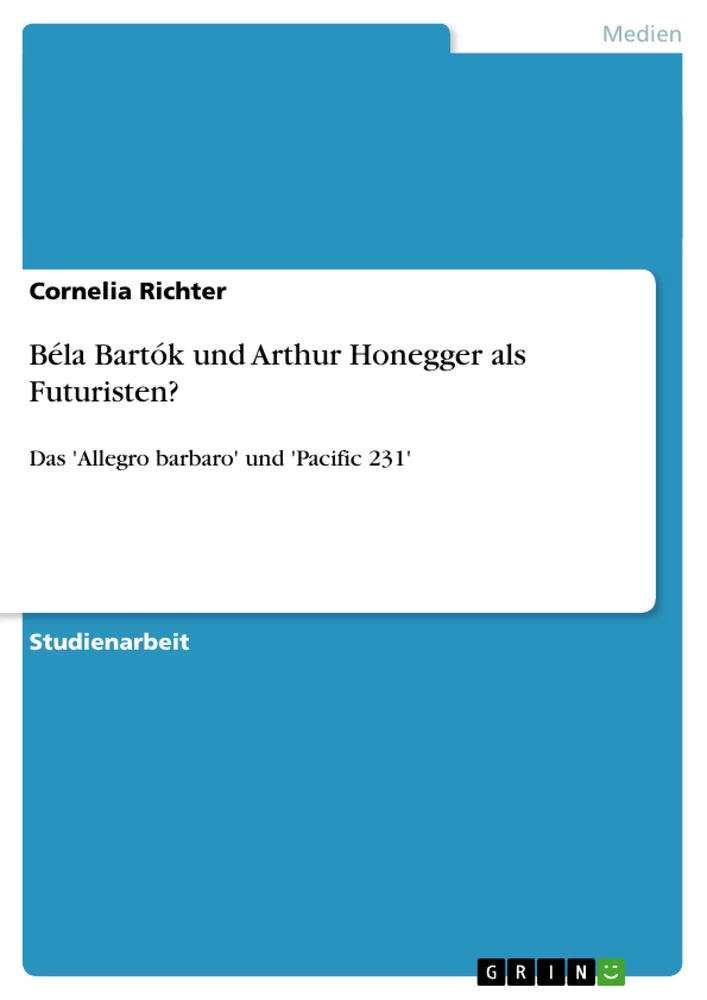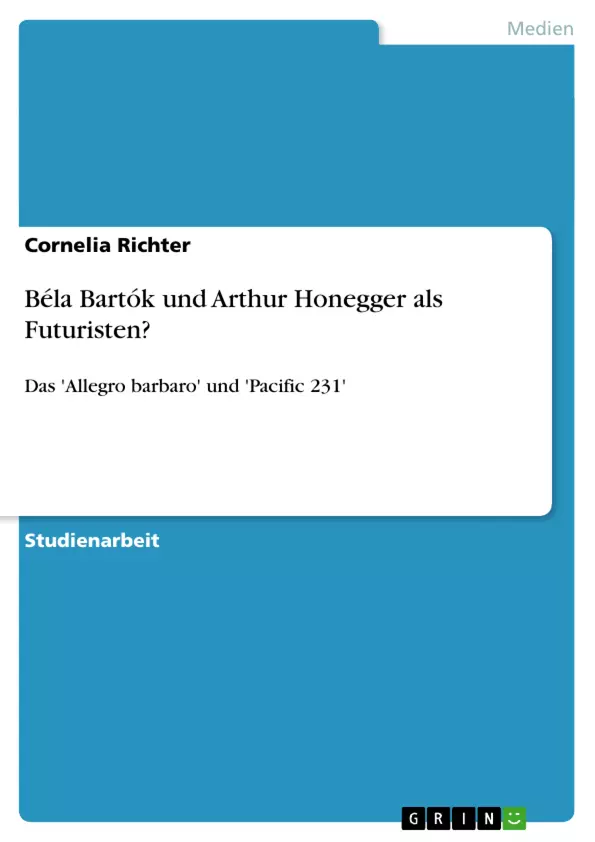Der musikalische Futurismus wollte vieles erreichen. Im Sinne der Bewegung im Allgemeinen wollte oder sollte man komplett mit der Tradition brechen, ja auf radikalste Weise alles bisher Dagewesene erneuern; somit sollte eine „revolutionär neue Ästhetik“ entstehen, deren „Mittelpunkt […] die Verherrlichung der modernen Industrie- und Maschinenwelt“ sein sollte. Die Strategien zur Erreichung dieses neuen ästhetischen Ideals beinhalteten die Liebe zur Gefahr, Kühnheit, Beweglichkeit, Dynamik und Geschwindigkeit. In der Musik im Speziellen waren die theoretischen Maxime etwa bezogen auf eine Forderung nach Enharmonik und auf eine Einführung des „ritmo libero“ nach dem Beispiel des „verso libero“ in der Poesie. Der italienische Komponist und Futurist Fr. Balilla Pratella forderte eine „Erweiterung der tonalen Basis in Richtung auf Polytonalität und Polymodalität.“ Im Frühjahr 1913 wurde das Manifest „L’arte dei rumori“ von Luigi Russolo öffentlich; er strebte eine Ersetzung der traditionellen Orchesterklänge durch Geräusche an, und brachte so ein völlig neues Konzept von Klang zur Diskussion.
Es waren Ideen wie diese, die den gesellschaftlichen Kunstbegriff umformen und endlich die starren Formen und Klänge der alten Welt vergessen machen sollten. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwiefern Bartóks Allegro barbaro und Honeggers Pacific 231 diesen Bruch mit der Tradition erreichen konnten oder wollten, und welche Einstellung die Komponisten zum Futurismus hegten...
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- BELA BARTOK (1881-1945): ALLEGRO BARBARO
- Entstehung des Werkes und Einordnung in Bartóks Schaffen
- Aufbau und musikalische Konzeption
- Einordnung in den Futurismus
- ARTHUR HONEGGER (1892-1955): PACIFIC 231
- Zur Entstehungsgeschichte und Intention
- Aufbau und musikalische Konzeption
- Einordnung in den Futurismus
- SCHLUSSBETRACHTUNG
- QUELLENANGABE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwiefern Béla Bartóks Allegro barbaro und Arthur Honeggers Pacific 231 als futuristische Werke betrachtet werden können. Sie analysiert die beiden Kompositionen im Kontext der futuristischen Bewegung und untersucht, ob und inwiefern sie die zentralen Prinzipien des Futurismus in der Musik umsetzen.
- Die Beziehung von Bartóks und Honeggers Musik zum Futurismus
- Die Rolle von Dynamik, Geschwindigkeit und Maschinenästhetik in den Werken
- Der Bruch mit der musikalischen Tradition und die Suche nach neuen Ausdrucksformen
- Die Einordnung der Werke in die jeweilige Schaffensperiode der Komponisten
- Die Rezeption der Werke in der zeitgenössischen Musikwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Ziele und Fragestellungen der Arbeit vor und erläutert den historischen Kontext des musikalischen Futurismus. Sie beleuchtet die wichtigsten Prinzipien der Bewegung und ihre Auswirkungen auf die Musik.
Das zweite Kapitel widmet sich Béla Bartóks Allegro barbaro. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Werkes, seine Einordnung in Bartóks Gesamtwerk und seine musikalische Konzeption. Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern das Allegro barbaro als futuristisches Werk betrachtet werden kann.
Das dritte Kapitel analysiert Arthur Honeggers Pacific 231. Es beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Werkes, seine musikalische Konzeption und seine Einordnung in Honeggers Gesamtwerk. Darüber hinaus wird untersucht, inwiefern Pacific 231 als futuristisches Werk betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den musikalischen Futurismus, Béla Bartók, Arthur Honegger, Allegro barbaro, Pacific 231, Dynamik, Geschwindigkeit, Maschinenästhetik, Bruch mit der Tradition, neue Ausdrucksformen, Rezeption, Musikgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Ziele des musikalischen Futurismus?
Der Futurismus forderte einen radikalen Bruch mit der Tradition, die Verherrlichung der Maschinenwelt, Dynamik, Geschwindigkeit und die Einbeziehung von Geräuschen in die Musik.
Gilt Béla Bartóks „Allegro barbaro“ als futuristisch?
Die Arbeit untersucht, inwiefern die motorische Dynamik und der Bruch mit konventionellen Klängen in diesem Werk futuristische Züge tragen.
Worum geht es in Arthur Honeggers „Pacific 231“?
Das Werk ist eine musikalische Hommage an eine Dampflokomotive und gilt als klassisches Beispiel für die Umsetzung einer Maschinenästhetik in der Musik.
Was forderte das Manifest „L’arte dei rumori“?
Luigi Russolo strebte darin die Ersetzung traditioneller Orchesterklänge durch eine „Kunst der Geräusche“ an, um die moderne Lebenswelt abzubilden.
Hatten Bartók und Honegger eine positive Einstellung zum Futurismus?
Die Untersuchung analysiert die tatsächliche Haltung der Komponisten zu dieser Bewegung und ob ihre Werke bewusste futuristische Manifeste oder eigenständige Entwicklungen waren.
- Citation du texte
- Cornelia Richter (Auteur), 2006, Béla Bartók und Arthur Honegger als Futuristen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113859