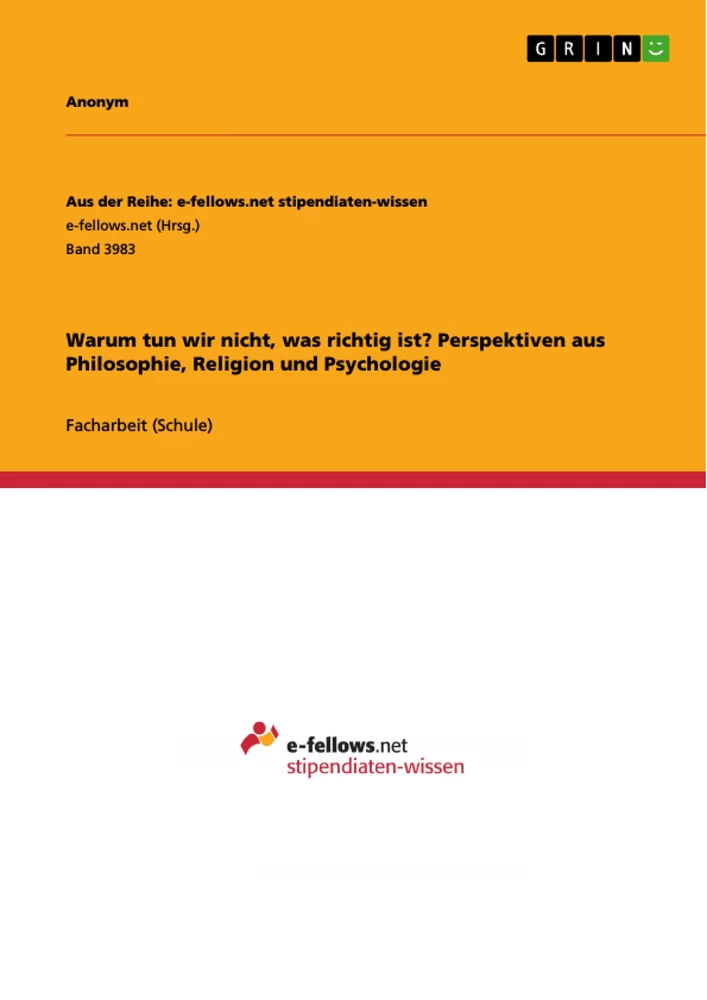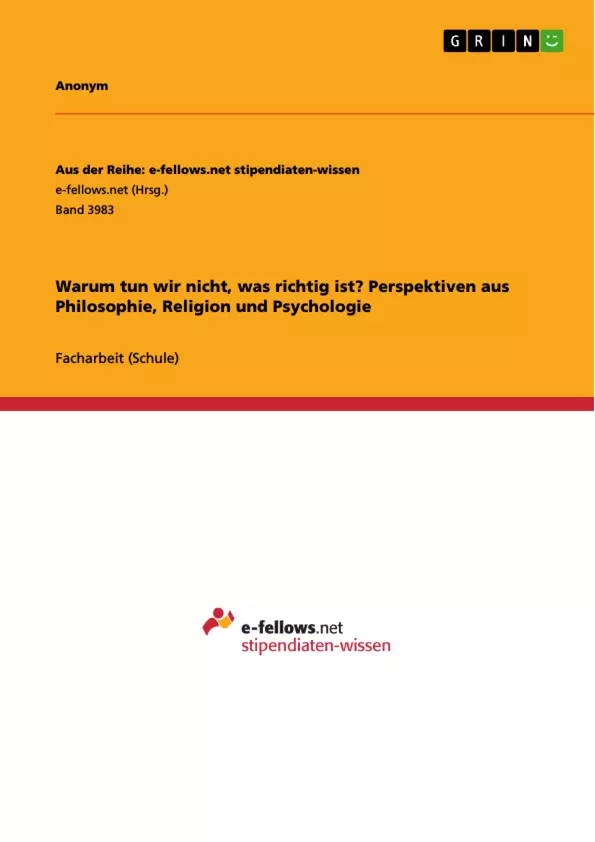Tag für Tag müssen wir Menschen Entscheidungen treffen, oft wissen wir auch ganz genau, was denn richtig und was falsch ist. Dennoch entscheiden wir uns oft dazu, nicht richtig zu handeln, z. B. reisen wir trotz den allbekannten Konsequenzen für das Klima mit dem Flugzeug in den Urlaub. Liegt es an der Bequemlichkeit, wenn wir uns dazu entscheiden, nicht richtig zu handeln? Oder ist uns das Klima eigentlich egal, obwohl wir engagierte Menschen, wie Greta Thunberg, loben? Warum tun wir Menschen nicht das, was richtig ist?
Die Beschäftigung mit dieser Frage lässt sich auf ein Interesse meinerseits zurückführen, da der Mensch sich jeden Tag mit neuen Moral-Konflikten konfrontiert sieht und ich wissen möchte, was die Gründe dafür in den verschiedenen Theorien der Psychologie, Philosophie und Religion sind. Macht uns dieses falsche Verhalten nicht zuletzt menschlich? All diese Fragen versucht die folgende Arbeit mit besonderem Gewicht auf die Frage „Warum tun wir nicht, was richtig ist?“ zu beantworten. Zunächst befasse ich mich mit Antworten in der Psychologie, welche sich mit verschiedenen Phänomenen, unserer individuellen Psyche und dem Problem des Klimawandels beschäftigt. Außerdem befasst sich der Hauptteil dieser Facharbeit mit der Ethik Immanuel Kants sowie Jean-Jacques Rousseaus Menschenbild. Zudem arbeite ich Ergebnisse bezüglich Antworten der monotheistischen abrahamitischen Religionen aus verschiedenen Quellen heraus, die von den Interviews, die ich mit religiösen Gelehrten geführt habe, unterstützt werden. Bevor ich das Fazit im Schlussteil formuliere, nehme ich selbst Stellung zu der Frage.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Antworten in der Psychologie
- Das Phänomen der Deindividuation erklärt anhand des Stanford-Prison-Experiments
- Das Phänomen des Gruppendenkens
- Das Phänomen des Zuschauereffekts
- Unsere Psyche und das richtige Handeln
- Das aktuelle Beispiel: der Klimawandel
- Antworten in der Philosophie
- Immanuel Kant und die Moral
- Jean-Jacques Rousseau und der Mensch
- Ergebnisse des Interview-Verfahrens
- Antworten aus dem Judentum
- Antworten aus dem Christentum
- Antworten aus dem Islam
- Stellungnahme
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, warum Menschen trotz Kenntnis des Richtigen oft falsch handeln. Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Perspektiven aus Psychologie, Philosophie und Religion zu beleuchten und zu analysieren, welche Faktoren dieses Verhalten beeinflussen.
- Das menschliche Verhalten im Kontext moralischer Konflikte
- Psychologische Phänomene wie Deindividuation, Gruppendenken und der Zuschauereffekt
- Ethische Perspektiven von Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau
- Religiöse Sichtweisen auf moralisches Handeln (Judentum, Christentum, Islam)
- Der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf individuelle Entscheidungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Warum handeln Menschen oft nicht nach dem, was sie als richtig erkennen? Sie skizziert den Forschungsansatz, der psychologische, philosophische und religiöse Perspektiven einbezieht, und kündigt die Struktur der Arbeit an. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Gründe für moralische Fehlentscheidungen und deren Kontextualisierung in verschiedenen Disziplinen. Die Einleitung betont das persönliche Interesse des Autors an der Thematik und die Relevanz der Fragestellung für das Verständnis menschlichen Verhaltens.
Antworten in der Psychologie: Dieses Kapitel erörtert psychologische Erklärungsansätze für moralisch fragwürdiges Handeln. Es wird der Zusammenhang zwischen Philosophie und Psychologie beleuchtet, wobei die Philosophie als Grundlage für psychologische Theorien hervorgehoben wird. Das Kapitel analysiert diverse psychologische Phänomene wie Deindividuation, Gruppendenken und den Zuschauereffekt, um zu zeigen, wie soziale und situative Faktoren individuelle Entscheidungen beeinflussen und zu moralischem Fehlverhalten führen können. Die Ausführungen werden durch die Bezugnahme auf klassische Studien wie das Stanford-Prison-Experiment veranschaulicht und mit Beispielen aus dem Alltag ergänzt.
Antworten in der Philosophie: Dieses Kapitel befasst sich mit philosophischen Perspektiven auf die Problematik. Im Mittelpunkt stehen die Ethik Immanuel Kants und das Menschenbild Jean-Jacques Rousseaus. Die jeweiligen ethischen Konzepte werden dargestellt und auf ihre Relevanz für die Fragestellung hin analysiert. Es wird untersucht, wie diese philosophischen Ansätze moralische Konflikte erklären und Handlungsmaximen für ethisch korrektes Verhalten formulieren. Die vergleichende Analyse der beiden Philosophen soll unterschiedliche moralphilosophische Positionen aufzeigen und ihre Erklärungskraft im Kontext der Hauptfragestellung beleuchten.
Ergebnisse des Interview-Verfahrens: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse von Interviews mit religiösen Gelehrten aus dem Judentum, Christentum und Islam. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Bezug auf die zentrale Frage nach den Ursachen für moralisch fragwürdiges Handeln analysiert. Die Zusammenstellung verschiedener religiöser Perspektiven zielt darauf ab, die Vielschichtigkeit der Thematik zu verdeutlichen und einen interreligiösen Vergleich zu ermöglichen. Die Interviews dienen als empirische Grundlage, um die theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel zu ergänzen und zu vertiefen.
Schlüsselwörter
Moral, Ethik, Psychologie, Philosophie, Religion, Deindividuation, Gruppendenken, Zuschauereffekt, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Judentum, Christentum, Islam, Klimawandel, menschliches Verhalten, moralische Konflikte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Warum Menschen trotz Kenntnis des Richtigen oft falsch handeln
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, warum Menschen trotz Kenntnis des Richtigen oft falsch handeln. Sie beleuchtet verschiedene Perspektiven aus Psychologie, Philosophie und Religion, um die Faktoren zu analysieren, die dieses Verhalten beeinflussen.
Welche Perspektiven werden in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit betrachtet psychologische, philosophische und religiöse Perspektiven. Psychologisch werden Phänomene wie Deindividuation, Gruppendenken und der Zuschauereffekt untersucht. Philosophisch werden die ethischen Konzepte von Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau analysiert. Religiös werden die Sichtweisen des Judentums, Christentums und Islams einbezogen.
Welche psychologischen Phänomene werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die psychologischen Phänomene Deindividuation, Gruppendenken und den Zuschauereffekt. Das Stanford-Prison-Experiment dient als Beispiel für Deindividuation. Es wird untersucht, wie soziale und situative Faktoren individuelle Entscheidungen beeinflussen und zu moralischem Fehlverhalten führen können.
Welche philosophischen Ansätze werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die ethischen Konzepte von Immanuel Kant und Jean-Jacques Rousseau. Es wird untersucht, wie diese Ansätze moralische Konflikte erklären und Handlungsmaximen für ethisch korrektes Verhalten formulieren. Der Vergleich soll unterschiedliche moralphilosophische Positionen aufzeigen und deren Erklärungskraft beleuchten.
Welche religiösen Perspektiven werden einbezogen?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse von Interviews mit religiösen Gelehrten aus dem Judentum, Christentum und Islam. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Bezug auf die Ursachen für moralisch fragwürdiges Handeln analysiert. Der interreligiöse Vergleich soll die Vielschichtigkeit der Thematik verdeutlichen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu den Antworten der Psychologie und Philosophie, die Ergebnisse eines Interviewverfahrens mit religiösen Vertretern, eine Stellungnahme und ein Fazit. Die Kapitel enthalten jeweils Zusammenfassungen der behandelten Themen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Moral, Ethik, Psychologie, Philosophie, Religion, Deindividuation, Gruppendenken, Zuschauereffekt, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Judentum, Christentum, Islam, Klimawandel, menschliches Verhalten, moralische Konflikte.
Gibt es Beispiele im Text?
Ja, der Text verwendet das Stanford-Prison-Experiment als Beispiel für Deindividuation und bezieht den Klimawandel als aktuelles Beispiel für moralische Konflikte mit ein. Zusätzlich werden Beispiele aus dem Alltag verwendet, um die psychologischen Phänomene zu veranschaulichen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung besteht darin, verschiedene Perspektiven aus Psychologie, Philosophie und Religion zu beleuchten und zu analysieren, welche Faktoren moralisch fragwürdiges Handeln beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Gründe für moralische Fehlentscheidungen und deren Kontextualisierung in verschiedenen Disziplinen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2020, Warum tun wir nicht, was richtig ist? Perspektiven aus Philosophie, Religion und Psychologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1138750