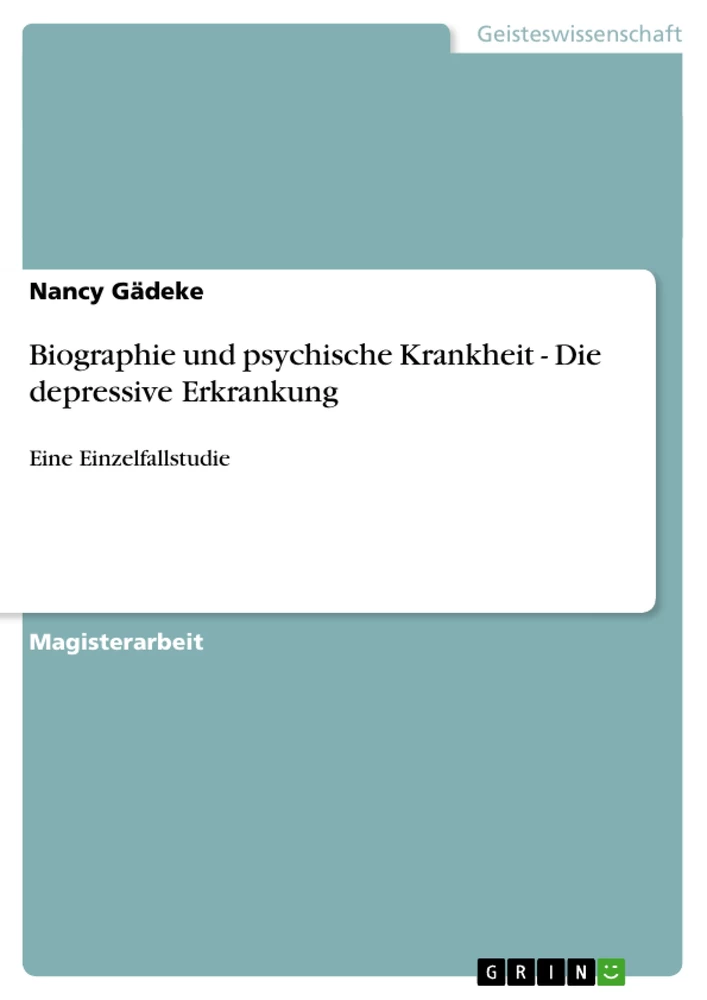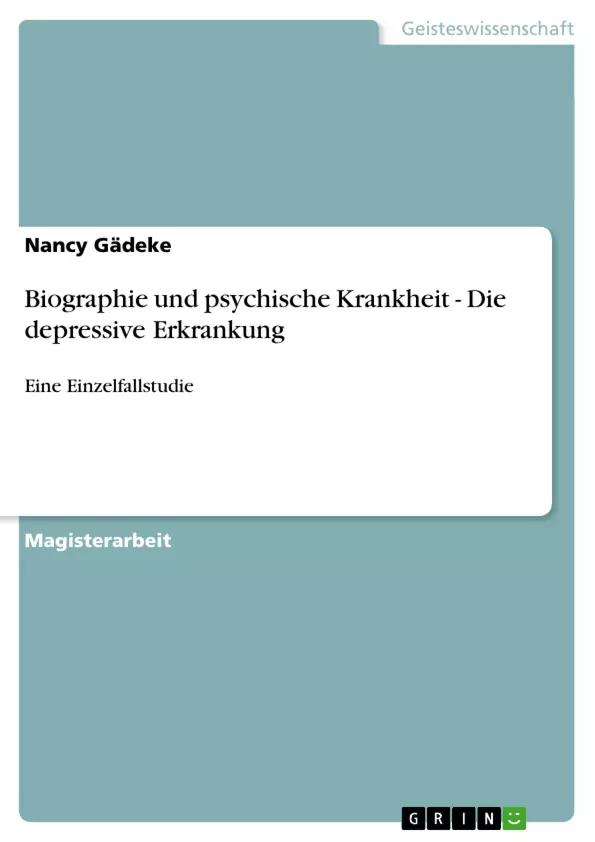Auszug des Gutachtens:
Nancy Gädeke stellt die Biographien von Menschen, die an einer Depression erkrankt sind, in ihrer Gesamtheit in den Mittelpunkt ihrer Untersuchung. Mit Methoden der Biographieanalyse (Fritz Schütze) untersucht sie das Krankheitsbild der Depression eingebettet in den Kontext des gesamten Lebenslaufs. Sie betrachtet Probleme der Lebensführung in unterschiedlichen Lebensphasen und beschreibt inneres und äußeres Erleben von depressiven Menschen im Kontext des gesamten Lebenslaufs. Die Magisterarbeit Nancy Gädekes ist theoretisch in der phänomenologischen Soziologie und im symbolischen Interaktionismus verankert. Methodologisch ist die Arbeit ein Beitrag zur qualitativ-rekonstruktiven Sozialforschung.
In ihrer Arbeit beschäftigt sich die Autorin differenziert mit dem Verfahren der autobiographischen Erzählanalyse auf der Grundlage narrativer Interviews. Das für die Fallstudie ausgewählte Interview stammt von einer Patientin, deren Erkrankung erst in einem sehr fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wurde, und die entsprechend erst nach einem völligen Zusammenbruch behandelt wird. Biographieanalytisch betrachtet handelt es sich bei der Informantin um eine Frau, die eine tiefgehende Verlaufskurve des Erleidens durchlebt hat und noch durchlebt, und die mit dem Einsetzen der Krankheitsdefinition und Behandlung in einem Prozess der biographischen Transformation steckt. Die Autorin stellt Prozessstrukturen des Lebensablaufs fest und bespricht das Interview im Lichte relevanter Kategorien der soziologischen Biographieanalyse. So entwickelt die Autorin z.B. Dimensionen von Fremdheit in der Lebensgeschichte ihrer Informantin. Neben der Darlegung der thematischen Entfaltung der Lebensgeschichte und ihrer Beschreibung in biographieanalytischer Hinsicht leistet die Autorin auch eine Beschreibung der sprachlichen Darstellungsprozesse im Verlauf des Interviews nach Verfahren der ethnomethodologischen Konversationsanalyse.
Einen weiteren Schwerpunkt der Fallstudie bilden die Entwicklung einer biographischen Gesamtformung und die differenzierte Beschreibung von Prozessen biographischer Arbeit. Hier verdichtet die Autorin die gewonnenen Analyseergebnisse zu einem komplexen Bild des Zusammenspiels von Lebenslauf, Beziehungsmustern, Verletzungsdispositionen, akkumuliertem Verlaufskurvenpotential und psychischer Krankheit.
Inhaltsverzeichnis
- Forschungsprozess
- Einführende Bemerkung zur depressiven Erkrankung
- Entstehung und Wandel des Forschungsinteresses, Entwicklung des Forschungsdesigns
- Stand der Forschung im untersuchten Feld
- Durchführung der Interviews
- Vorüberlegungen und Entscheidungen betreffend der Informantengewinnung
- Vorgespräch und Verlauf des Interviews
- Methodische und theoretische Überlegungen und Konzepte
- Was bringt autobiographisch- narratives Interview hervor?
- Technik des autobiographisch-narrativen Interviews
- Gliederung des autobiographisch-narrativen Interviews
- Schritte der Textanalyse
- Das Konzept der Verlaufskurve
- Fallstudie: Susanne Bräuer
- Strukturelle Beschreibung
- Biographische Gesamtformung
- Biographische Arbeit: Theoretische Verarbeitung und handlungsschematische Bearbeitung der Verlaufskurve
- Literaturverzeichnis
- Erklärung
- Anhang:
- Transkriptionszeichen
- Interview mit Susanne Bräuer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Magisterarbeit befasst sich mit der depressiven Erkrankung aus biographieanalytischer Perspektive. Die Arbeit basiert auf einem narrativen Interview mit einer Person, die an einer depressiven Erkrankung leidet. Ziel der Arbeit ist es, die subjektiven Erfahrungen der Erkrankung aus der Perspektive der Betroffenen zu beleuchten und die Auswirkungen der Erkrankung auf die Biographie der Person zu analysieren.
- Die subjektiven Erfahrungen der depressiven Erkrankung
- Die Auswirkungen der depressiven Erkrankung auf die Biographie
- Die Rolle von Lebensereignissen und sozialen Faktoren bei der Entstehung und Bewältigung der Erkrankung
- Die Bedeutung von Coping-Strategien und Ressourcen für die Bewältigung der Erkrankung
- Die Bedeutung von Unterstützungssystemen und professioneller Hilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit befasst sich mit dem Forschungsprozess. Es werden die Entstehung des Forschungsinteresses, die Entwicklung des Forschungsdesigns und die Durchführung der Interviews erläutert. Dabei werden auch die methodischen und theoretischen Grundlagen der Arbeit vorgestellt.
Das zweite Kapitel widmet sich den methodischen und theoretischen Überlegungen und Konzepten, die der Arbeit zugrunde liegen. Es werden die Technik des autobiographisch-narrativen Interviews und das Konzept der Verlaufskurve erläutert.
Das dritte Kapitel präsentiert die Fallstudie von Susanne Bräuer. Es werden die strukturelle Beschreibung der Biographie, die biographische Gesamtformung und die biographische Arbeit der Probandin im Hinblick auf die Verlaufskurve analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die depressive Erkrankung, Biographieanalyse, narratives Interview, Verlaufskurve, subjektive Erfahrungen, Lebensereignisse, soziale Faktoren, Coping-Strategien, Ressourcen, Unterstützungssysteme, professionelle Hilfe.
- Citation du texte
- MA Nancy Gädeke (Auteur), 2008, Biographie und psychische Krankheit - Die depressive Erkrankung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113910