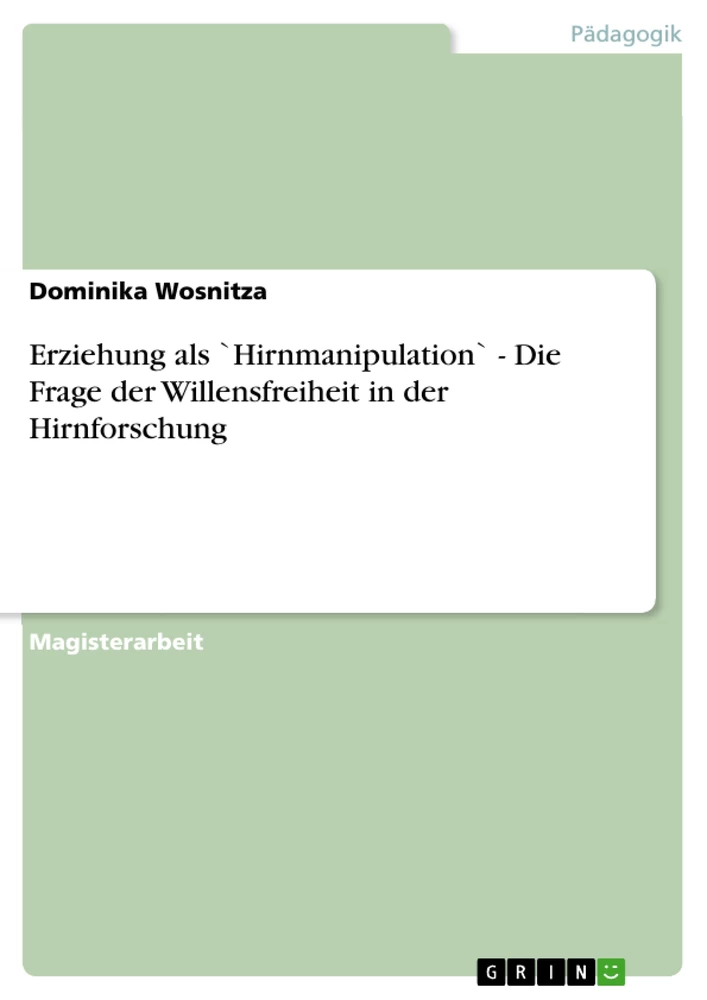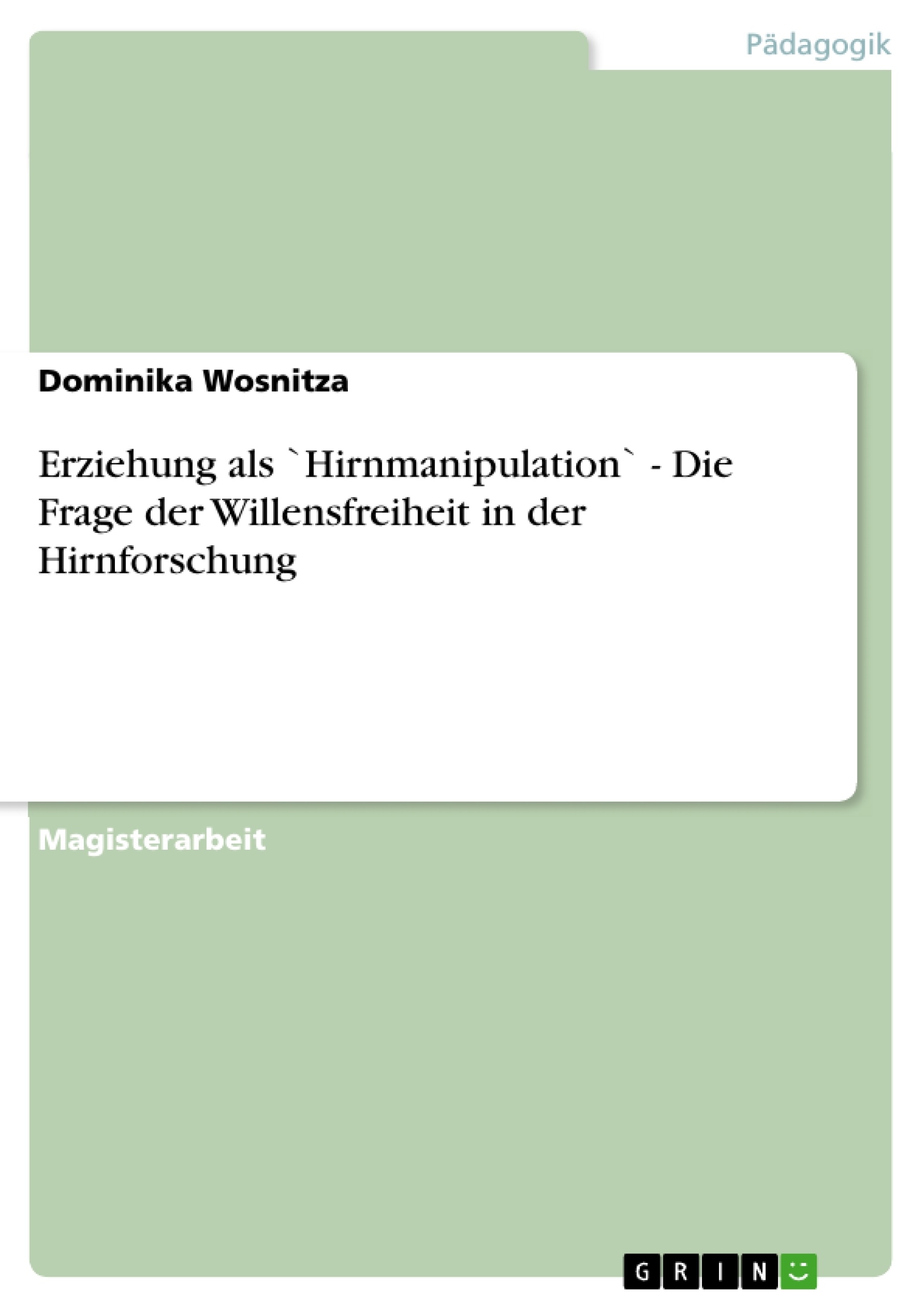Da die Hirnforscher, allen voran Gerhard Roth und Wolf Singer, sich, schon seit den 1990er Jahren, nicht mehr nur zu ihre Disziplin betreffenden Themen äußern, mehren sich die Stimmen der Kritiker, die versuchen die Grenzziehung zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften wiederherzustellen, um höchst gefährliche Übergriffe der Neuro-Wissenschaften auf Philosophie und Pädagogik abzuwehren. Die Hirnforscher schließen aus ihren physiologischen und biologischen Erkenntnissen auf psychische Phänomene und versuchen, eine Zukunft zu prognostizieren, in der alle Probleme und psychischen Effekte mit den Methoden der Hirndiagnostik und letztendlich auch –manipulation lösbar erscheinen. In dieser Zukunft hätte das klassische Menschenbild, den Menschen als ein Wesen mit freiem Willen und freiem Geist zu begreifen, keinen Platz mehr, denn das Gehirn bestimmt das Denken und nicht mehr der Mensch. Dieser Ansatz hätte, hätten die Hirnforscher Recht, weit reichende Konsequenzen für das gesamte gesellschaftliche Zusammenleben und, wie die Hirnforscher fordern, auch für die Rechtsprechung. Das Ich-Empfinden, wie wir es kennen, müsste komplett neu gedacht werden, freier Wille und damit Verantwortung für das eigene Tun wären nicht mehr existent. Unsere Selbstempfindung sagt uns allerdings etwas Anderes. Niemand möchte sich ernsthaft damit abfinden, dass anstatt des in der Zeit der Aufklärung überwundenen göttlichen Determinismus nun ein biologischer auf den Plan tritt. Was früher schicksalhafte Fügung hieß soll nun an schlechtem Genmaterial liegen? Wo die Naturwissenschaft im Bereich der Hirnforschung rasante Fortschritte macht, treibt deren Interpretation die Geisteswissenschaft in eine Kehrtwende rückwärts in eine Zeit, als Menschen noch an ein unabänderliches Schicksal glaubten. Dieses Problem zu diskutieren, soll Ziel dieser Arbeit sein. Angefangen mit einem Überblick, einer Darstellung des klassischen Menschenbilds, bestimmend von Kant formuliert, über eine Sammlung von kritischen Stimmen gegen die philosophischen Ausflüge der Hirnforscher bis hin zu Utopien, die die Hirnforscher verfolgen, wird versucht dieses hoch aktuelle Thema von verschiedensten Seiten zu beleuchten. Ist der Mensch noch frei? – Bestimmt unser Gehirn unseren Charakter? – Sind wir für unser Handeln verantwortlich? – Wie weit kann man mit solchen Thesen überhaupt gehen und was wissen die Neuro-Forscher überhaupt wirklich über unser Gehirn?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mensch und sein Gehirn – Menschenbilder im Spiegel theoretischer Interpretationen wissenschaftlicher Ergebnisse
- Der Geist gestaltet die Natur – Zum traditionellen Menschenbild Kants in der Grundlegung
- Zu den Bedingungen menschlicher Erkenntnis – Kants kritische ... Scheidung von Empirie und Theorie
- Die Bestimmung des Menschen als moralisches Wesen
- Zu den Grenzen und Möglichkeiten menschlicher Freiheit
- Der Geist erwächst aus der Materialität des Gehirns - Zum reduktionistischen Menschenbild der Hirnforscher Gerhard Roth und Wolf Singer
- Wir sind nicht mehr als ein Stück Natur – Die Bedingungen menschlicher Erkenntnis sind festgelegt durch seine Hirnarchitektur
- Der Versuch des Gehirns, sich selber durch den Einsatz seiner kognitiven Werkzeuge zu begreifen – Zum wissenschaftstheoretischen Verwirrspiel
- Der Mensch ist nicht frei
- Determinismus und Macht
- Die Leugnung der Zwiespältigkeit des Menschen durch einen ..reduktionistischen Monismus
- Zur Möglichkeit und Wirklichkeit menschlicher Freiheit - Vom Unbehagen, .sich selbst zu verantworten
- Trost und Sicherheit durch die Selbstdeutung als vorbestimmte Existenz
- Ausblicke
- Schuld und Willensfreiheit - Wer übernimmt die Verantwortung?
- Kein freier Wille – kein persönliches Verschulden: Hirnforscher fordern eine Änderung des Strafrechts
- Eine >>humanere« Umgangsweise mit Straftätern – Zum Erziehungs- und Gesellschaftsprogramm der Hirnforschung
- Zur vermeintlichen Rolle der Willensfreiheit im Schuldstrafrecht
- Folgen für die Pädagogik – Erziehung als Hirnmanipulation?
- Fazit - Mit dem Entzug leben?
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage der Willensfreiheit im Kontext der Hirnforschung. Sie analysiert die Auswirkungen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse auf das traditionelle Menschenbild und die damit verbundenen ethischen und gesellschaftlichen Implikationen. Die Arbeit untersucht, inwiefern die Hirnforschung die Vorstellung von einem freien Willen in Frage stellt und welche Konsequenzen dies für die Bereiche Recht, Pädagogik und das Selbstverständnis des Menschen haben könnte.
- Das Verhältnis von Geist und Körper im Lichte der Hirnforschung
- Die philosophischen und wissenschaftstheoretischen Implikationen der Hirnforschung
- Die Frage nach der Willensfreiheit und deren Bedeutung für die moralische Verantwortung
- Die Auswirkungen der Hirnforschung auf das Strafrecht und die Pädagogik
- Die ethischen Herausforderungen der Hirnforschung und die Zukunft des Menschenbildes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Willensfreiheit im Kontext der Hirnforschung ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Kontroverse zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften und die weitreichenden Konsequenzen, die sich aus der Annahme eines deterministischen Gehirns ergeben könnten.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Menschenbild im Spiegel theoretischer Interpretationen wissenschaftlicher Ergebnisse. Es analysiert das traditionelle Menschenbild Kants, das den Menschen als ein Wesen mit freiem Willen und freiem Geist begreift, und setzt es in Kontrast zum reduktionistischen Menschenbild der Hirnforscher Gerhard Roth und Wolf Singer. Letztere argumentieren, dass das Gehirn das Denken bestimmt und der Mensch somit nicht frei ist.
Das dritte Kapitel untersucht die philosophischen und ethischen Implikationen des Determinismus. Es analysiert die Leugnung der Zwiespältigkeit des Menschen durch einen reduktionistischen Monismus und die damit verbundenen Folgen für die moralische Verantwortung. Weiterhin wird die Frage nach der Möglichkeit und Wirklichkeit menschlicher Freiheit im Kontext des Unbehagen, sich selbst zu verantworten, beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der Hirnforschung auf das Strafrecht und die Pädagogik. Es analysiert die Forderung der Hirnforscher nach einer Änderung des Strafrechts, da ein freier Wille nicht mehr als Grundlage für Schuld und Strafe gelten könne. Weiterhin werden die Folgen für die Pädagogik und die Frage nach einer möglichen „Hirnmanipulation“ diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Willensfreiheit, die Hirnforschung, das Menschenbild, Determinismus, Moral, Verantwortung, Strafrecht, Pädagogik und die ethischen Implikationen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse. Die Arbeit beleuchtet die Kontroverse zwischen den Natur- und Geisteswissenschaften und die Frage, inwiefern die Hirnforschung die Vorstellung von einem freien Willen in Frage stellt. Sie analysiert die Auswirkungen der neurowissenschaftlichen Erkenntnisse auf das Selbstverständnis des Menschen und die damit verbundenen ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Stellt die Hirnforschung den freien Willen infrage?
Ja, Forscher wie Gerhard Roth und Wolf Singer argumentieren, dass neuronale Prozesse unsere Handlungen determinieren, bevor wir uns bewusst dafür entscheiden.
Welches Menschenbild vertrat Immanuel Kant?
Kant sah den Menschen als moralisches Wesen mit freiem Geist und Willen, der für sein Handeln selbst verantwortlich ist.
Welche Folgen hat der neuronale Determinismus für das Strafrecht?
Wenn kein freier Wille existiert, entfällt die Grundlage für persönliche Schuld. Hirnforscher fordern daher oft ein präventionsorientiertes statt eines schuldorientierten Strafrechts.
Was bedeutet der Begriff "Erziehung als Hirnmanipulation"?
In diesem Kontext wird diskutiert, ob pädagogische Maßnahmen lediglich biologische Umstrukturierungen im Gehirn sind und inwieweit dies ethisch vertretbar ist.
Was ist reduktionistischer Monismus?
Es ist die Sichtweise, dass alle geistigen Phänomene ausschließlich auf materielle, biologische Vorgänge im Gehirn reduziert werden können.
Sind wir laut Neuro-Wissenschaft für unser Handeln verantwortlich?
Die radikale Hirnforschung verneint die klassische Verantwortung, da das "Ich" nur ein Konstrukt des Gehirns sei, welches wiederum physikalischen Gesetzen folgt.
- Quote paper
- Dominika Wosnitza (Author), 2007, Erziehung als `Hirnmanipulation` - Die Frage der Willensfreiheit in der Hirnforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/113914