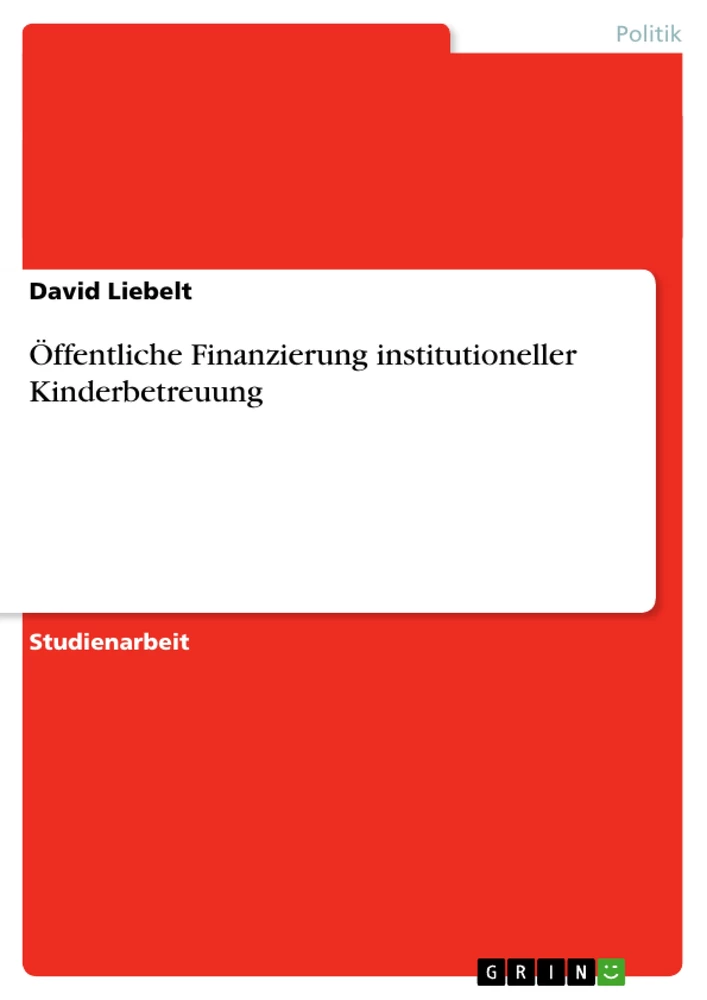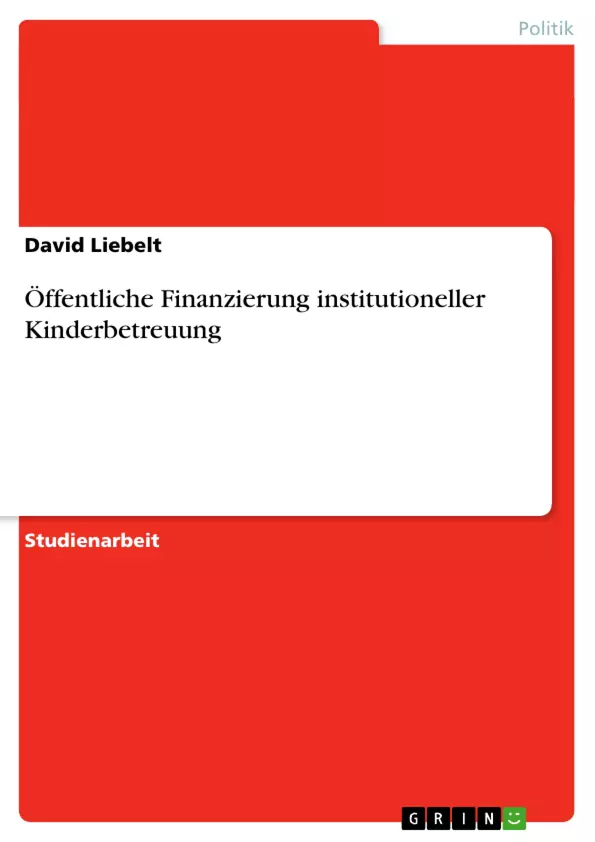Aufgrund der zunehmenden Beteiligung von Frauen an der industriell geprägten Erwerbstätigkeit und der damit verbundenen Trennung von Arbeits- und Lebensbereich, ergab sich im Zuge der industriellen Revolution die Notwendigkeit, zur Betreuung von Kindern während der Abwesenheit der Eltern. Erste Einrichtungen zur Betreuung der Kinder„wurden durch den sozialen und finanziellen Einsatz engagierter Bürger getragen, die bestrebt waren, dem „moralischen Verfall“ der unbeaufsichtigten Kinder entgegenzutreten.“ Im Vordergrund stand dabei zunächst nur die Aufbewahrung der Kinder während der Arbeitszeit der Eltern; weitergehende Erziehungsziele waren damit nicht verbunden.
Erst in den 60er Jahren wurde der Kindergarten als Regelinstitution anerkannt, die durch frühe vorschulische Erziehung und Bildung die Chancengleichheit der Kinder im Zuge der deutschen Bildungsreform unterstützen sollte. In Westdeutschland war der Kindergarten als „Sozialisationsinstitution“ zunächst vorwiegend auf die halbtägige Kinderbetreuung ausgerichtet. Dies korrespondierte mit der seinerzeit noch verbreiteten Einstellung, dass sich die Erwerbstätigkeit von Frauen allenfalls auf einen Hinzuverdienst beschränken solle, der Schwerpunkt für Frauen aber nicht in der Berufswelt liege, sonder in der Familienführung. Demgegenüber war in der DDR ––dem Ideal der gleichberechtigten Tätigkeiten von Männern und Frauen folgend, schon frühzeitig eine ganztägige Betreuung von Kindern aller Alterklassen üblich. Mittlerweile ist es weitgehend gesellschaftlicher Konsens, dass eine geschlechtsspezifische Trennung von Beruf und Kinderbetreuung nicht mehr zeitgemäß ist Mit der Neuregelung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes vom 01.01.1996 wurde jedem Kind im Vorschulalter ein „Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz“ im Kinder- und Jugendhilfegesetz gewährt. Mittlerweile gibt es in Westdeutschland ein fast flächendeckendes Halbtagsbetreuungsangebot Die ganztägige Betreuung inklusive Mittagessen - eine wesentliche Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für beide Elternteile - wird zwar als Ideal postuliert, ist aber noch immer die Ausnahme. Ein wesentlicher Grund für die geringe Verbreitung von ganztätigen Betreuungsangeboten liegt unter anderem in der strittigen Finanzierungsfrage.
Im Folgenden wird die öffentliche Finanzierung institutioneller Kinderbetreuung erläutert...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Öffentliche Finanzierung institutioneller Kinderbetreuung
- Gründe öffentlicher Finanzierung
- Die Finanzierung der institutionellen Kinderbetreuung
- Problematik der gegebenen Finanzierung
- Das Gutscheinsystem als Reformansatz im Bereich der Kindertagesstätten
- Ziele des Gutscheinsystems
- Voraussetzungen zur Zielerreichung
- Finanzierungsmöglichkeiten des Gutscheinmodells
- Bewertung und Fazit
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der öffentlichen Finanzierung institutioneller Kinderbetreuung in Deutschland. Sie analysiert die Gründe für die öffentliche Finanzierung, beleuchtet die aktuelle Finanzierungsstruktur und ihre Problematik und stellt das Gutscheinsystem als möglichen Reformansatz vor.
- Gründe für die öffentliche Finanzierung von Kinderbetreuung
- Die Finanzierung der institutionellen Kinderbetreuung in Deutschland
- Problematik der aktuellen Finanzierungsstruktur
- Das Gutscheinsystem als Reformansatz
- Bewertung und Fazit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische Entwicklung der institutionellen Kinderbetreuung in Deutschland dar und führt in die Thematik der öffentlichen Finanzierung ein. Das zweite Kapitel beleuchtet die Gründe für die öffentliche Finanzierung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Es werden die Ziele der Startchancengleichheit, der Chancengleichheit und Erwerbsförderung von Frauen sowie die Unterstützung der Humankapitalallokation erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich der Problematik der aktuellen Finanzierungsstruktur und zeigt die Herausforderungen auf, die mit der Finanzierung von Kindertagesstätten verbunden sind. Das vierte Kapitel stellt das Gutscheinsystem als möglichen Reformansatz im Bereich der Kindertagesstätten vor. Es werden die Ziele, Voraussetzungen und Finanzierungsmöglichkeiten des Gutscheinmodells diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die öffentliche Finanzierung, institutionelle Kinderbetreuung, Kindertagesstätten, Gutscheinsystem, Startchancengleichheit, Chancengleichheit, Erwerbsförderung von Frauen, Humankapitalallokation, Reformansatz, Finanzierungsstruktur, Problematik, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Warum finanziert der Staat institutionelle Kinderbetreuung?
Gründe sind die Förderung der Startchancengleichheit, die Erwerbsförderung von Frauen und die Unterstützung der Humankapitalallokation.
Was ist das Gutscheinsystem in der Kinderbetreuung?
Es ist ein Reformansatz, bei dem Eltern Gutscheine erhalten, die sie bei einer Einrichtung ihrer Wahl einlösen können, um den Wettbewerb und die Qualität zu fördern.
Seit wann gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz?
Mit der Neuregelung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes vom 01.01.1996 wurde dieser Anspruch im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert.
Wie unterschied sich die Kinderbetreuung in der DDR und Westdeutschland?
In der DDR war eine ganztägige Betreuung zur Förderung der Gleichberechtigung früh üblich, während in Westdeutschland lange das Halbtagsmodell dominierte.
Was ist das Hauptproblem der aktuellen Finanzierung?
Ein wesentlicher Grund für den Mangel an Ganztagsplätzen liegt in der strittigen und oft unzureichenden Finanzierungsstruktur zwischen Bund, Ländern und Kommunen.
- Quote paper
- David Liebelt (Author), 2007, Öffentliche Finanzierung institutioneller Kinderbetreuung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114180