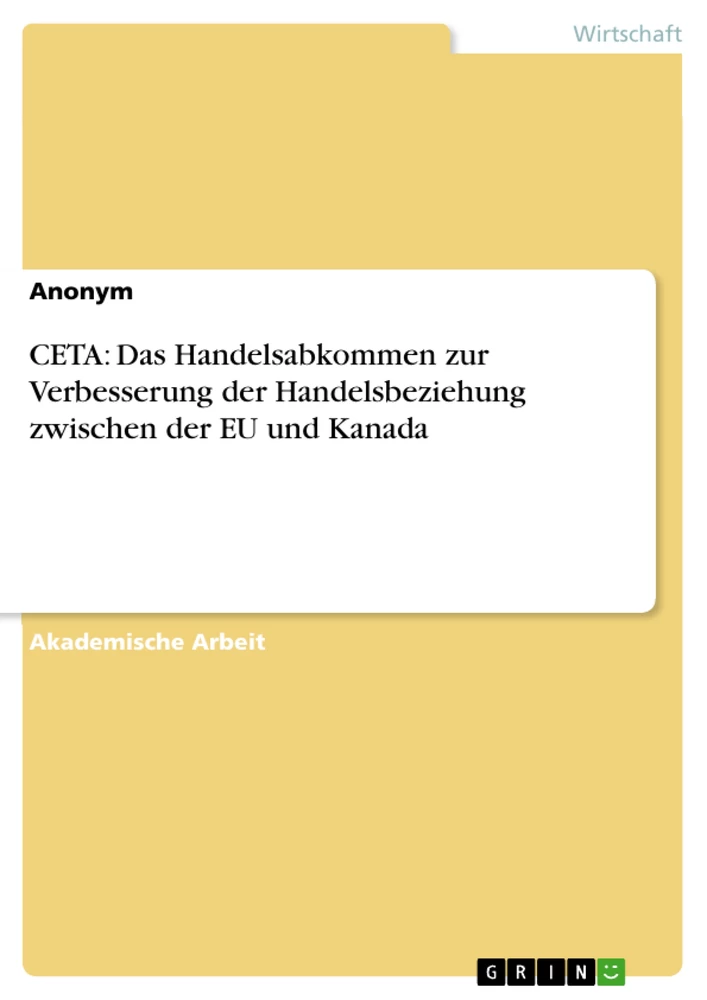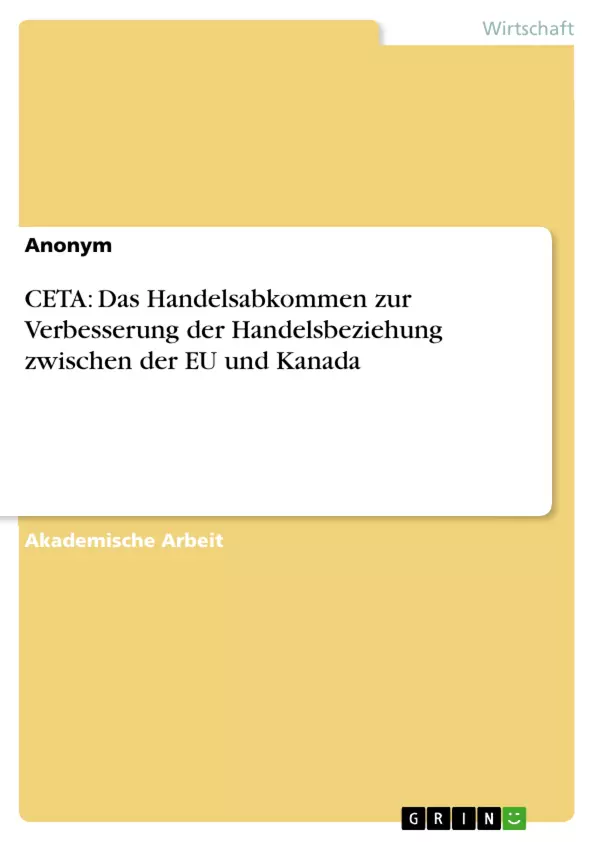Die folgende Arbeit soll sowohl die Chancen als auch die Risiken des CETA („comprehensive economic and trade agreement“) im Speziellen, aber auch Freihandelsabkommen im Allgemeinen näher untersuchen. Das Ziel ist es die Ergebnisse der Abwägung als Indiz dafür zu nehmen, ob die EU weiterhin dem Streben nach beispielsweise zollfreien Ein- und Ausfuhren von Waren nachgeben und im Zuge dessen Freihandelsabkommen beschließen sollte oder ob die Risiken überwiegen. In einem solchen Fall sollten in Zukunft Wirtschafts- und Handelsabkommen modifiziert oder grundsätzlich nicht beschlossen werden. Die folgende wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich daher mit der Leitfrage, ob, und wenn ja, inwiefern das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada Risiken birgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Aufbau und Vorgehensweise
- Grundlagen
- Begriffserklärung Handelsbeziehung
- Begriffserklärung Freihandelsabkommen
- Handelsbeziehung zwischen der EU und Kanada
- Inhaltliche Konzeption
- Eingeleitete Maßnahmen
- Stand der Umsetzung
- Kritik und Problematiken
- Investitionsschiedsgerichtsverfahren
- Umweltaspekte
- Fehlende nationale Ratifizierung
- Vergleich mit anderen Handelsabkommen
- Vergleich mit TTIP
- Vergleich mit JEFTA
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Chancen und Risiken des Freihandelsabkommens CETA zwischen der EU und Kanada. Das Ziel ist es, die Auswirkungen des Abkommens auf die Wirtschaft und die Gesellschaft zu untersuchen und daraus Schlussfolgerungen für die zukünftige Politik der EU in Bezug auf Freihandelsabkommen zu ziehen.
- Die Bedeutung von Freihandelsabkommen in der Globalisierung
- Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen von Freihandelsabkommen
- Die Rolle der EU in der Gestaltung von Freihandelsabkommen
- Die Herausforderungen und Chancen von Freihandelsabkommen
- Die Kritikpunkte und Risiken des CETA-Abkommens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung legt den Fokus auf die Relevanz von Handelsabkommen in der globalisierten Welt und stellt die Problemstellung des CETA-Abkommens dar. Die Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit werden ebenfalls erläutert.
- Grundlagen: Dieses Kapitel erklärt die Begriffe Handelsbeziehung und Freihandelsabkommen und beleuchtet die Handelsbeziehung zwischen der EU und Kanada.
- Inhaltliche Konzeption: Dieses Kapitel beschreibt die wichtigsten Inhalte des CETA-Abkommens und den aktuellen Stand der Umsetzung.
- Kritik und Problematiken: Dieses Kapitel beleuchtet die Kritikpunkte und Risiken des CETA-Abkommens, zum Beispiel in Bezug auf Investitionsschutz, Umweltaspekte und fehlende nationale Ratifizierung.
- Vergleich mit anderen Handelsabkommen: In diesem Kapitel wird das CETA-Abkommen mit anderen Freihandelsabkommen wie TTIP und JEFTA verglichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen dieser Arbeit sind: Freihandelsabkommen, CETA, EU, Kanada, Wirtschaftsbeziehungen, Globalisierung, Handel, Investitionsschutz, Umweltaspekte, Ratifizierung, TTIP, JEFTA.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet die Abkürzung CETA?
CETA steht für „Comprehensive Economic and Trade Agreement“, ein umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada.
Welche Hauptkritikpunkte gibt es an CETA?
Kritisiert werden insbesondere die Investitionsschiedsgerichtsverfahren, mögliche negative Auswirkungen auf Umweltstandards und die fehlende nationale Ratifizierung in einigen Staaten.
Welche Chancen bietet das Abkommen?
Es zielt auf den Abbau von Zöllen, die Erleichterung des Marktzugangs und eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU und Kanada ab.
Wie unterscheidet sich CETA von TTIP?
Die Arbeit vergleicht CETA mit anderen Abkommen wie TTIP (mit den USA) und JEFTA (mit Japan), um Besonderheiten in der Konzeption aufzuzeigen.
Was ist ein Investitionsschiedsgerichtsverfahren?
Ein Mechanismus, der es Unternehmen ermöglicht, Staaten vor speziellen Gerichten zu verklagen, wenn sie ihre Investitionen durch staatliche Maßnahmen gefährdet sehen.
Welches Fazit zieht die Arbeit bezüglich Freihandelsabkommen?
Es wird abgewogen, ob die wirtschaftlichen Vorteile die Risiken überwiegen oder ob künftige Abkommen grundlegend modifiziert werden müssen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, CETA: Das Handelsabkommen zur Verbesserung der Handelsbeziehung zwischen der EU und Kanada, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1143554