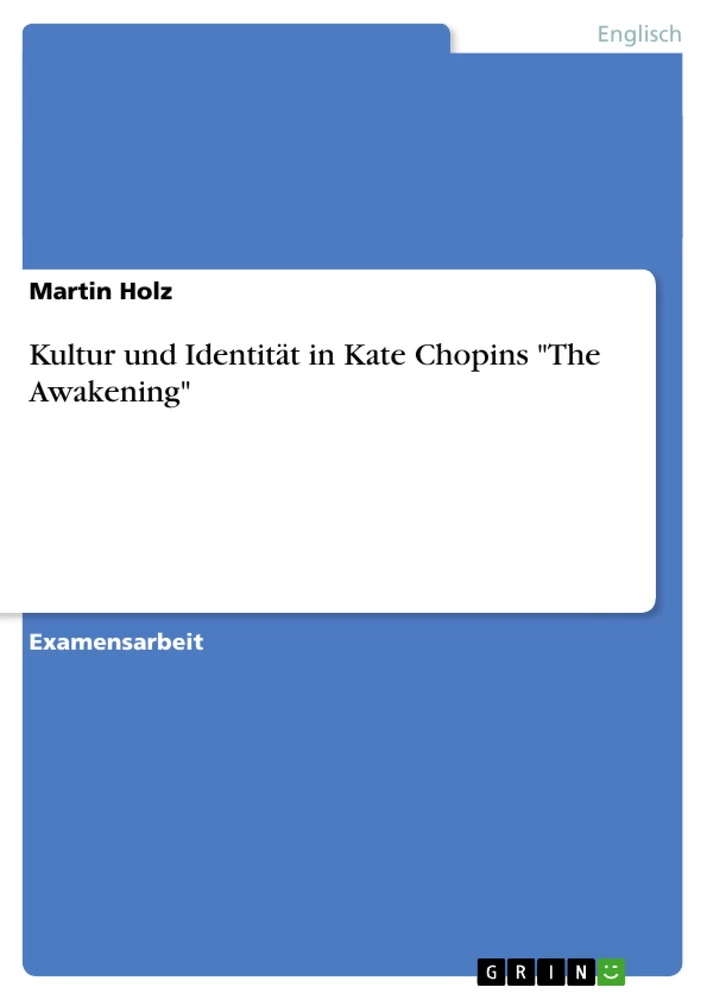Fünfzig Jahre lang, von der Publikation 1899 bis 1956, ist von The Awakening in Literaturwissenschaft, Literaturgeschichte und Literaturkritik kaum Notiz genommen worden. Eine irrationale Protagonistin, die bis in den Tod auf ihrer Identität insistiert, dabei scheinbar nicht auf die "menschliche Herde" angewiesen ist und darüber dennoch nicht hysterisch oder psychotisch wird, stand ebenso im Widerspruch zum naturalisierenden viktorianischen Diskurs über Weiblichkeit, wie die fiktionale Erkundung des Komplexes Kultur, Sexualität und Tod Illusionen zu demontieren drohte, die als gesellschaftliches Fundament fungierten und bis heute fungieren. Dass diese konterdiskursive Infragestellung kulturerhaltender Ordnungsphantasmen zu einer massiven Verdrängung des Textes - nicht zuletzt unter dem Signum der Kulturversagung - geführt hat, überrascht kaum. Der Tenor zeitgenössischer Rezensionen bezeugt eine signifikante Ablehnung:"[...] it leaves one sick of human nature" (Awakening: 163), "its disagreeable glimpses of sensuality are repellent" (Awakening: 166), "gilded dirt" (Awakening: 167), "an essentially vulgar story" (Awakening: 168), "unhealthily introspective and morbid in feeling" (Awakening: 170), "unwholesome in its influence" (Awakening: 172).
Es handelt sich dabei um viel mehr als nur um "vestiges of Victorian prudery" (Walker 1993: 141). Eine derart vehemente, mehr moralisch als ästhetisch begründete Ablehnung lässt vermuten, dass der Roman an neuralgische Punkte der Kultur wie auch der menschlichen Identität rührt. Es geht um Fragen, die nicht gestellt werden dürfen. Dass Nietzsche und Freud sich mit ähnlichen Reaktionen konfrontiert sahen, ist ebenso wenig ein Zufall wie die Tatsache, dass ihre Gedanken sehr produktiv für die Interpretation des Textes genutzt werden können. Welche diskursiven Praktiken im Blick auf Kanonbildung und Zensur wurden aktiviert, um das subversive énoncé des Textes zu verdrängen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der verdrängte Text
- 1.1 Kanon als Ausschlussdiskurs
- 1.2 Theoretische Kontexte
- 2. Die frankoamerikanische Kultur der Kreolen
- 2.1 Moral, Ästhetik und Illusion
- 2.2 Liebessemantik vs. Ehecode
- 2.3 Die Ökonomisierung der Intimsphäre
- 2.4 Semantisierte Räume
- 2.5 Das kulturelle Andere: black women
- 3. Auf der Suche nach weiblicher Identität
- 3.1 Feminismus, gender und Emanzipation
- 3.2 Die Macht der omnipräsenten Sprache
- 3.3 Psychische und semiotische Funktionen des Körpers
- 3.4 Eros, Thanatos und Regression
- 3.5 Lustprinzip, ozeanisches Gefühl und Tod
- 4. Das kulturelle Projekt des Romans
- 4.1 Genre als soziokulturelles Konstrukt
- 4.2 Symbolische Exploration und Transgression
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert Kate Chopins Roman "The Awakening" im Kontext der frankoamerikanischen Kultur des späten 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, die kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen zu untersuchen, die Ednas Suche nach weiblicher Identität prägen und ihre Rebellion gegen die konventionellen Normen der Zeit erklären. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Sprache, Körper und Sexualität in der Konstruktion von Identität und die Auswirkungen von gesellschaftlichen Tabus auf die weibliche Selbstfindung.
- Die Konstruktion von weiblicher Identität im Kontext der frankoamerikanischen Kultur
- Die Rolle von Sprache und Körper in der Konstruktion von Identität
- Die Bedeutung von Sexualität und Tod in der Suche nach Selbstfindung
- Die Kritik an gesellschaftlichen Normen und Tabus
- Die literarische und kulturelle Relevanz von "The Awakening"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Verdrängung von "The Awakening" in der Literaturgeschichte und analysiert die diskursiven Praktiken, die zur Marginalisierung des Romans führten. Es werden die Mechanismen von Kanonbildung und Zensur untersucht, die Chopins Text als subversiv und unmoralisch brandmarkten. Das zweite Kapitel widmet sich der frankoamerikanischen Kultur der Kreolen, in der Edna Pontellier aufwächst. Es werden die moralischen und ästhetischen Normen der Zeit, die Liebessemantik und der Ehecode sowie die Ökonomisierung der Intimsphäre analysiert. Das dritte Kapitel befasst sich mit Ednas Suche nach weiblicher Identität. Es werden die Themen Feminismus, gender und Emanzipation, die Macht der Sprache, die psychischen und semiotischen Funktionen des Körpers sowie die Rolle von Eros, Thanatos und Regression untersucht. Das vierte Kapitel analysiert "The Awakening" als kulturelles Projekt, das die Grenzen von Genre und die symbolische Exploration von Sexualität und Tod thematisiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen "The Awakening", Kate Chopin, frankoamerikanische Kultur, weibliche Identität, Feminismus, Sprache, Körper, Sexualität, Tod, Kanonbildung, Zensur, Literaturgeschichte, Kulturkritik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde "The Awakening" nach seinem Erscheinen 1899 so stark abgelehnt?
Der Roman brach mit viktorianischen Tabus über Weiblichkeit, Sexualität und die Rolle der Mutter, was von zeitgenössischen Kritikern als "unmoralisch" und "krankhaft" empfunden wurde.
Welche Rolle spielt die kreolische Kultur in Kate Chopins Roman?
Die Arbeit analysiert die frankoamerikanische Kultur der Kreolen, deren Moralvorstellungen, Liebessemantik und den strikten Ehecode, gegen den die Protagonistin Edna rebelliert.
Was symbolisiert das Meer in "The Awakening"?
Es steht für das "ozeanische Gefühl", das Lustprinzip sowie die letztliche Regression und den Tod (Thanatos) als Teil von Ednas Suche nach Freiheit.
Wie wird Ednas Suche nach Identität in der Arbeit gedeutet?
Als subversiver Prozess, der die Macht der Sprache, die Funktionen des Körpers und die ökonomischen Zwänge der Intimsphäre im späten 19. Jahrhundert hinterfragt.
Welche Theoretiker werden für die Interpretation genutzt?
Die Arbeit nutzt produktiv die Gedanken von Nietzsche und Freud, um die psychischen Tiefenstrukturen und die kulturelle Zensur des Textes zu beleuchten.
- Quote paper
- Dr. Martin Holz (Author), 2001, Kultur und Identität in Kate Chopins "The Awakening", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114378