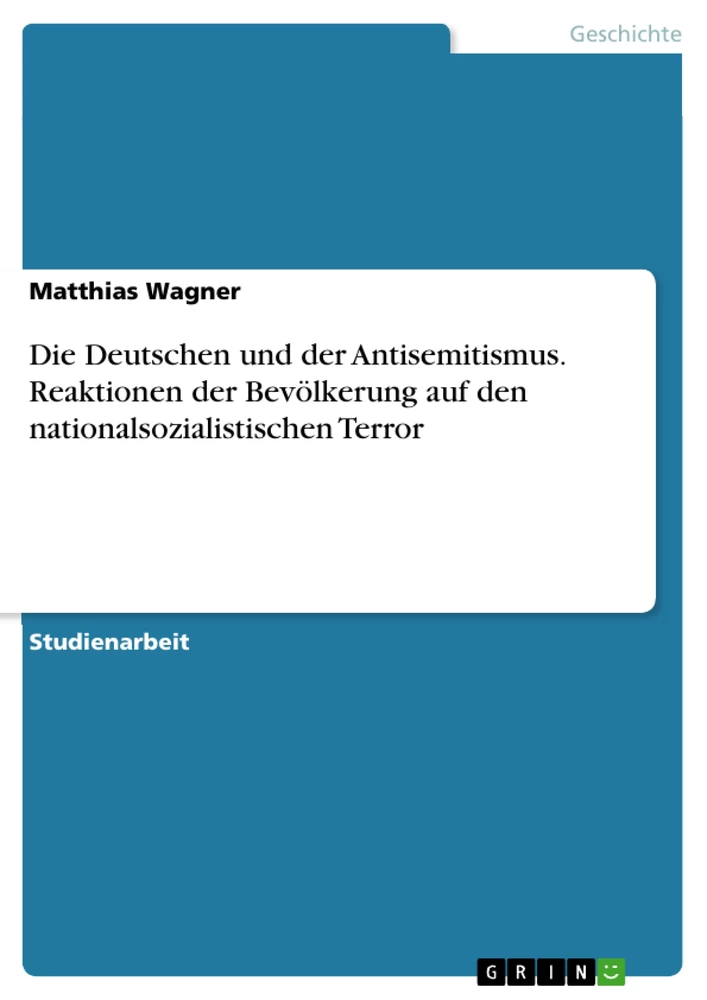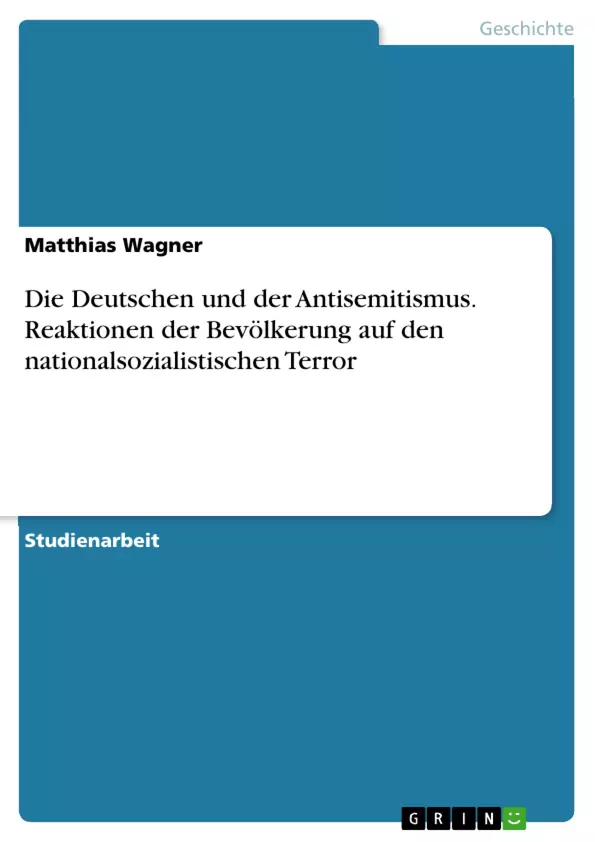Wie reagierten die Deutschen auf antisemitische Erlasse? Gab es öffentliche Gegenreaktionen? Teilte die Bevölkerung den Antisemitismus des NS?
Der Antisemitismus und das Konzept der völkischen Blut- und Bodenpolitik bildete die Grundlage der nationalsozialistischen Politik. Dies wird in den frühen Parteiprogrammen der 20er, als auch in den späteren Wahlkämpfen und Reden von NS-Funktionären deutlich. Hitler selbst hat sich dabei als Sprecher des Volkes stilisiert, dass er lediglich ausführe, was das deutsche Volk wünsche, dass der ideologische Antisemitismus der NSDAP auf den antisemitischen Wünschen der Bevölkerung basiere. Im Gegensatz dazu behauptete nach dem Krieg die überwiegende Mehrheit der Deutschen, man habe von den Verbrechen an den Juden nichts gewusst, bzw. man habe selbst Juden geschützt und hätte ohnehin nichts tun können. Die Schuld trage die NS-Führung.
Beide konträre Positionen wurden teils von Historikern einbezogen. Entweder wurde die Rolle der NS-Führung betont, die die Vernichtung der Juden fanatisch und im Geheimen vor der Bevölkerung verborgen durchgeführt hätten, ohne Beteiligung der Bevölkerung. Oder es wurde versucht zu zeigen, dass die NS-Ideologie von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung geteilt wurde und die Shoah nicht nur das Werk einer kleinen Clique, sondern der gesamten deutschen Bevölkerung sei. Um diese Einschätzungen einordnen zu können und differenziert zu betrachten, erachte ich es für notwendig, die Stimmung in der deutschen Bevölkerung hinsichtlich antisemitischer Politik zu erfassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellenlage
- Die Jahre 1933-1938
- Boykott vom 1.April 1933 und das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
- Nürnberger Gesetze
- Novemberpogrome 1938
- Die Jahre ab 1938
- Ghettoisierung
- Kennzeichnungspflicht
- Deportation
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Reaktionen der deutschen Bevölkerung auf den nationalsozialistischen Terror und den Antisemitismus, der die Grundlage der NS-Politik bildete. Sie untersucht, wie die Bevölkerung auf antisemitische Erlasse reagierte, ob es öffentliche Gegenreaktionen gab und inwieweit die Bevölkerung den Antisemitismus des NS teilte.
- Die Rolle der Bevölkerung beim Antisemitismus in Deutschland
- Die Auswirkungen von antisemitischen Maßnahmen auf die deutsche Gesellschaft
- Die Interpretation von Quellen, wie SD-Berichten, um die Stimmung der Bevölkerung zu analysieren
- Die Entwicklung des Antisemitismus im Verlauf des NS-Regimes
- Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Perspektiven auf die deutsche Bevölkerung im NS-Staat
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Rolle der Bevölkerung beim Antisemitismus im NS-Staat. Sie skizziert die Kontroverse, ob die NS-Führung die antisemitische Politik ohne Beteiligung der Bevölkerung umsetzte, oder ob die deutsche Gesellschaft den Antisemitismus teilte.
- Quellenlage: Dieses Kapitel analysiert die verwendeten Quellen, insbesondere die geheimen Berichte des Sicherheitsdienstes (SD) der SS, die Einblicke in die Stimmung der Bevölkerung geben sollen. Der Text beleuchtet aber auch die Einschränkungen der SD-Berichte, da sie nicht als repräsentative Umfragen betrachtet werden können und die NS-Ideologie im Hintergrund der Berichterstattung mitgedacht werden muss.
- Die Jahre 1933-1938: Dieser Abschnitt widmet sich den frühen Jahren des NS-Regimes. Er untersucht den Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 und das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das die Entfernung von Juden aus dem Staatsdienst regelte. Darüber hinaus beleuchtet er die „wilden“ Ausschreitungen und Übergriffe auf Juden, die die Parteiführung zwar einzudämmen versuchte, aber dennoch ein Maß für die gesellschaftliche Stimmung lieferten.
- Die Jahre ab 1938: Dieser Abschnitt betrachtet die Entwicklung des Antisemitismus nach dem Novemberpogrom 1938 und die zunehmende systematische Verfolgung der Juden. Er beleuchtet Themen wie Ghettoisierung, Kennzeichnungspflicht und Deportation.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind Antisemitismus, nationalsozialistische Terror, deutsche Bevölkerung, NS-Ideologie, SD-Berichte, Stimmungslage, Reaktionen, öffentliche Meinung, Ghettoisierung, Kennzeichnungspflicht, Deportation, Sopade-Berichte, Göbbels, Himmler, Heydrich.
Häufig gestellte Fragen
Wie reagierte die deutsche Bevölkerung auf die antisemitische Politik der Nazis?
Die Arbeit untersucht, ob die Bevölkerung den Antisemitismus teilte oder ob es öffentliche Gegenreaktionen gab, und beleuchtet die Diskrepanz zwischen NS-Propaganda und tatsächlicher Stimmung.
Welche Quellen werden zur Analyse der Volksstimmung genutzt?
Zentrale Quellen sind die geheimen Berichte des Sicherheitsdienstes (SD) der SS sowie Sopade-Berichte, die Einblicke in die tatsächliche Meinung der Bevölkerung geben sollten.
Was geschah während der Novemberpogrome 1938?
Die Arbeit analysiert die Reaktionen auf die Pogrome von 1938 und wie sich die systematische Verfolgung der Juden danach verschärfte.
Wusste die Mehrheit der Deutschen von den Verbrechen?
Die Arbeit setzt sich kritisch mit der Nachkriegsbehauptung auseinander, man habe von nichts gewusst, und untersucht die tatsächliche Beteiligung und Wahrnehmung der Shoah durch die Bevölkerung.
Welche Rolle spielten NS-Funktionäre wie Goebbels und Himmler?
Es wird untersucht, wie die Führung den Antisemitismus als völkische „Blut- und Bodenpolitik“ instrumentalisierte und sich dabei fälschlicherweise als Sprecher des Volkswillens stilisierte.
- Citar trabajo
- Matthias Wagner (Autor), 2021, Die Deutschen und der Antisemitismus. Reaktionen der Bevölkerung auf den nationalsozialistischen Terror, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1144222