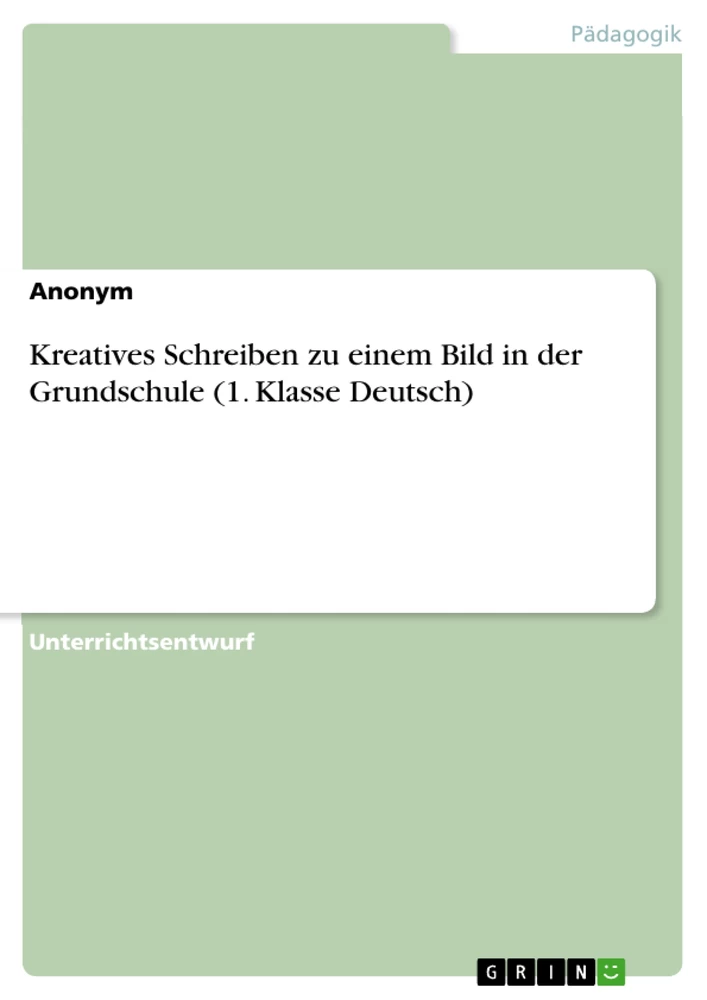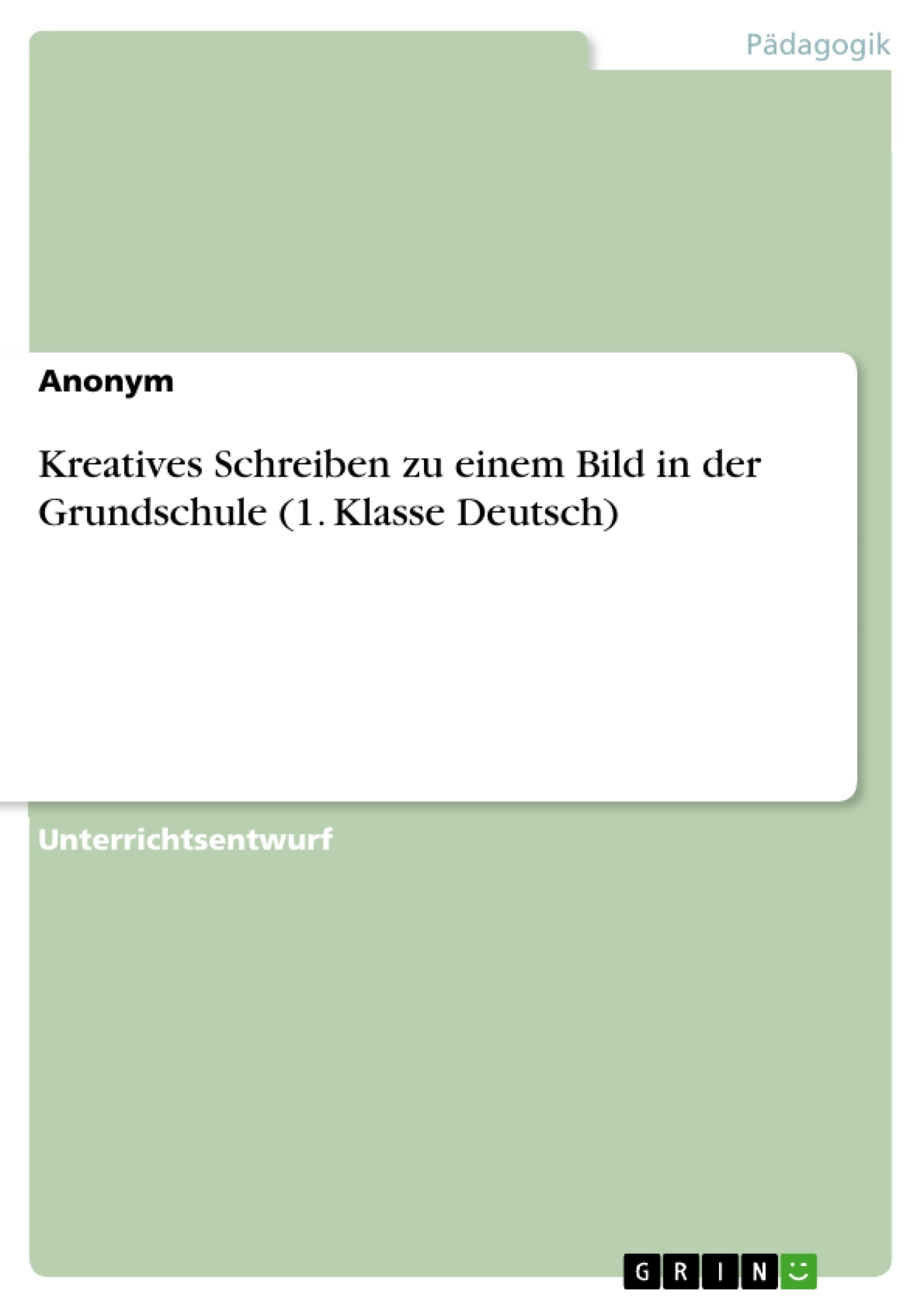Der Inhalt der beschriebenen Stunde findet sich im Bildungsplan unter anderem bei der Kompetenz Sprechen wieder. Dort heißt es, dass die Schülerinnen und Schüler "verständlich sprechen und anderen verstehend zuhören" können. Das Verfassen der eigenen Texte durch das kreative Schreiben ist der Kompetenz Schreiben – Texte schreiben zuzuordnen. Die Schülerinnen und Schüler können einerseits "eigene Schreibideen entwickeln" und andererseits "selbstständig zu vorgegebenen Schreibanlässen kurze Texte schreiben". Die Kompetenz Lesen/Umgang mit Texten und Medien wird ebenfalls angesprochen, wenn die Kinder "Texte anderen laut vorlesen".
In der beschriebenen Stunde soll folgendes Grobziel erreicht werden: Die Kinder sollen anhand eines Schreibanlasses in Form eines Bildes eine individuelle Schreibidee entwickeln, diese schriftlich umsetzen und anderen Kindern vorlesen.
Unter diesem Grobziel lassen sich noch weitere Teilziele fördern: Die Kinder können in Gruppenarbeit eigene Ideen zu einem Schreibimpuls entwickeln und auf einem Plakat formulieren. Die Kinder können Wörter/Fragestellungen als Anregungen für den individuellen Schreibprozess nutzen. Die Kinder können ihre Geschichten verständlich präsentieren, indem sie diese der Klasse vorlesen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Ausgangslage des Unterrichts
- 1.1. Institutionelle Bedingungen
- 1.2. Anthropologische Bedingungen
- 1.2.1. Reflexion der Lerngruppe
- 1.2.2. Sachstruktureller Entwicklungsstand
- 1.2.3. Beschreibung einzelner Kinder
- 2. Sachanalyse
- 2.1. Kreatives Schreiben
- 2.2. Bild von Erwin Moser als Schreibimpuls
- 3. Didaktische Analyse
- 4. Zu erreichende Ziele und Kompetenzen
- 4.1. Bezug zum Bildungsplan
- 4.2. Ziele
- 5. Methodische Überlegungen
- 5.1. Einstieg
- 5.2. Hinführung
- 5.3. Erarbeitungsphase
- 5.4. Arbeitsphase
- 5.5. Reflexion
- 5.6. Abschluss
- 6. Unterrichtsskizze
- 7. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschreibt die Planung und Durchführung einer Deutschstunde im ersten Schuljahr zum Thema kreatives Schreiben. Ziel ist es, die Schüler*innen an das kreative Schreiben heranzuführen und ihre Schreibmotivation zu fördern. Die Stunde basiert auf der Methode des Schreibens durch Stimuli, wobei ein Bild als Impuls dient.
- Kreatives Schreiben im Anfangsunterricht
- Förderung der Schreibmotivation
- Differenzierung im Schreibprozess
- Analyse der Lerngruppe und deren Schreibfähigkeiten
- Methodische Umsetzung des kreativen Schreibens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Ausgangslage des Unterrichts: Dieses Kapitel beschreibt die institutionellen und anthropologischen Bedingungen des Unterrichts. Die S.-Schule in Bad C. wird als zweizügige Grund-, Haupt- und Werkrealschule mit Ganztagesangebot vorgestellt, die ein großes Einzugsgebiet und eine breite Sozialschicht-Streuung aufweist. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der Lerngruppe (18 Schüler*innen), ihrem Arbeitsverhalten, ihrem Sozialverhalten und ihrem individuellen Entwicklungsstand im Bereich Schreiben. Besondere Aufmerksamkeit wird A. und M. gewidmet, zwei Kindern mit sprachlichen Schwierigkeiten, für die zusätzliche Unterstützung vorgesehen ist. Das Kapitel legt die Grundlage für die didaktische Planung der Stunde.
2. Sachanalyse: Dieses Kapitel analysiert das kreative Schreiben als Methode und den gewählten Schreibimpuls. Es definiert kreatives Schreiben, hebt dessen Prozessorientierung und die Bedeutung der Imagination hervor. Es wird der Unterschied zum traditionellen Aufsatzunterricht betont und die Wichtigkeit der individuellen Förderung im Anfangsunterricht hervorgehoben. Der gewählte Schreibimpuls, ein Bild von Erwin Moser, wird vorgestellt und als „Schreiben durch Stimuli“ Methode eingeordnet. Das Bild zeigt einen Pinguin mit Fallschirm an einem Kaktus in der Wüste, mit einem abgestürzten Flugzeug im Hintergrund – ein ungewöhnlicher und fantasieanregender Impuls für die Schüler*innen.
Schlüsselwörter
Kreatives Schreiben, Anfangsunterricht, Schreibmotivation, Schreibförderung, Differenzierung, Stimuli, Schreibprozess, Lerngruppe, Bildanalyse, Didaktische Planung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unterrichtsplanung: Kreatives Schreiben im 1. Schuljahr
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Unterrichtsplanung für eine Deutschstunde im ersten Schuljahr zum Thema kreatives Schreiben. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Planung beschreibt detailliert die Ausgangslage (institutionelle und anthropologische Bedingungen, Lerngruppe), die Sachanalyse (kreatives Schreiben als Methode, der gewählte Bild-Impuls), die didaktische Analyse, die Ziele und Kompetenzen, methodische Überlegungen und eine Unterrichtsskizze. Der Fokus liegt auf der Förderung der Schreibmotivation und der Differenzierung im Schreibprozess.
Welche Kapitel umfasst die Unterrichtsplanung?
Die Unterrichtsplanung gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Ausgangslage des Unterrichts (institutionelle und anthropologische Bedingungen, Beschreibung der Lerngruppe), 2. Sachanalyse (kreatives Schreiben und der gewählte Bild-Impuls), 3. Didaktische Analyse, 4. Zu erreichende Ziele und Kompetenzen (Bezug zum Bildungsplan), 5. Methodische Überlegungen (Einstieg, Hinführung, Erarbeitung, Arbeitsphase, Reflexion, Abschluss), 6. Unterrichtsskizze und 7. Literaturverzeichnis.
Was ist das zentrale Thema der Unterrichtsstunde?
Das zentrale Thema der Unterrichtsstunde ist das kreative Schreiben im Anfangsunterricht. Die Schüler sollen an das kreative Schreiben herangeführt und in ihrer Schreibmotivation gefördert werden. Die Methode des Schreibens durch Stimuli, in diesem Fall ein Bild von Erwin Moser, steht im Mittelpunkt.
Welche Methode wird im Unterricht verwendet?
Die Unterrichtsstunde basiert auf der Methode des Schreibens durch Stimuli. Ein ungewöhnliches und fantasieanregendes Bild (Pinguin mit Fallschirm an einem Kaktus in der Wüste, mit abgestürzten Flugzeug) dient als Impuls für die Schüler, um kreative Texte zu verfassen.
Welche Ziele werden mit der Unterrichtsstunde verfolgt?
Die Ziele der Unterrichtsstunde sind die Heranführung der Schüler an das kreative Schreiben, die Förderung ihrer Schreibmotivation und die Berücksichtigung der individuellen Schreibfähigkeiten durch Differenzierung. Die Stunde soll zudem die Kompetenzen der Schüler im Bereich des kreativen Schreibens fördern und Bezug zum Bildungsplan nehmen.
Wie wird die Lerngruppe beschrieben?
Die Lerngruppe besteht aus 18 Schülern der ersten Klasse. Die Planung beschreibt das Arbeits- und Sozialverhalten der Schüler und ihren individuellen Entwicklungsstand im Bereich Schreiben. Besondere Aufmerksamkeit wird zwei Schülern mit sprachlichen Schwierigkeiten gewidmet, für die zusätzliche Unterstützung vorgesehen ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Unterrichtsplanung?
Schlüsselwörter sind: Kreatives Schreiben, Anfangsunterricht, Schreibmotivation, Schreibförderung, Differenzierung, Stimuli, Schreibprozess, Lerngruppe, Bildanalyse, Didaktische Planung.
Welche Rolle spielt der Bild-Impuls von Erwin Moser?
Das Bild von Erwin Moser dient als Schreibimpuls, der die Fantasie der Schüler anregen soll. Seine ungewöhnliche Darstellung (Pinguin mit Fallschirm, Kaktus, abgestürztes Flugzeug) bietet einen kreativen Ausgangspunkt für das Schreiben.
Wie wird die Differenzierung im Unterricht berücksichtigt?
Die Planung berücksichtigt die unterschiedlichen Schreibfähigkeiten der Schüler durch Differenzierung im Schreibprozess. Besondere Aufmerksamkeit wird Schülern mit sprachlichen Schwierigkeiten gewidmet, für die zusätzliche Unterstützung vorgesehen ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Kreatives Schreiben zu einem Bild in der Grundschule (1. Klasse Deutsch), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1146426