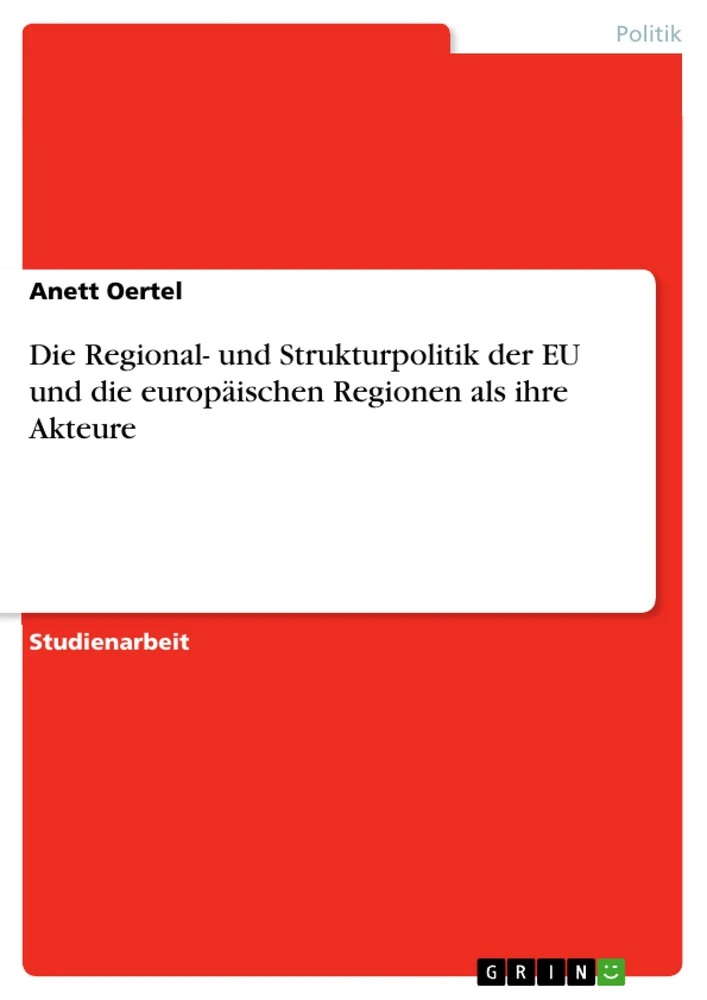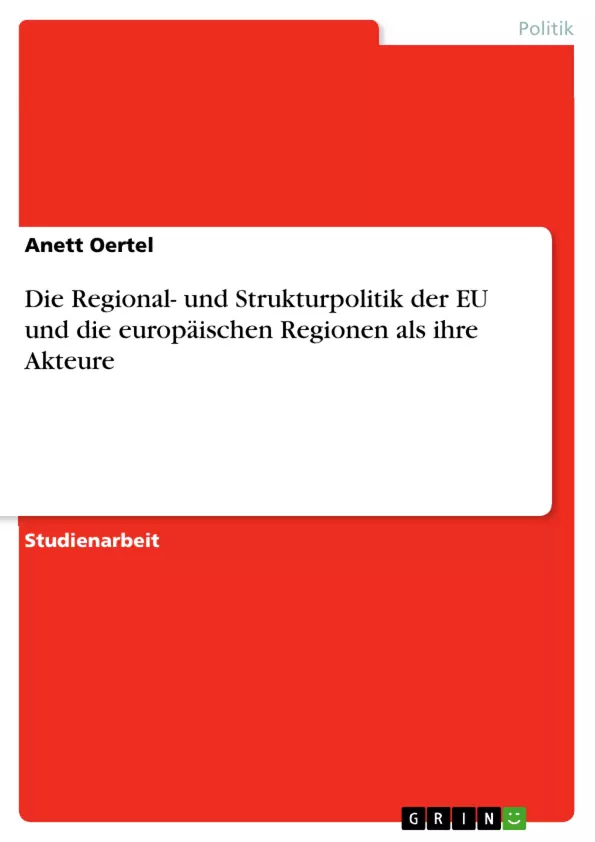Im Lissabon-Programm der Europäischen Gemeinschaft kann man erfahren, welche Aufgaben und Ziele man sich für die Zukunft vorgenommen hat. Im Zentrum stehen „Gemeinsame Forderungen für Wachstum und Beschäftigung“, die gleichzeitig die Hauptanliegen der Regional- und Strukturpolitik der EU ausdrücken. In Anbetracht von globalisierten Wirtschafts-, Arbeits- und Finanzmärkten möchte man wettbewerbsfähig bleiben und den Erfordernissen mit einer innovativen Wissen- und Wirtschaftspolitik begegnen. Während in der Grundfrage: Warum eine Regionalpolitik? Mit der solidarischen Verpflichtung der Länder geantwortet wird, kann man im Detail die wirtschaftspolitische Stoßrichtung erkennen. Die Wettbewerbsfähigkeit und Prosperität Europas soll gesichert werden. Ziel des strukturpolitischen Outputs sind die Regionen, Länder, Kommunen, eben die subnationale Ebene. Im Verlauf der Entwicklung der regionalpolitischen Instrumente der EU hat sich ein enges Netzwerk von Interessen und Institutionen herausgebildet. Wie in Folge dargestellt wird, haben EU wie Regionen einen langen Weg der gegenseitigen Stimulation hinter sich, der sich in Politikinhalten und Formen der formellen wie informellen Zusammenarbeit niedergeschlagen hat. So wurde mit der Diskussion über die Rolle der Regionen als Akteure im Mehrebenensystem der EU die Idee vom Europa der Regionen aufgeworfen, die von Seiten der regionalen Akteure intensiv lanciert und besonders von deutschen Landespolitikern und deren Initiativen bestimmt wurden. Mit der schrittweisen EU-Erweiterung wuchs die Diversifikation ihrer Mitglieder und der Anspruch an einen homogenisierenden Einfluss der politischen Steuerung. Die EU- Kommission als späterer Träger der Regionalpolitik hat den direkten Kontakt zu regionalen Akteuren gesucht, um die Effektivität ihrer Maßnahmen zu steigern und die Akzeptanz der politischen Entscheidungen in direkter Zusammenarbeit mit der Regionalebene zu erhöhen. Die Debatte um einen europaspezifischen Regionenbegriff, die Entwicklung der Regionalpolitik der EU, die Institutionalisierung regionaler Interessen und inwiefern sich die Akteure der Regionalpolitik beeinflussen, wird in der Folge dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Regionen der Europäischen Union
- »Europa der Regionen« als integratives politisches Konzept
- Der Regionenbegriff
- Die NUTS-Systematik
- Die Regional- und Strukturpolitik der EU
- Die Ziele und Förderkriterien der EU - Strukturpolitik
- Die Instrumente der EU - Strukturpolitik
- Regionen als Akteure der europäischen Regionalpolitik
- Die Einbindung der regionalen Akteure
- Regionale Interessen und ihre Institutionalisierung
- Interessenformulierung regionaler Akteure bei der EU
- Die Interessen und heutige Strategie der deutschen Länder
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Regional- und Strukturpolitik der Europäischen Union und den europäischen Regionen als deren Akteure. Sie untersucht, wie die EU die Regionen in ihre Politik einbindet und welche Interessen die Regionen im europäischen Integrationsprozess verfolgen. Dabei werden die Ziele und Instrumente der EU-Strukturpolitik sowie die Rolle der regionalen Akteure in der Politikgestaltung beleuchtet.
- Entwicklung des Konzepts „Europa der Regionen“
- Regionalpolitik der EU: Ziele, Instrumente und Förderkriterien
- Rolle der Regionen als Akteure im europäischen Mehrebenensystem
- Institutionalisierung regionaler Interessen
- Bedeutung der Regionalpolitik für die deutsche Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Lissabon-Programm der Europäischen Gemeinschaft und dessen Schwerpunkte im Bereich Wachstum und Beschäftigung vor. Hierbei wird die Bedeutung der Regional- und Strukturpolitik der EU im Kontext globalisierter Märkte hervorgehoben. Weiterhin wird der lange Weg der gegenseitigen Stimulation zwischen EU und Regionen beleuchtet, der sich in Politikinhalten und Formen der Zusammenarbeit niederschlägt. Die Diskussion über die Rolle der Regionen als Akteure im Mehrebenensystem der EU, die von regionalen Akteuren und deutschen Landespolitikern initiiert wurde, wird in diesem Zusammenhang ebenfalls aufgegriffen.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Begriff der Europäischen Regionen. Es werden verschiedene Definitionen des Regionsbegriffs sowie die Entwicklung des Konzepts „Europa der Regionen“ im Kontext der europäischen Integration diskutiert. Darüber hinaus wird die NUTS-Systematik als Instrument der regionalen Gliederung vorgestellt.
Das zweite Kapitel behandelt die Regional- und Strukturpolitik der EU. Es werden die Ziele und Förderkriterien der EU-Strukturpolitik erläutert sowie die verschiedenen Instrumente der EU-Strukturpolitik, wie der Europäische Sozialfonds (ESF) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), vorgestellt. Der Einfluss der Kohäsionspolitik auf die Regionen wird ebenfalls betrachtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Regionen als Akteure der europäischen Regionalpolitik. Die Einbindung der regionalen Akteure in den politischen Prozess sowie die Institutionalisierung ihrer Interessen werden beleuchtet. Zudem werden die Interessen der regionalen Akteure bei der EU und die heutige Strategie der deutschen Länder in Bezug auf die Regionalpolitik dargestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen europäische Regional- und Strukturpolitik, „Europa der Regionen“, Regionalismus, Föderalismus, Mehrebenensystem, EU-Institutionen, regionale Akteure, Interessenvertretung, Kohäsionspolitik, NUTS-Systematik.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Konzept "Europa der Regionen"?
Es ist ein integratives politisches Konzept, das die subnationale Ebene (Regionen, Kommunen) stärker in den europäischen Entscheidungsprozess einbinden will, um die Akzeptanz und Effektivität der Politik zu erhöhen.
Was ist die NUTS-Systematik?
NUTS ist ein hierarchisches System zur eindeutigen Identifizierung und Klassifizierung der räumlichen Einheiten in der EU, das vor allem für die Statistik und die Zuteilung von Fördermitteln genutzt wird.
Welche Ziele verfolgt die EU-Strukturpolitik?
Hauptziele sind die Förderung von Wachstum und Beschäftigung sowie die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts (Kohäsion) zwischen den verschiedenen Regionen Europas.
Welche Instrumente nutzt die EU zur Regionalförderung?
Zu den wichtigsten Instrumenten gehören der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und der Europäische Sozialfonds (ESF).
Wie bringen die deutschen Bundesländer ihre Interessen in die EU ein?
Deutsche Landespolitiker waren maßgeblich an der Debatte beteiligt. Die Interessenvertretung erfolgt über formelle Institutionen wie den Ausschuss der Regionen sowie über informelle Netzwerke und eigene Vertretungen in Brüssel.
- Citar trabajo
- Anett Oertel (Autor), 2008, Die Regional- und Strukturpolitik der EU und die europäischen Regionen als ihre Akteure, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114735