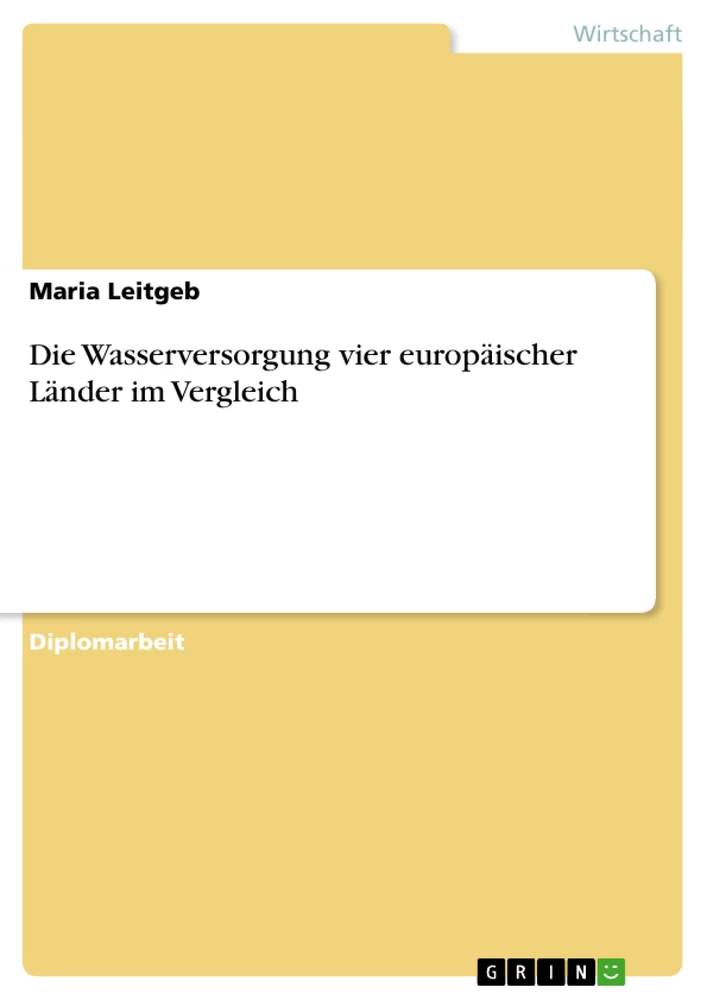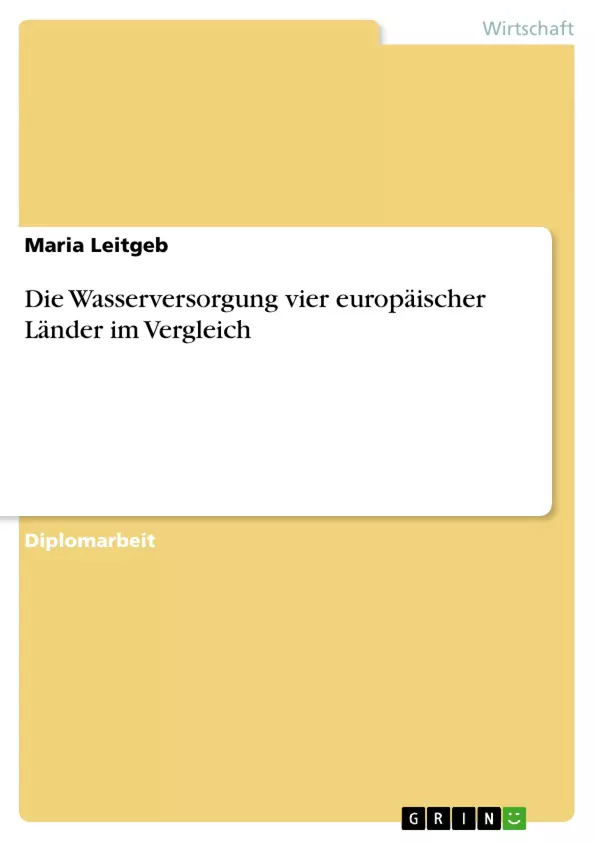Seit dem im Jahr 1992 von den vereinten Nationen der Weltwassertag proklamiert wurde, findet dieser jedes Jahr am 22. März statt. An diesem Tag versucht man auf die weltweit katastrophale Wassernot in vielen Ländern dieser Erde hinzuweisen. Betrachtet man die jüngsten Schätzungen haben derzeit 1,3 Milliarden keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und im Jahr 2050 besagen Prognosen, dass ein Viertel der Menschen unter Wassernot leiden werden. Wasserknappheit wird in 30 Staaten dieser Erde herrschen und die Hauptursache für Infektionskrankheiten und die Kindersterblichkeit ist heute schon verseuchtes Wasser.
Das Bevölkerungswachstum und der steigende globale Ressourcenverbrauch sind die Hauptursache für die fortschreitende Umweltzerstörung. Die Weltbevölkerung hat sich in den letzten 70 Jahren verdreifacht und der Wasserverbrauch ist auf 54 % des verfügbaren Süßwassers angestiegen. Er hat sich somit versechsfacht, was eine große ökologische Bedrohung darstellt, da die Stabilität einiger Staaten und Regionen durch Konflikte um Wasserressourcen gefährdet ist. Der neueste UN-Umweltbericht, GEO 3 genannt, entwickelt Szenarien für den zukünftigen Zustand der Erde in 30 Jahren. Dabei unterscheidet man:
- „Dominanz des Marktes“ – der Anteil der Menschen, die in Gebieten mit schwerem Wassermangel leben steigt überall auf dem Erdball an. Betroffen sind dabei 55 % der Erdbevölkerung. 95 % davon werden in Westasien und 65 % im Asien-Pazifik-Raum leben.
- „Dominanz der Nachhaltigkeit“ – dabei bleibt der Wassermangel in den meisten Regionen konstant oder nimmt ab. Grundlage dafür ist eine effizientere Wassernutzung. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde beim Weltgipfel 1992 in Rio de Janeiro mit dem globalen Aktionsprogramm „Agenda 21“ unternommen. Beim Nachfolgegipfel in Johannesburg in Südafrika 2002 wurde eine Bestandsaufnahme gemacht. Die Schwerpunktsetzung liegt bei:
- Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz insbesondere nachhaltige Energiepolitik und Wasserwirtschaft
- Armutsbekämpfung und Umweltschutz
- Globalisierung und nachhaltige Entwicklung
- Stärkung der UN-Strukturen in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Entwicklung.
Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Aufbau der Arbeit
- Teil 1
- 1 DER STOFF,,WASSER" - BETRACHTET ANHAND VERSCHIEDENER GESICHTSPUNKTE
- 1.1 physikalische Eigenschaften
- 1.2 Physikochemische Eigenschaften
- 1.3 Chemische Eigenschaften
- 1.4 Wasser und die Auswirkungen auf den menschlichen Organismus
- 2 WIE VIEL WASSER GIBT ES?
- 3 DIE UNTERSCHIEDLICHEN ORGANISATIONSFORMEN DER WASSERVERSORGUNGSUNTERNEHMEN
- 3.1 Der Regiebetrieb oder „Régie directe“
- 3.2 Der Eigenbetrieb
- 3.3 Wassergenossenschaften und -verbände
- 3.4 Kommunale Eigengesellschaften
- 3.5 Das,,Niedersächsische“ Betreibermodell
- 3.6 Der Pachtvertrag oder „Affermage“
- 3.7 Konzessionsmodell oder „Concession“
- 3.8 Kooperationsmodell
- 4 WASSERRAHMENRICHTLINIE DER EUROPÄISCHEN UNION
- 1 DER STOFF,,WASSER" - BETRACHTET ANHAND VERSCHIEDENER GESICHTSPUNKTE
- 2. Teil
- REPUBLIK ÖSTERREICH
- 5.1 Der rechtliche Rahmen
- 5.2 Der institutionelle Rahmen
- 5.3 Der wirtschaftliche Rahmen
- 6 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
- 6.1 Der rechtliche Rahmen
- 6.2 Der institutionelle Rahmen
- 6.3 Der wirtschaftliche Rahmen
- 7 FRANZÖSISCHE REPUBLIK
- 7.1 Der rechtliche Rahmen
- 7.2 Der institutionelle Rahmen
- 7.3 Der wirtschaftliche Rahmen
- 8 VEREINIGTES KÖNIGREICH VON GROBBRITANNIEN UND NORDIRLAND
- 8.1 Der rechtliche Rahmen
- 8.2 Der institutionelle Rahmen
- 8.3 Der wirtschaftliche Rahmen
- REPUBLIK ÖSTERREICH
- 3. Teil
- 9 PRINZIPIEN EINER NACHHALTIGEN WASSERVERSORGUNG
- 10 KENNZAHLENVERGLEICHE UND BENCHMARKINGSYSTEME
- 10.1 Bestehende Systeme zum Leistungsvergleich in der Wasserversorgung
- 10.1.1 ISO-Richtlinie zu Qualitäts- und Leistungskriterien für Wasserdienstleistungen
- 10.1.2 IWA-Kennzahlensystem
- 10.1.2.1 Österreich
- 10.1.2.2 Deutschland
- 10.1.3 Benchmarking der Weltbank
- 10.1.4 Benchmarkting in den Niederlanden
- 10.1.5 Kennzahlenvergleiche in England und Wales
- 10.1.5.1 Bericht: Tarifstruktur und Gebühren
- 10.1.6 Kennzahlenvergleich sechs skandinavischer Städte
- 10.1.7 Transaktionskostenansatz
- 10.1.8 Data Envelopment Analyse (DEA)
- 10.1.8.1 Einführung in die DEA
- 10.1.8.1.1 Das äquiproportionale Effizienzmaẞ
- 10.1.8.2 Ein DEA-Vergleich zwischen ausgewählten Wasserversorgern in Deutschland und Österreich
- 10.1.8.2.1 Monetäres Modell
- 10.1.8.2.2 Reales Modell
- 10.1.8.2.3 Reales Modell mit Inputpreisen
- 10.1.8.2.4 Erkenntnisse auf Grund des Vergleichs
- 11 DIE ZUKUNFT DER WASSERVERSORGUNG
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- Anhang 1-L1-Indikatoren des IWA-Kennzahlensystems
- Anhang 2 Indikatoren auf deren Grundlage Water UK Umweltleistung und Nachhaltigkeit in England & Wales berechnet werden
- Anhang 3 Kurzübersicht über unterschiedliche Softwarelösungen zur „DEA“
- Anhang 4 Anonymisierte, in die DEA einbezogene, Unternehmen
- Anhang 5 Datenmaterial zur Auswertung
- Anhang 6 DEA-Auswertung von „Auswertung1“
- 10.1 Bestehende Systeme zum Leistungsvergleich in der Wasserversorgung
- Organisationsformen der Wasserversorgungsunternehmen
- Rechtliche, institutionelle und wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Wasserversorgung
- Prinzipien einer nachhaltigen Wasserversorgung
- Kennzahlenvergleiche und Benchmarking-Systeme
- Zukunft der Wasserversorgung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Wasserversorgung in vier europäischen Ländern: Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Ziel ist es, die unterschiedlichen Organisationsformen der Wasserversorgungsunternehmen in diesen Ländern zu analysieren und zu vergleichen. Dabei werden die rechtlichen, institutionellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung in den einzelnen Ländern beleuchtet. Die Arbeit untersucht auch die Prinzipien einer nachhaltigen Wasserversorgung und stellt verschiedene Kennzahlenvergleiche und Benchmarking-Systeme vor.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Wasserversorgung ein und erläutert den Aufbau der Arbeit. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit dem Stoff „Wasser“ und seinen Eigenschaften. Es werden die physikalischen, physikochemischen und chemischen Eigenschaften von Wasser sowie die Auswirkungen von Wasser auf den menschlichen Organismus behandelt. Außerdem wird die Frage nach der Verfügbarkeit von Wasser beantwortet. Im zweiten Teil der Arbeit werden die unterschiedlichen Organisationsformen der Wasserversorgungsunternehmen in den vier europäischen Ländern Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien analysiert. Dabei werden die rechtlichen, institutionellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung in den einzelnen Ländern beleuchtet. Der dritte Teil der Arbeit widmet sich den Prinzipien einer nachhaltigen Wasserversorgung. Es werden verschiedene Kennzahlenvergleiche und Benchmarking-Systeme vorgestellt, die zur Bewertung der Leistung von Wasserversorgungsunternehmen eingesetzt werden können. Abschließend wird ein Ausblick auf die Zukunft der Wasserversorgung gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Wasserversorgung, die Organisationsformen der Wasserversorgungsunternehmen, die rechtlichen, institutionellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Wasserversorgung, die Prinzipien einer nachhaltigen Wasserversorgung, Kennzahlenvergleiche, Benchmarking-Systeme und die Zukunft der Wasserversorgung. Die Arbeit analysiert die Wasserversorgung in vier europäischen Ländern: Österreich, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Organisationsformen der Wasserversorgungsunternehmen in diesen Ländern und untersucht die Herausforderungen und Chancen der nachhaltigen Wasserversorgung.
- Quote paper
- Mag. Maria Leitgeb (Author), 2004, Die Wasserversorgung vier europäischer Länder im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114737