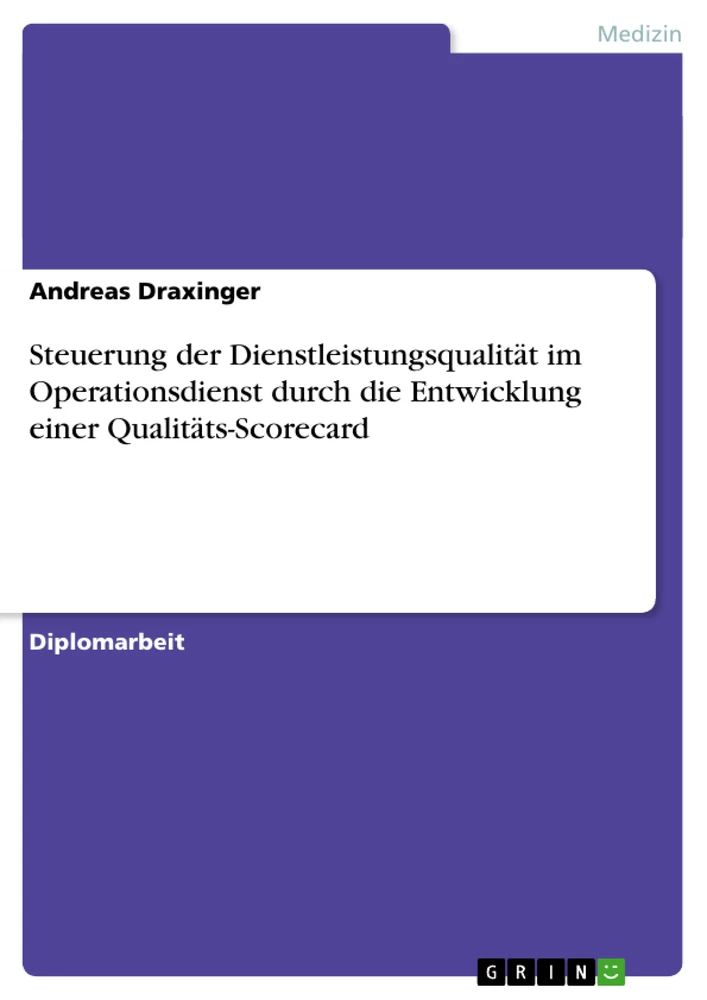Die Steuerung der Dienstleistungsqualität als Managementaufgabe im Krankenhaus gewinnt vor dem Hintergrund des verschärften Wettbewerbs immens an Bedeutung. Aus einer ganzheitlichen und systemorientierten Sichtweise heraus ist es daher wichtig, dass das Krankenhaus-Management sich der schwierigen Aufgaben stellt, komplexe Steuerungssysteme zu entwickeln bzw. anzuwenden.
Der Autor, der selbst als Krankenpfleger im OP tätig ist, möchte einen Beitrag zur Managemententwicklung im Krankenhausbereich leisten, indem er eine bestimmte Vorgehensweise für ein systematisches Qualitätsmanagement beim Operationsdienst entwickelt. Zielsetzung der Diplomarbeit ist daher die Entwicklung einer Bereichs-Balanced-Scorecard zur Steuerung der Dienstleistungsqualität eines Operationsdienstes.
Die Vorgehensweise in der Arbeit gliedert sich in 6 Kapitel. In Kap. 1 werden die Problemstellung und die Zielsetzung des Verfassers für diese Arbeit erläutert. Der erforderliche theoretische Begriffs- und Bezugsrahmen zur Operationalisierung von qualitätsbezogenen Variablen, Indikatoren, Zielgrößen oder Maßnahmen wird in Kap. 2 dargestellt; dieser ist zugleich Basis für die Kapitel 3 und 4. Das Kap. 3 befasst sich mit den Stärken und Schwächen verschiedener Erhebungsmethoden und Erhebungsinstrumente zur Evaluation der Dienstleistungsqualität. Vor dem Hintergrund der Komplexität der qualitätsbezogenen (Wechsel-)Wirkungen im Gefüge sozialer Dienstleistungen, vor allem der gegenseitigen Abhängigkeit von internen Kunden- und Lieferantenbeziehungen, gilt es die besonderen Schwierigkeiten bei der Messung der Dienstleistungsqualität zu berücksichtigen. Im Kap. 4 erfolgt die Entwicklung eines Qualitäts-Scorecard-Modells. Dieses Kapitel bildet den Schwerpunkt der Arbeit. Das Kap. 5 schildert kurz zu berücksichtigende Aspekte bei der Implementierung einer Balanced Scorecard. Zuletzt erfolgen in Kap. 6 eine Zusammenfassung, ein persönliches Fazit und ein Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Ausgangssituation
- Steuerung eines Systems
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Theoretischer Begriffs- und Bezugsrahmen
- Dienstleistungs-Management
- Dienstleistungs-Management im Krankenhaus
- Controlling
- Qualitätsmanagement und Qualitätssteuerung
- Operationsdienst als Dienstleister im OP-Bereich
- Spezifische Eigenschaften des Operationsdienstes
- Implikationen der Dienstleistungscharakteristika
- Externe Einflussfaktoren
- Defizite, Probleme und interne Einflussfaktoren
- Modell von Donabedian
- Modell von Parasuraman, Zeithaml und Berry
- Modell von Güthoff
- Finanzwirtschaftliche Aspekte
- Erhebungsmethoden und Erhebungsinstrumente
- Grundproblematik bei der Erhebung von Qualitätsmerkmalen
- Diskussion ausgewählter Erhebungsmethoden und -instrumente
- Entwicklung einer Bereichs-Qualitäts-Scorecard
- Balanced Scorecard-Grundlagen
- Ableitung strategischer Ziele
- Aufbau von Ursache-/Wirkungsbeziehungen
- Auswahl der Kennzahlen und Zielwertfestlegung
- Bestimmung strategischer Aktionen
- Realisierung der Entwicklungsschritte
- Implementierung der Balanced Scorecard
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Steuerung der Dienstleistungsqualität im Operationsdienst. Dabei wird die Entwicklung einer Qualitäts-Scorecard als Instrument zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität im Fokus stehen.
- Steuerung der Dienstleistungsqualität im Operationsdienst
- Entwicklung einer Qualitäts-Scorecard
- Anwendung der Balanced Scorecard
- Analyse von Kennzahlen und Zielwerten
- Optimierung von Prozessen und Abläufen im Operationsdienst
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung der Dienstleistungsqualität im Operationsdienst. Es werden die Ausgangssituation, die Bedeutung der Steuerung eines Systems und die Zielsetzung der Arbeit dargestellt.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem theoretischen Begriffs- und Bezugsrahmen. Es werden zentrale Konzepte wie Dienstleistungs-Management, Controlling, Qualitätsmanagement und Qualitätssteuerung sowie die spezifischen Eigenschaften des Operationsdienstes erläutert.
Im dritten Kapitel werden die Erhebungsmethoden und -instrumente zur Analyse der Dienstleistungsqualität im Operationsdienst diskutiert. Dabei wird die Grundproblematik der Erhebung von Qualitätsmerkmalen beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der Entwicklung einer Bereichs-Qualitäts-Scorecard. Es werden die Grundlagen der Balanced Scorecard, die Ableitung strategischer Ziele, der Aufbau von Ursache-/Wirkungsbeziehungen, die Auswahl von Kennzahlen und Zielwerten sowie die Bestimmung strategischer Aktionen erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Dienstleistungsqualität, Operationsdienst, Qualitäts-Scorecard, Balanced Scorecard, Kennzahlen, Zielwerte, Steuerung, Controlling und Qualitätsmanagement.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann die Dienstleistungsqualität im OP gesteuert werden?
Die Steuerung erfolgt durch ein systematisches Qualitätsmanagement, das Instrumente wie eine Bereichs-Balanced-Scorecard nutzt, um komplexe Abläufe messbar zu machen.
Was ist eine Qualitäts-Scorecard im Krankenhauskontext?
Es ist ein Steuerungsinstrument, das strategische Ziele, Kennzahlen und Maßnahmen verknüpft, um die Qualität über finanzielle Aspekte hinaus ganzheitlich zu betrachten.
Warum ist die Messung der Qualität im Operationsdienst so schwierig?
Die Schwierigkeit liegt in der Komplexität sozialer Dienstleistungen und der gegenseitigen Abhängigkeit von internen Kunden- und Lieferantenbeziehungen (z.B. zwischen Chirurgie und Pflege).
Welche Modelle dienen als Basis für das Qualitätsmanagement?
Die Arbeit stützt sich auf etablierte Modelle wie das von Donabedian (Struktur-, Prozess-, Ergebnisqualität) sowie Parasuraman, Zeithaml und Berry.
Was sind die Vorteile einer Balanced Scorecard für den OP?
Sie ermöglicht die Ableitung strategischer Ziele, den Aufbau von Ursache-Wirkungsbeziehungen und die Optimierung interner Prozesse zur Steigerung der Patientensicherheit.
- Citar trabajo
- Diplom-Pflegewirt (FH) Andreas Draxinger (Autor), 2007, Steuerung der Dienstleistungsqualität im Operationsdienst durch die Entwicklung einer Qualitäts-Scorecard, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114744