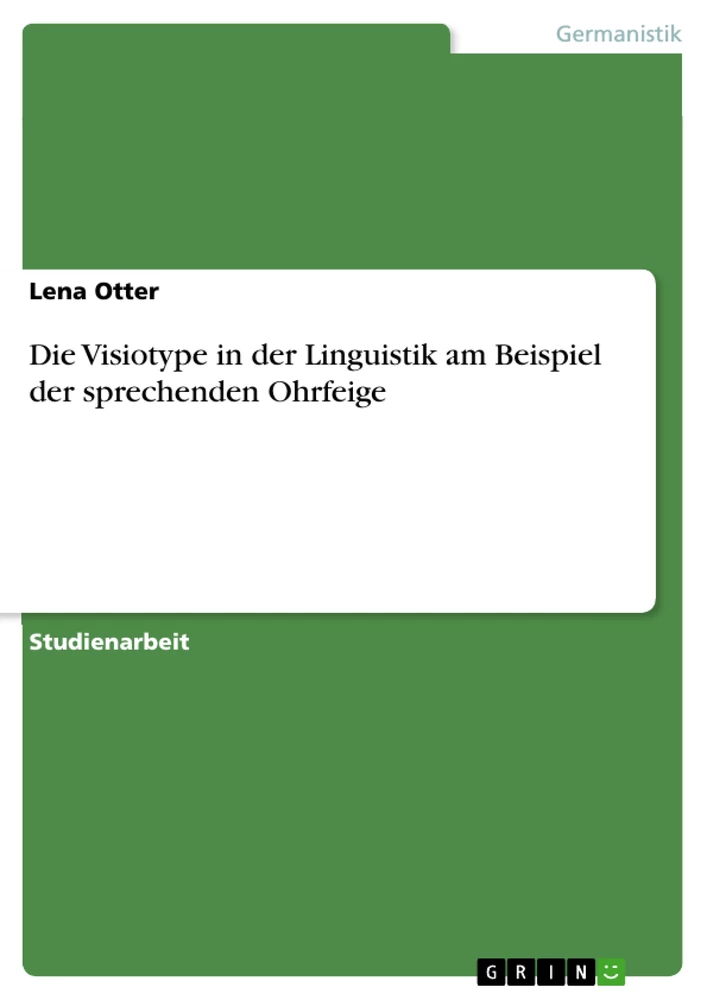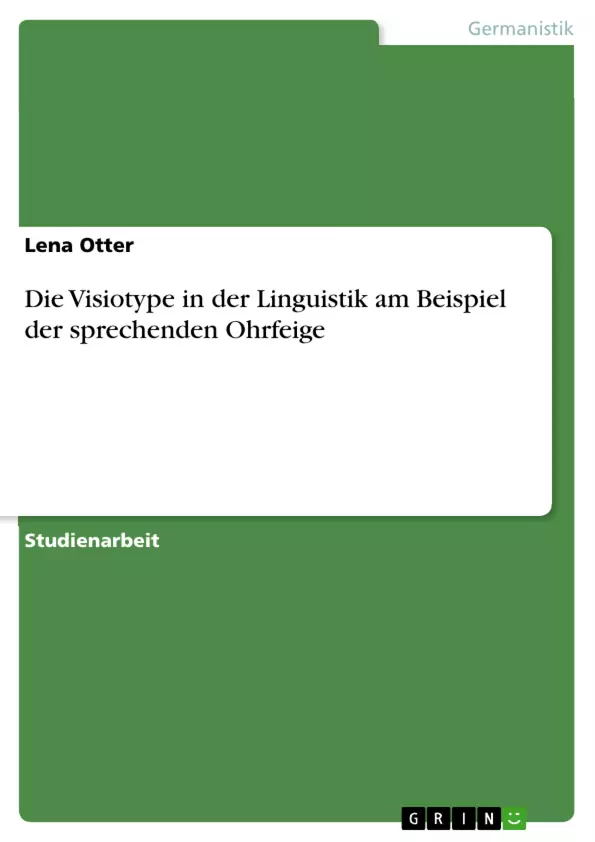Eine junge Frau unterbricht die Sitzung des CDU-Parteitages, ohrfeigt den Bundeskanzler und schreit: „Nazi“. Die junge Frau ist Beate Klarsfeld, der Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und die Auseinandersetzung hat vor über 35 Jahren stattgefunden. Was hat das mit uns zu tun? Vor allem: Was hat das mit dem Linguistik Proseminar „Sprache in politischen Konflikten“ zu tun?? Der Konflikt ist zwar eindeutig, politisch ist er auch, wo aber ist die Sprache???
Auch wenn nicht viele Worte gewechselt werden: Die Ohrfeige ist ein klares, sprechendes Statement und bildet ein sehr interessantes Beispiel für die, - in der Literatur vor allem von Uwe Pöksen behandelte - Visiotype. Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit möchte ich die Hintergründe der sprechenden Ohrfeige
von 1968 sowie die Reaktionen darauf beleuchten. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Phänomen der Visiotype und dessen Verwendbarkeit in politischen Konfliktsituationen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die sprechende Ohrfeige
- Die sprechende Ohrfeige...
- ...und ihr Nachhall
- Was ist Visiotype?
- Sprachliche und visuelle Zeichen
- Die Ohrfeige als Schlagbild
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit „Die sprechende Ohrfeige“ untersucht den Einsatz von visuellen Zeichen in politischen Konflikten am Beispiel der Ohrfeige, die Beate Klarsfeld 1968 Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger versetzte. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe der Tat, die Reaktionen darauf und die Bedeutung der Ohrfeige als Visiotype, ein Konzept, das von Uwe Pöksen geprägt wurde.
- Die Hintergründe der „sprechenden Ohrfeige“ und die Motivation von Beate Klarsfeld
- Die Reaktionen auf die Tat und die öffentliche Wahrnehmung der Ohrfeige
- Das Konzept der Visiotype und dessen Bedeutung in politischen Konfliktsituationen
- Die Ohrfeige als symbolische Geste und deren Wirkung auf die Öffentlichkeit
- Die Rolle der Sprache und visueller Zeichen in der politischen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und führt in die Thematik der „sprechenden Ohrfeige“ ein. Sie beleuchtet die Hintergründe der Tat und die Motivation von Beate Klarsfeld, die sich gegen die nationalsozialistische Vergangenheit von Kurt Georg Kiesinger wandte.
Das Kapitel „Die sprechende Ohrfeige...“ beschreibt die Ereignisse, die zur Ohrfeige führten, und beleuchtet die Vorgeschichte der Auseinandersetzung zwischen Beate Klarsfeld und Kurt Georg Kiesinger. Es wird die Rolle der Medien und der öffentlichen Meinung in diesem Konflikt beleuchtet.
Das Kapitel „...und ihr Nachhall“ analysiert die Reaktionen auf die Tat und die öffentliche Wahrnehmung der Ohrfeige. Es wird die Debatte in der Gesellschaft und in den Medien beleuchtet, die sich sowohl auf die Tat als auch auf die Person von Beate Klarsfeld konzentrierte.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Visiotype, die sprechende Ohrfeige, Beate Klarsfeld, Kurt Georg Kiesinger, politische Konflikte, Sprache, visuelle Zeichen, Symbolismus, öffentliche Meinung, Medien, und die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Visiotype?
Das Konzept der Visiotype (nach Uwe Pöksen) beschreibt visuelle Zeichen oder Bilder, die in politischen Konflikten als "schlagkräftige" Aussagen fungieren, ähnlich wie Schlagworte in der Sprache.
Warum ohrfeigte Beate Klarsfeld Kurt Georg Kiesinger?
Die Ohrfeige im Jahr 1968 war ein Protest gegen die nationalsozialistische Vergangenheit des damaligen Bundeskanzlers und sollte ein öffentliches Zeichen setzen.
Inwiefern ist eine Ohrfeige ein „linguistisches“ Beispiel?
In politischen Konflikten können Handlungen als "sprechende Statements" fungieren, bei denen das visuelle Zeichen die verbale Kommunikation ersetzt oder verstärkt.
Wie reagierte die Öffentlichkeit auf die Tat von Klarsfeld?
Die Tat löste eine breite gesellschaftliche Debatte aus, die von scharfer Kritik bis hin zu symbolischer Unterstützung reichte und die Medienlandschaft prägte.
Welche Rolle spielen visuelle Zeichen in der politischen Kommunikation?
Visuelle Zeichen wie die Ohrfeige dienen als Symbole, die komplexe politische Auseinandersetzungen verdichten und eine starke emotionale Wirkung erzielen.
- Citation du texte
- Lena Otter (Auteur), 2004, Die Visiotype in der Linguistik am Beispiel der sprechenden Ohrfeige, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/114765